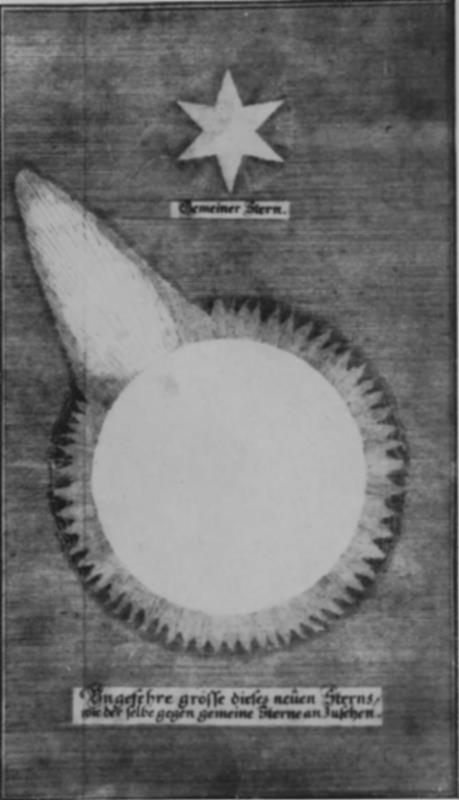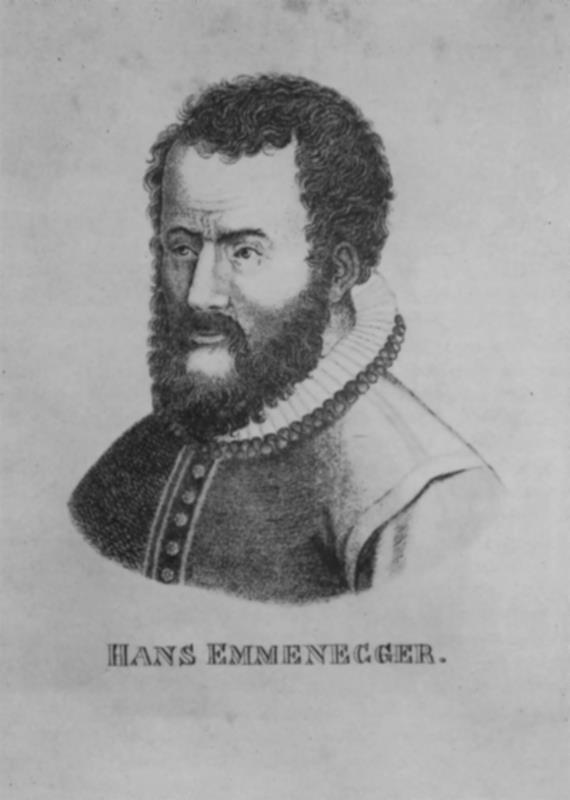|
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 001 - arpa Themen Projekte Hans Mühlestein: Der Grosse Schweizer Bauernkrieg
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 003 - arpa Themen Projekte
HANS MÜHLESTEIN
IM SELBSTVERLAG CELERINA 1942
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 004 - arpa Themen Projekte SÄMTLICHE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER DRAMATISIERUNG, VERFILMUNG UND DER ÜBERSETZUNG IN ALLE SPRACHEN, SOWIE ALLE SONSTIGEN REPRODUKTIONSRECHTE VOM VERFASSER VORBEHALTEN COPYRIGHT 1942 BY DR. HANS MÜHLESTEIN, CELERINA, SWITZERLAND DRUCK: BUCHDRUCKEREI GUSTAV HOFMAIER, FLORASTR. 18, BASEL CLICHÉS: BECKER & BERTSCH I, THIERSTEINERALLEE 29, BASEL TITELSCHRIFTEN: HAAS'SCHE SCHRIFTGIESSEREI, MÜNCHENSTEIN Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 005 - arpa Themen Projekte
Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln.» Goethe, Faust. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Oberst" der Entlebucher Bauerntruppen |
|
Nach einem zeitgenössischen Originalstich in der |
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 064 - arpa Themen Projekte
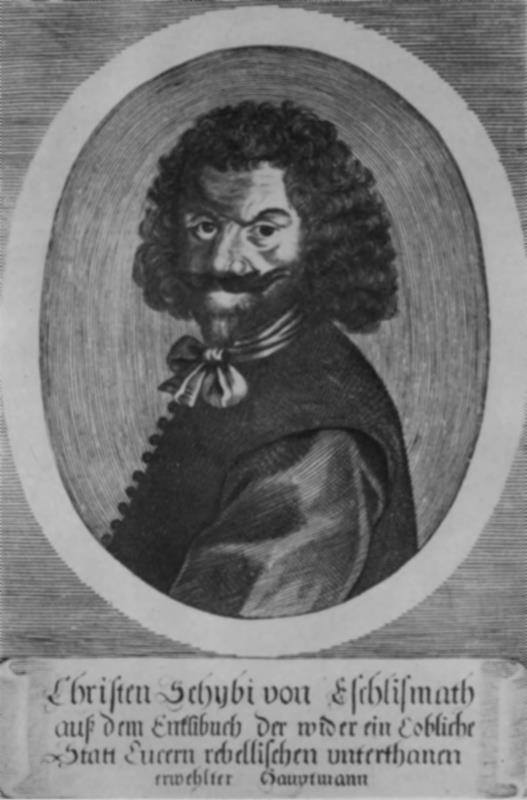
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 065 - arpa Themen Projekte
sinnlos gehäuft im Müssiggang verweste — mitten im Sturm
des Elends eines arbeitsamen und tapferen Volkes, das die Not des gemeinen
Batzens in einem Krieg auf Tod oder Leben zwang.
Allzu einfältig gläubig noch, glaubte es sich schon aller seiner
Beschwerden sogut wie enthoben, als es nur seine Not in die Welt
schrie und als es nur zum Bund der Brüder aufgerufen wurde. Es bedurfte
nicht einmal der Mahnbriefe. Längst war ihnen das Aufgebot
der Not voraufgeeilt. Aber als der Ruf der Entlebucher erscholl, dass
sie Brüder seien in der Not, da ist das Aufgebot auf Flügeln der Begeisterung
von Mund zu Mund geflogen und in den hintersten Winkel
des Landes geeilt, ja, weit über die luzernischen Grenzen hinaus.
Nicht vier, sondern sechs Aemter brachte es in jubelnde Bewegung
und selbst «eine nicht geringe Zahl von Bauern aus den Kantonen
Bern und Solothurn» machten sich auf den Weg zum Ort des verheissenen
Bundes. «Wirklich sah man schon am 25. Februar alle
Strassen von Landsleuten wimmeln, die nach Wolhusen eilten.»
Kein Wunder, dass in der Stadt Luzern schon seit dem Vierundzwanzigsten
jede Nacht zwei «Gaumeten» die sechs Stadttors
überwachen mussten und dass im Turm und Speicher zu Barfüssern
Geschütze aufgestellt wurden. Kein Wunder auch, dass ebenfalls bereits
am Vier- und am Fünfundzwanzigsten die Räte von Bern und
Solothurn ihre Agentenschwärme ausschickten, um die «Volksstimmung
erforschen und namentlich die Wirtshausgespräche überwachen»
zu lassen.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 066 - arpa Themen Projekte
V.
Das Richtfest des Aufruhrs
Tiefer Schnee bedeckte, noch ungewohnt spät im Jahr, das ganze
Land. So konnten die Bauern ihre gewohnten Frühjahrsarbeiten auf
dem Felde ohnehin nicht verrichten. Sie hatten daher Zeit, sich am
Aschermittwoch, dem sechsundzwanzigsten Februar, von allen Seiten,
von nah und fern, nach dem prächtig inmitten ihres Gebiets gelegenen
Wolhusen aufzumachen. In noch nie gesehenen Massen strömten
sie vom Entlebuch, von Willisau, von Ruswil und von Malters her
dem Orte des verheissenen Bundes zu; die meisten zu Fuss, darunter,
mit flatternden Fahnen, ganze «Regimenter» von Knüttelträgern mit
Musik und Gesang, angeführt von alten Landsknechten wie Schybi;
viele auch auf Wagen aller Art, von denen herab die Alphörner um die
Wette dröhnten; nicht wenige, ja ganze Kavalkaden, sogar hoch zu
Ross, darunter besonders auch die Entlebucher Delegierten.
Das grosse Ereignis und die eigentliche Ueberraschung für alle,
die nicht schon der ersten Landsgemeinde der Entlebucher vor genau
einem Monat beim Heiligen Kreuz beigewohnt hatten, war der feierliche
Aufmarsch der Geistlichkeit eines weiten Umkreises im Lande.
Mit ehrerbietigem Staunen erkannte man an deren Spitze, während
Alles verstummte und die Hüte von den Köpfen flogen, den weitherum
berühmten Kapitelsdekan und Pfarrer von Ruswil und Wolhusen,
Melchior Luthard, Stadtbürger von Luzern, von dem jedermann
wusste, dass er eben kürzlich vom Papst zum apostolischen
Protonotar ernannt worden war. Hinter ihm schritten die Entlebucher
Pfarrer, der von Hasle, Johannes Gerber, der von Dopplischwand,
Leodegar Bürgi, aber auch der Pfarrer von Romoos, Hans
Heinrich Sidler, und noch mancher andere. Dann erschienen wieder
die «drei Teilen», Käspi Unternährers Hünengestalt als «Wilhelm
Teil» in der Mitte, und hinter ihnen in langem Zuge die Ausgeschossenen
der zehn Aemter, die Pannermeister, Landeshauptleute, Landesfähnriche
und Landessiegler meist zu Pferde —, voran die vierzig
Entlebucher Geschworenen, die als die Baumeister des Bundes von
freudigen Begrüssungsrufen überschüttet wurden, allen voran der
«schöne Pannerherr» Hans Emmenegger. Seine hohe Gestalt, sein
ernstes Haupt mit der Denkerstirn, der strengen, wuchtigen Nase,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 067 - arpa Themen Projekte
besorgten Blick, sein festliches Gewand und sein würdiges, feierliches
Gehaben liessen ihn fast wie einen König der Bauern erscheinen.
Aber auch der Stadtsechser Heinrich Peyer von Willisau ragte
als schöne, würdige Figur hervor; ebenso der «lange Steiner» Kaspar
an der Spitze der Rothenburger, dessen feingeschnittenes Gesicht mit
dem weichen Christusbart und den grossen, melancholischen Augen
so gar nichts Bäuerliches an sich hatte. Schliesslich kam die unabsehbare
Reihe der Knüttelmänner, an deren Spitze in seinem bunten
Landsknechtsgewand der Christen Schybi seine Blicke wild herumschoss,
seinen struben Schnauz und Bart wie ein Luchs sträubte und
seine längst verdorrten Waden wie in alten Zeiten ausschweifend
nach links und rechts herauszudrehen versuchte.
Bald war die weiträumige Kirche zu Wolhusen zum Brechen
voll, und ein wahres Heerlager drängte sich in weitem Umkreis um
sie. «Die Kirche war wie ein Theater ausgerüstet. Für die Redner
waren hohe Tische bereit.» In der Mitte, auf der Treppe vor dem Chor,
war die Haupttribüne. Zur Eröffnung der ganzen Feierlichkeit wurde
vom Dekan Lüthard, unter Assistenz der gesamten Geistlichkeit, ein
Gottesdienst zelebriert, während die ganze riesige Gemeinde drinnen
und draussen auf die Kniee ging. «Nach Vollendung des feierlichen
Gottesdienstes und nach Anrufung des Heiligen Geistes — Invocato
prius Dei auxilio —wurde die Landsgemeinde eröffnet.» Die Priester
nahmen im Chore Platz. Für die Entlebucher waren die Ehrenplätze
ganz vorn vor der Haupttribüne reserviert. Seitlich derselben richtete
sich der Schulmeister und Organist von Schüpfheim, Johann Jakob
Müller, der Landschreiber des Entlebuchs, als «Ratsschreiber» der
Landsgemeinde der zehn Aemter, als Kanzler des neuen Bundes, ein.
Jetzt betrat der Landespannermeister Hans Emmenegger, flankiert
von den drei Tellen, mit grossem Ernst die Tribüne, in der Hand
seine mit Hülfe des Schulmeisters feierlich in Schrift gefasste Rede.
«Ehrsame, ehrbare, fromme, liebe und getreue Freunde, Nachbarn,
Mitlandleute, Bundesgenossen und Brüder!» So begann er, unter
lautloser Spannung der ganzen Gemeinde, zuerst stockend und jedes
Wort einzeln betonend. Dann aber kam er in Fluss, und zum Staunen
Aller, die ihn kannten, enthüllte sich der schwerblütige Bauer als
ein Redner von bezwingend natürlicher Begabung:
«Wir können und wollen mit diesem unserm Vortrag nicht verhalten,
wie und was Gestalten sich zugetragen zwischen unsern Gnädigen
Herrn und Obern und uns aus Entlebuch, dass etwas Zwietracht
mehr theils wegen der neuen Aufsätzen erwachsen ist, dass wir auch
ebenmässig mit täglichen Beschwerden überladen sind und dass auch
unsere alten Gerechtigkeiten, laut Brief und Siegeln, seit vielen Jahren
her übersehen worden sind. Auch hat man diese schlecht gehalten.
Zudem haben wir uns zu Gemüths geführt, wie und was Gestalt uns
künftiger Zeiten solche Läuf, Neuerungen und Verderbniss dem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 068 - arpa Themen Projekte
werden, indem die Obrigkeiten das gemeine Geld oder die Handmünze
ohne Not abgerufen haben. Diese tragen hieran die Schuld, indem sie
auf die Münzproben kein besseres Aufsehen gehabt haben, indem sie 20
oder 30 Jahre lang Münzen für gut anerkannten, statt sofort abzurufen,
ehe und bevor der gemeine Mann hiedurch beschwert wurde.
Auch sonst sind die Läufe bös, so dass der gemeine Bauersmann kaum
bei Haus und Heim verbleiben, seine Gülten, Zinsen und Schulden bezahlen
und Weib und Kind mit Gott und mit Ehren erhalten kann.
Würde diesen und andern Beschwerden Niemand zuvorkommen, so
würden in kurzen Jahren die meisten unter uns von Haus und Heim
getrieben werden, indem, wie wir erfahren haben, keine Barmherzigkeit,
keine brüderliche oder bürgerliche Liebe, kein Erbarmen mit uns
Unterthanen mehr gebraucht wird. Ein Gantbrief über den andern,
eine Neuerung über die andere, eine Strafe über die andere folgt ohne
Gnade, da mancher redliche Landmann lange Zeit und seit vielen
Jahren hoffte, die Schulden zu zahlen, dies aber nicht zu thun im
Stande war, da es von Jahr zu Jahr schwieriger wurde zu haushalten
und leicht ein Unfall vom Wasser, Verlust von Rossen oder Vieh verursachte,
dass einer von Haus und Heim gestossen, sein Gut musste
fahren lassen und ohne Gnade viele von ihrem lieben Vaterland weichen
und in die Ferne ziehen mussten, so ins Elsass, Breisgau und ins
Schwabenland. Mancher, der seine Gültherrn bezahlen wollte und dem
nur wenig an Geld fehlte, wurde mit schändlichen Worten, Lump,
Hundstud und dergleichen gescholten, oft auch gethürmt und gebunden
in die Stadt ins Gefängnis geführt, dass es oft einen Stein hätte
erbarmen mögen...»
Dies alles und noch viel mehr habe die Entlebucher dahin gebracht,
der Ungebühr «mit geeigneten Mitteln zu widerstreben und
ernstlich daran zu sein, dass unsere alten Rechte laut Siegel und
Brief erfolgen», «damit der gemeine arme Bauersmann bei diesen
bösen Läufen könne bei Haus und Heim, Weib und Kind verbleiben».
«Da ihr aber, ehrende, liebste und getreueste Nachbarn, Bundsgenossen
und Brüder, die ihr hier versammelt seid» — so fuhr der
Pannermeister mit erhobener Stimme fort —
«uns entboten und kundgemacht, dass ihr auch mit gleichen Beschwerden
krank und bedrängt seyd und mit uns derselben und der
neuen Aufsätze ledig zu werden begehrt, so ist, wie wir hoffen, uns
zum Besten diese Landsgemeinde angesetzt worden, um die höchst
nothwendigen gemeinsamen Angelegenheiten zu vereinbaren. Was wir
also mit einander für gut auf- und annehmen, das wollen wir einander
helfen schirmen und erlangen mit Leib, Ehre, Gut und Blut. Und
wenn uns in künftigen Zeiten etwas angelegen ist, wie jetzt den eidlich
verbundenen Aemtern, so soll eines dem andern sein Anliegen offenbaren
und zuschreiben, eine Tagsatzung allhie zu Wolhusen, oder wo
sonst uns Aemtern gefällig sein wird, anzustellen, uns alle Zeit zu berathschlagen
und vereinbaren, damit wir alle Zeit einhellig eines Gemüthes,
eines Willens seyn und bleiben und unsern Herren und
Obern und andern Orten antworten können. Damit wir nun fürderhin
jetzt und in alle Ewigkeit bei und mit einander ,heben und legen',
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 069 - arpa Themen Projekte
Leib und Blut zusammenschwören und helfen und uns verbinden.
Amen.'
Eine «Tagsatzung», wann und wo es den Bauern gefallen wird!
Das zeigt, worauf ihr geheimster Wunsch zielte: nicht nur auf Mitregierung
im Sinne des hochpolitischen Artikels in den Willisauer,
Ruswiler und Hochdorfer Artikeln, sondern auf völlige Unabhängigkeit,
auf Selbstregierung. Nun galt es noch, die solidarische Haftung
für alle Folgen des Kampfes, wen sie auch treffen sollten, in den
Schwur einzubeziehen. Darum fuhr Hans Emmenegger fort:
«Nun aber soll eigentlich wohl zu merken nicht vergessen werden,
dass wir unsern Gnädigen Herrn und Obern festiglich und kreftiglich
einbinden wollen und sollen, dass, so diese Sache einmal wieder
zu einem Ende gelangen würde, sie keinen einzigen Menschen dies
über kurz oder lang sollen entgelten lassen. Auch allen denen, die Rath
und That dazu gegeben haben, sollen und wollen wir festiglich einbinden,
dass sie, wo der Geringste dieser Ursache wegen etwas zu entgelten
oder Strafe zu erleiden hätte, dies als eine alle und jeden berührende
Sache zu betrachten und darauf schwören, demselben zu helfen,
als wenn es ihn selber antreffen würde. Damit man also niemehr von
einander falle und einander immer behelfen sei, sollen wir mit diesem
Eidschwur verbunden sein.»
Aber auch die feierliche Anrufung Gottes, der Maria und aller
Heiligen durfte in einem solch fromm katholischen Lande nicht
fehlen, und darum gab Hans Emmenegger seiner Eröffnungsrede
diesen Abschluss:
«Damit wir diese grosse und nützliche Zusammenkunft glücklich
beginnen und vollenden, sollen und wollen wir Gott den Allerhöchsten,
Maria, die Himmelskönigin, samt allem himmlischen Heer anrufen
und demüthig bitten, dass sie uns den heiligen Geist mit seinen Gaben
senden wollen, damit wir solches Geschäft vollbringen können voraus
Gott dem Allmächtigen zu Lob und allen Heiligen, unsern Seelen zu
Wolfahrt, und unserm Leib, Gut und Blut zu Nutzen und den nächsten
Nebenmenschen zu helfen, damit wohl erschiessen könne, was
nach göttlichem Recht und billig ist. Amen.»
Dem «gemeinen armen Bauersmann», «den nächsten Nebenmenschen
zu helfen»: das enthüllte das Grundmotiv des von reiner
Rechtlichkeit getragenen reichen Bauern Emmenegger. Wenn irgend
etwas, so hat diese Rede ihn zum unbestrittenen und bis zum tragischen
Ende niemals angefochtenen Führer aller zehn Aemter gemacht.
Nicht lauter Jubel, sondern tiefe Ergriffenheit herrschte, als er seine
Rede zuende brachte. Denn jetzt ward einem jeden klar, dass es auf
Tod und Leben um sein eigenes Verbleiben auf der väterlichen Erde
ging...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 070 - arpa Themen Projekte
Umso stürmischer wurde die allgemeine Umfrage, die Hans Emmenegger
nun eröffnete, benutzt. Jeder, auch der Hinterste, fühlte
sich gedrängt, seinen ganz besonderen Lebensanspruch anzumelden:
als wäre nur gerade jetzt noch Zeit, ihn ins Buch des Schicksals einzutragen
und in den gemeinsamen Schwur der Brüder miteinzubinden.
«Die Sprecher und Abgeordneten der übrigen neun Aemter» —
so fasste der wohlmeinendste Geschichtsschreiber des Bauernkriegs, der
Domdekan Alois Vock, schon vor mehr als hundertzwanzig Jahren
diese Umfrage zusammen — «erzählten weitläufig die Beschwerden
ihres Amtes gegen die Regierung, und vergassen dabei nicht das
Mindeste; alle Strafgelder, welche die Landvögte bezogen, jedes unsanfte
Wort, das sie ausgesprochen hatten, Gülten und Reisgelder
(Soldatensteuer), Handwerksverordnungen und Güterbereinigungen,
Fall und Ehrschatz (Todesfall- und Erbschaftssteuer), Forstordnungen
und Waisenrechnungen, Salzmonopol, Umgeld und Trattengeld,
Weidgangsverbote und Bedrückung der Gemeinden mit Strassenanlagen,
Verordnungen über Jagen, Fischen und Besorgung der Findelkinder,
dies und viel anderes, auch ganz örtliche Beschwerden
kleiner Dorfschaften, Weiler und Höfe, liefen in den verschiedenen
Reden bunt durcheinander und wurden umständlich vorgetragen.»
Nun hatte man aber nicht vor, neuerdings Artikel aufzusetzen,
die die Beschwerden und Verlangen aller zehn Aemter zusammengefasst
hätten. Vielmehr legte man hier einfach alle vorher beschlossenen
und bereits in Schrift gefassten Artikel — die der Entlebucher,
der Willisauer, der Ruswiler, der Rothenburger, der Hochdorfer und
derer von Kriens und Horw zusammen und forderte die übrigen Aemter
auf, ihre Forderungen «beförderlich schriftlich einzureichen». Dabei
wurden allerdings aus der Versammlung selbst noch eine ganze Reihe
Vorschläge gemacht und zum Beschluss erhoben. So etwa der: «Wer
keinen Pflug braucht, soll auch keine Vogtsteuer entrichten»; denn
das war ein besonders notwendiger Schutz für die ganz armen
Bauern, die kein Haupt Vieh, geschweige ein Pferd, nur Ziegen und
Hühner, bestenfalls ein Schwein oder zwei besassen, und deren waren
viele. Oder auch der merkwürdige Beschluss: «Wer studieren will,
soll 600 Gulden Vermögen besitzen.» Das mochte eine erste Regung
sein, um sich eine eigene, unabhängige, «studierte» Beamtenschaft zu
schaffen. Der wichtigste dieser Sonderbeschlüsse aber war der: «Ohne
Zustimmung aller Aemter darf keine einzelne Landvogtei eine Vereinbarung
mit dem Rate treffen.» Damit wurde jedem künftigen Versuch
der Herren, die einzelnen Landesteile voneinander zu trennen,
ein Riegel geschoben. Dieser Beschluss wurde denn auch noch in
aller Eile in den nun zu beschwörenden «Bundesbrief» aufgenommen.
Worauf es aber hier, auf dem ersten umfassenden Richtfest des
Aufruhrs, ankam, das war: den grossen, allgemeinen Gedanken der
Solidarität aller Bedrückten, wie ihn Hans Emmenegger in seiner
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 071 - arpa Themen Projekte
und nachhaltig zu manifestieren und den Antrag der Entlebucher
zum Beschluss erheben: «dass alle zehn Aemter zusammenschwören
und in allen Dingen gemeinschaftlich handeln sollen.» Diesem Antrag
aber stimmte jedes einzelne der vielen Redner in der Umfrage gleich
entschlossen und begeistert zu — wenn dies auch manchem der anwesenden
Heissporne noch lange nicht genug war! Auch die immer
noch sehr «untertänige» Sprache des nun zur Verlesung gekommenen
Bundesbriefes mochte diesen nach allem Vorgefallenen durchaus
nicht gefallen. Aber Hans Emmeneggers — und wohl auch des Schulmeisters
— Diplomatie ging offensichtlich darauf aus, für die ganze
Bewegung die denkbar breiteste Basis zu schaffen. Dafür bedurften
sie unbedingt der möglichst einmütigen Zustimmung ihrer Geistlichkeit.
Zweifellos mit besonderer Rücksicht auf diesen taktisch äusserst
wichtigen Zweck hatten sie in den vorausgegangenen eifrigen Beratungen
mit allen Hauptführern der Bewegung sowohl den Inhalt des
Bundesbriefes auf das Notwendigste beschränkt, als auch seine
Sprache dem «schuldigen Respekt und Gehorsam» den Behörden
gegenüber weitgehendst angepasst.
Im übrigen waren ja sämtliche bisher von den einzelnen Aemtern
eingereichten Artikel, die die konkreten Forderungen der Bauern
der Aemter sowohl wie der Bürger der Stadt Willisau enthielten,
schon vor der Verlesung des Bundesbriefes zum einmütigen Beschluss
erhoben worden, und noch neue dazu. Sie sollten zusammen
mit dem Bundesbrief der Luzerner Regierung als eins und zusammengehörig
überreicht werden, und dies alles zusammen sollte als
Willensäusserung der Wolhuser Landsgemeinde der zehn Aemter
gelten. Gerade durch die Allgemeinheit der Formeln des nun beschworenen
Bundesbriefes aber waren sämtliche Forderungen der bereits
beschlossenen wie der noch zu beschliessenden Artikel in den
Schwur miteingeschlossen.
Wie vorherrschend aber für Hans Emmenegger die Rücksicht
auf die Zustimmung der Geistlichkeit war, geht aus Folgendem
hervor. Als der bisherige, fertig mitgebrachte und nur durch Einzelnes
während der Verhandlung selbst ergänzte Entwurf des Bundesbriefes
soeben zuende vorgelesen war und die ganze Landsgemeinde
nun in atemloser Spannung auf das Vorsprechen der Eidesformel
wartete, um zum Schwüre zu schreiten — da, im feierlichsten
Augenblick, unterbrach Hans Emmenegger den Gang der Dinge
und wandte sich, vor der ganzen Landsgemeinde als Zeugen, folgendermassen
an die gesamte anwesende Geistlichkeit: «Weil man aber
in einer so wichtigen und heiligen Sache nicht sicher genug gehen
könne, so wolle er die Hochwürdigen Seelsorger und Pfarrer, die
hier gegenwärtig seien, anfragen, ob die soeben geäusserten Meinungen
und Ansichten nicht irrig seien, und ob man mit gutem Gewissen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 072 - arpa Themen Projekte
bat er zuerst den Pfarrer und Kapitelsdekan Luthard und dann die
drei andern Pfarrgeistlichen, jeden einzeln darum, «dass sie ihre
Meinung hierüber frei eröffnen und mitteilen möchten». Der Pfarrherr
zu Ruswil und Wolhusen, Dekan des Kapitels zu Sursee und
apostolische Pronotar seiner Heiligkeit des Papstes, Herr Melchior
Lüthard, Stadtbürger von Luzern, antwortete: «Er könne einen Eid,
wie er, nach den geäusserten Ansichten, geschworen werden soll,
weder für unerlaubt und ungültig halten, noch finden, dass ein
solcher Eid wider Gott, oder wider die Gnädigen Herren und Obern
der Stadt Luzern, noch viel weniger wider ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten
oder wider den Eid wäre, den man einer Obrigkeit zu
schwören schuldig sei.» So nach dein Bericht des Geschichtsschreibers
und Domdekans Alois Vock, der noch hinzufügt: «Für diese Ansicht
des Dekans erklärten sich mit voller Zustimmung auch die
Pfarrer von Hasle, Romoos und Dopplischwand.»
Damit aber hatten diese geistlichen Herren, trotz der Sanftmut
ihrer Sprache — und auch der Sprache des Bundesbriefes —, eben
doch das Aufstandsrecht des Volkes gegen seine Bedrücker heilig gesprochen!
Denn dass der Protonotar des Papstes sich der Tragweite
des ganzen Vorgehens der Bauern, dessen Zeuge er war, nicht bewusst
gewesen sei, wird man mit Fug nicht annehmen dürfen. Eher
ist anzunehmen, dass Herr Melchior Luthard von der Gesinnung des
Papstes, der ihn ernannt hatte, unterrichtet war, der als Ausnahme
unter den Päpsten dieses Jahrhunderts, wie Ranke berichtet, «keine
Misshandlungen der Unteren von den Oberen, der Schwachen von
den Mächtigen zugelassen» habe. Hans Emmeneggers und seiner
Bundesgenossen Diplomatie aber hatte es erreicht, dass ihr Vorgehen
von der Geistlichkeit von nun ab nie mehr desavouiert werden konnte.
Ja, noch mehr: sie stellten sofort den Antrag, dass dieses «Votum
der Geistlichkeit über die Gültigkeit des Bundes» der vorgelesenen
Bundesurkunde eingefügt werden solle. Was einmütig gutgeheissen
und unverzüglich ausgeführt wurde, ohne dass auch dagegen die
Geistlichkeit das geringste Bedenken erhob.
Nachdem nun Hans Emmenegger ausserdem folgende Anrede an
Alle gehalten hatte: «Falls dann jemand zugegen wäre, dem sein Gewissen
nicht erlaube, das Vorgelesene mit einem Eid anzugeloben,
der solle nicht schwören, sondern sich aus der Kirche entfernen; es
werde ihm deswegen kein Leid geschehen, noch er sich deswegen zu
entgelten haben» — da war es auch für den Schwankendsten in der
Kirche eine beschlossene Sache, den Eid zu leisten. Keiner trat weg,
alle schworen. Und zwar auf den nachfolgenden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 073 - arpa Themen Projekte
«Bundesbrief
der X Aemter der Stadt Luzern,
zu Wollhausen aufgerichtet und beschworen
am 26. Hornung 1653:
Wir, der Landespannerherr Johann Emmenegger, Landeshauptmann
Nikolaus Glanzmann, Amtsfähndrich Nikolaus Portmann, samt
den vierzig Geschworenen insgemein, wie auch die ehrsamen biderben
Gemeinden des löblichen Landes Entlebuch thun kund und bekennen
öffentlich mit diesem Bundesbrief, was Gestalt und Ursach dieser ist
aufgerichtet worden.
Weil wir alle zwei Jahre einem Herrn Landvogt, im Namen unserer
gnädigen Herrn und Obern von Luzern, zu schwören und zu huldigen
verbunden und schuldig sind, wie dies denn auch fleissig geschah,
so ist nun aber zu wissen, dass wir aus dem ganzen Lande Entlebuch
in der Gestalt schuldig sind zu schwören, dass wir unsern gnädigen
Herrn von Luzern sollen unterthänig und gehorsam sein, ihrer
Stadt Nutzen zu fördern, und, was ihnen schädlich wäre, zu wenden,
in gleichen, was ungebührliches und strafwürdiges wäre, einem Herrn
Landvogt zu leiden schuldig sind; was alles treulich und ohne Gefährde
geschehen ist. Eben mässig soll ein Herr Landvogt schwören:
sowohl des Landes als der Stadt Schaden zu wenden, und ihren Nutzen
zu fördern, den Reichen wie den Armen zu richten, sie auch bei
ihren alten Freiheiten und Gerechtigkeiten, laut Brief und Siegel, und
bei sonst alten, guten Gewohnheiten und Bräuchen verbleiben zu lassen.
Wie sie dies gegen uns halten, ist offenbar in den Artikeln und Klagpunkten,
so wir auf das Papier gesetzt, und unsern Herren und Obern
vorgehalten haben, dass ja die Herrn Landvögte demselbigen nicht allein
nicht nachkommen, sondern wir von einem Jahre zum andern mit neuen
Aufsätzen, Beschwerden und ungebührlichen Strafen belästigt worden.
Dieser Ursachen willen wir uns oft und vielmal bei unsern gnädigen
Herrn und Obern der Stadt Luzern beklagten und beklagen wollen.
Wir konnten aber nicht nur nicht erhalten, dass man uns zu unserm
Rechte verhelfen wolle, sondern sobald man kam und sich beklagte.
wurde man mit scharfen Worten und Zwingen (Drohungen), auch oft
mit trotzigen Reden und Schandworten abgeputzt. Hat man sich damit
abweisen lassen, so ist es Nutz gewesen; wo nicht, und hat man
weiter angehalten, so ist mit Kopfabhauen oder sonst mit Strafen gedroht
worden, dass hiemit Männiglich sich nicht dawider lehnen oder
auslassen durfte, dass er sich weiter oder anderswo beklagen oder
Rath suchen wolle. Derwegen haben wir Uns geweigert, solche Beschwerden
weiter zu gedulden, uns unterstanden, mit Gottes und Mariä
Hilfe sammt der Fürbitte und Hülfe aller lieben Heiligen, auch aller
aufrechten, redlichen und biedern Leute, uns selbst zu unsern alten
Rechten, laut Brief und Siegel, wieder zu helfen, und wir vertrösten
uns, alle neuen Aufsätze und Beschwerden durch dieses Mittel abzuthun
und abzustellen. Nachdem nun vielen Mitlandleuten und Nachbarn
offenbar geworden, wie und was Gestalten der Spann zwischen
unsern gnädigen Herrn und Obern von Luzern und uns ist, und aus
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 074 - arpa Themen Projekte
freien Grafschaft Willisau einhellig nicht lang besonnen, sondern zu
uns, denen aus dem Entlebuch, gesetzt und geschworen, und uns das
zugeschrieben, davon wir nichts gewusst haben, weil sie mit eben den
gleichen Beschwerden, und viel mehr, behaftet waren. Nachdem ingleichen,
ohne unser Begehren und Wissen, zu uns geschworen die
Herren der Grafschaft Rothenburg und auch die von Russwyl, und
weil wir obengenannte vier Aemter uns nicht besser besprechen mochten,
um unsere Beschwerden einander zu erklären, so haben wir einen
Ort und Tag gesetzt, nach Wolhusen zusammen zu kommen. Allda
haben wir unsere Klagen öffentlich und vor einer ganzen Gemeinde
geoffenbart, wie und was unsere Meinung sei, nämlich: gar nichts anderes,
denn allein, dass wir unsere Obrigkeit von Luzern bitten und
anhalten wollen, dass sie alle neuen Aufsätze und Beschwerden gänzlich
wieder ab uns nehmen und abthun, und uns unsere alte Freiheit,
alte Rechte und Gebräuche und gute Gewohnheiten, laut Brief
und Siegel, wieder brauchen lassen solle. Und weil uns wohl bewusst
ist, dass sie uns solches nicht leicht gestatten und geben werde, so
haben die vier Aemter gut, nützlich und recht befunden, dass sie sich,
der Ursache halb, mit einander verbinden und einen Eid zusammen
schwören sollen, dieweil, wenn früher ein Amt allein unsere Obrigkeit
gebeten und angehalten hat, solche ihre neuen Aufsätze ihm gnädiglich
abzunehmen, dasselbe, wie obgemeldet, viel und oftmal abgedreht
und abgewiesen wurde. Da nun alle zehn Aemter desto eher und beherzter
fürderhin vor ihre Obrigkeit kommen dürfen, wenn sie Ursache
haben, vor derselben zu klagen, und sie zu bitten, dass sie uns bei
unsern Freiheiten, Brief und Siegeln verbleiben lassen solle, so wollen
wir fortan in Ewigkeit zusammenhalten mit Leib und Ehre, Gut und
Blut, und, so weit unser Vermögen sein wird, ein Amt gegen das andere
leisten und thun. Es ist aber, ehe und bevor wir zusammen geschworen
haben, voraus und klar ausgenommen und vorbehalten
worden, dass dieser Eid und Bund unsern Gnädigen Herrn und Obern
zu Luzern ganz in keinen Weg etwas schaden solle. Wir wollen sie
auch fürbas und in Ewigkeit für unsere getreuen Herrn und Obern
haben und erkennen, soweit ihre Briefe und Siegel, Rechte und Gerechtigkeiten
erfordern, und wir schuldig wären, uns ihnen jederzeit
unterthänig, willig und gehorsam und fast gern einstellen. Hingegen
aber begehren wir von unsern gnädigen Herrn und Obern. dass sie
uns ingleichen bei unsern Briefen und Siegeln, Rechten und alten Gewohnheiten
verbleiben lassen, alle die neuen Aufsätze und ungebührlichen
Sachen und Beschwerden uns jetzt zu diesen Zeiten nehmen, und
fürderhin zu allen Zeiten nicht weiter damit beschweren, sondern, was
gebührlich, bescheiden und der Billigkeit gemäss ist, halten sollen. Solchem
allem zuvor zu kommen, und solches unsern Nachkommen zu erhalten,
haben wir, die vier Aemter, für gut befunden und angesehen, uns
mit diesem Eidschwur und Bündnisse zu verbinden, ewiglich einander
Treue, Liebe und Hilfe zu leisten, wie uns, als rechten, redlichen Bundesgenossen
geziemt und gebührt, ja in dem allein, was recht, billig und
gebührlich ist und sein wird. Denn kein Amt hat sich verbunden und
geschworen, zu Unbilligem, Ungerechtem und Ungebührlichem zu
helfen. Denn dass einem Amte das andere oder mehrere helfen, ist
gründlich vorbehalten worden. Wenn also einem Amte oder mehreren
weiter in künftigen Zeiten Neuerungen und ungebührliche Beschwerden
von unsern gnädigen Herrn und Obern kommen möchten, so
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 075 - arpa Themen Projekte
sie einander eine Obrigkeit unterthänig und freundlich bitten helfen,
sie solcher Beschwerden zu entlasten. Und wie nun obgedachte, gute
und billige Meinung, samt den Artikeln, einer ganzen Gemeinde und
den Ausgeschossenen aus den hienach benannten Aemtern ist öffentlich
vorgehalten worden, so haben sie sich ebenfalls und gleichmässig
mit mit den vier obgenannten Aemtern einhellig zu diesem Eidschwur
verbunden, nämlich: Kel-Amt (St. Michelsamt) Münster, ausgenommen
das Dorf Münster, das Amt Büron und Triengen, das Amt Malters,
das Amt Kriens und Horw, das Amt Ebikon, und das Amt Knutwyl,
dass also aus den vier Aemtern zehn geworden sind. Darum sollen
alle Artikel und Klagpunkte eines jeden besondern Amtes allzeit von
den übrigen neun Aemtern, von einem Artikel zum andern, durchgesehen,
corrigiert und der Billigkeit gemäss gestellt werden, und zwar
durch die von den Aemtern dazu ausgeschossenen Personen, damit,
wenn es vor die rechten Richter und die hohe Gewalt, laut eidgenössischer
Bundesordnung, kommen würde, man sich über die Aemter
nicht zu beschweren hätte, dass sie etwas unrechtes oder ungebührliches
begehrt haben, oder begehren wollen; und ebenso soll ein Amt
dem andern helfen, seine Klagen, wozu ein jedes sein billiges Recht
haben würde, zu erlangen, und kein Amt soll, ohne des andern Wissen
und Willen, den Beschluss mit der Obrigkeit völlig machen, bis alle
Aemter und ein jedes insbesondere, auch zufrieden sein können mit
dem, was ihnen billig und recht gehören würde. Auch ist klar und genugsam
vorgehalten worden, dass Jeder wohl bedenken solle, was er
schwöre; denn man wolle Niemand dazu zwingen, sondern, welcher
nicht zu schwören vermeinte, der soll aus der Kirche gehen. Dem soll
darnach kein Leid darum geschehen und er dessen nicht zu entgelten
haben. Und nach solchem, bevor man schwor, hatte der Landespannermeister
aus dem Entlebuch die Wohlehrwürdigen, geistlichen,
hoch- und wohlgelehrten Herren angefragt, was sie nun zu diesem
sagen würden? ob man schwören solle oder nicht? ob sie (die Landleute)
recht daran seien oder nicht? und er hatte sie gebeten. sie sollen
ihre Meinung auch dazu geben. Da antwortete der Wohlehrwürdige
hoch- und wohlgelehrte Herr Pfarrer zu Russwill und Wollhausen, als
Dekan des löblichen Kapitels von Sursee. auch erst neuerwählter Protonotarius
des Römischen Stuhls, ,dass ja obgemeldete Meinung nicht
könne für ungut oder ungültig gemacht werden, dieweil sie nicht
wider Gott, auch nicht wider Unsere Gnädigen Herren und Obern der
Stadt Luzern sei, noch weniger wider ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten,
auch nicht wider den Eid, den man einer Obrigkeit zu schwören
schuldig ist'. Bis hierher Herr Melchior Luthard. Hernach wurden
auch gefragt die Wohlehrwürdigen Herren Pfarrherren, als Herr Johannes
Gerber zu Hasle im Entlebuch, Herr Hans Heinrich Sidler zu
Romoos im Entlebuch, und Herr Leodegar Bürgi, Pfarrer zu Dopplischwand,
welche ganz der obgenannten Meinung des Herrn Dekans
waren. Und darum so haben die obbenannten X Aemter die Hände
aufgehoben, und, dass sie das, wie obgemeldet, ewig steif und stets
halten wollen und sollen, einen Eid zu Gott und allen Heiligen geschworen,
welche auch dazu helfen wollen! Nun aber ist von den X
Aemtern eigentlich und klar, als der ihnen angelegenste Punkt, in den
obbemeldeten Eid zugeschlossen worden, dass, wenn die Sachen wieder
zu einem Ende gelangen würden, sie keinen einzigen Menschen
dess weder über kurz noch über lang entgelten lassen, auch diejenigen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 076 - arpa Themen Projekte
und Obern anhingen und vorbehalten sollen. Und eben so, was sie, die
von der Stadt, gegen uns geredt, gethan, und was von beiden Partheien
dieses Streites und Aufstands geschehen ist, soll auch vergessen, vergraben
sein, und Niemand sich dessen entgelten, sondern immer und
ewig vergessen werden, damit, wenn einmal wieder die Vereinbarung
geschehen und gemacht würde, nicht etwa durch solche Zuwiderhandlung,
um wegen dieser Sachen abzustrafen, ein neuer Rumor und Uneinigkeit
entstehen möchte; denn ein jeder insbesondere bei gethanem
Eide verbunden und schuldig wäre und sein solle, dessen nicht das
Geringste zuzulassen, sondern es nach seinem Vermögen zu rächen,
wobei aber klar verstanden sein solle, dass nichts weiter, als vom Anfange
des Aufstands und Handels bis zum Ende der Vereinbarung, eingeschlossen
sein und verbleiben solle. Wenn aber hernach einer oder
der andere fehlbar und unbehutsam erfunden würde, so wird unsern
Gnädigen Herren Obern heimgestellt werden, was sie über einen solchen
vornehmen wollen, wie es einer hohen Obrigkeit heimgestellt ist
und gebührt. Doch solchen soll ebenmässig wegen des einbeschlossenen
Handels was solche darin geredet und gethan haben möchten,
nicht dazu gerechnet werden, und man nicht vermeinen, sie desto eher
zu bestrafen, sondern alles soll, wie obgemeldet, zu beiden Partheien
lobt und begraben sein.
|
Gegeben zu Wollhausen den 26. Hornung 1653.» |
Als die Ausgeschossenen der zehn Aemter und mit ihnen die gesamte
Landsgemeinde die Eidesformel, die ihnen Hans Emmenegger
versprach, Wort für Wort nachgesprochen und den Schwur geleistet
hatten, wich die grosse Spannung von der Versammlung, die sie wie
eine übermächtige Faust gepackt und geeinigt hatte. Da liessen sich
die revolutionären Kräfte nicht länger zurückbinden. Sie schossen
unter «wütendem Geschrei» vor und verlangten von der Landsgemeinde
sofortigen Aufbruch zur Tat. An ihrer Spitze standen die
Willisauer, zum guten Teil Stadtbürger, unter Führung Peyers und
Stürmlis, sowie die Rothenburger, unter Führung Kaspar Steiners.
Sie schrieen: «man solle jetzt die Obrigkeit bezwingen, gegen die
Stadt ziehen, Sursee und Sempach (die beide in luzernischer Militärgewalt
waren) überrumpeln, um Munition zu erhalten und Geschütze»;
auch wollten die Rothenburger, dass man ihrem Pannerherrn in
Nunnwil, der nicht mitziehen wolle, «das Panner der Grafschaft Rothenburg
wegnehme». Und bezeichnenderweise kam ebenfalls erst auf
den erregten Wogen dieser zweiten Umfrage, nach dem geleisteten
Schwur, die Tatsache zu Tage, dass ein Verräter unter den Entlebucher
Geschworenen sein müsse. Der Antrag nämlich wurde gestellt
und beschlossen: «Die hochweise Obrigkeit von Luzern soll den Verräter
nennen, der unter den vierzig Geschworenen von Entlebuch sich
befinden muss»!
Das bei weitem Wichtigste aber war das Verlangen der Willisauer,
die Hand unverzüglich auf die erreichbaren militärischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 077 - arpa Themen Projekte
Bauern- wie der Bürgersache das taktisch Richtige gewesen, und
zweifellos hätten sie dieses Ziel in dem gegebenen Zeitpunkt auch
erreicht. Denn noch war das schwach gerüstete Luzern gegen die
Tausende und Abertausende von Knüttelmännern ohnmächtig; aber
nur noch für wenige Tage, bis der Zuzug modern gerüsteter Truppen
von auswärts die Stadt erreichte. Dass ,die Mehrheit der Bauern gegen
die sofortige «Machtergreifung» war, die nur von den bürgerlicheren
Willisauern und dem sehr wenig bäuerlichen Kaspar Steiner und von
diesem vielleicht aus provokatorischen Gründen befürwortet wurde,
das haben die Bauern erst sehr viel später bereut: als sie zum Teil
mit selbstgemachten hölzernen Kanonen gegen die damals modernste
Artillerie des Zürcher Generals Werdmüller ins Feld rücken mussten...
Die «Majorität der Anwesenden» aber war, wie gesagt, dafür,
«man solle die Konzessionen auf dem Wege des Bittens und Begehrens
zu erreichen versuchen», den die Rede Hans Emmeneggers und
der Tenor des Bundesbriefs gewiesen habe. Damit hat Hans Emmeneggers
Diplomatie die erfolgreiche Konzession, die sie zur Gewinnung
der Geistlichkeit gemacht hatte, vielleicht doch zu teuer bezahlt.
Dies umsomehr, als die Bauern fortan die «untertänig» tuende
Taktik Hans Emmeneggers und des Wolhuser Bundesbriefs während
des ganzen Aufstandes in allen Vorträgen, öffentlichen Akten
und Bundesbriefen» hartnäckig bis zur Selbstaufgabe beibehielten.
«Immer», sagt Vock, «versicherten sie zuerst die Obrigkeit des Respekts
und Gehorsams und erklärten hierauf, was sie wollen und beschlossen
haben.» Zu Unrecht aber hat dieser wohlwollende Geschichtsschreiber
diese Taktik der Bauern mit derjenigen des Cromwell'schen
Rumpfparlamentes verglichen, das den «absoluten» Herrn
der Engländer, den «souveränen» König Karl I., vier Jahre zuvor,
anno Neunundvierzig, «unter vielen Respektsversicherungen auf's
Schaffett schickte». Das mag ja der Stil der Zeit gewesen sein. Dennoch
hatte auch der bäuerliche Cromwell nicht unterlassen, sich
längst zuvor in den Besitz der besseren Kanonen zu setzen! Sonst
wäre er aufs Schafott gewandert, und das noch ohne alle Respektsversicherungen
— genau so, wie es unsern guten Luzerner Bauern,
und auch den andern, die nun bald zu ihnen stiessen, zu leiden bestimmt
war...
Jetzt aber waren sie noch für lange Zeit im Festtaumel ihres
Richtfestes, durch das sie sich ihr «gutes Recht» bereits verschafft zu
haben glaubten. Das einzige Wehrhafte, was sie in Wolhusen beschlossen,
war: «In allen Aemtern soll fleissig Wache gehalten werden»;
und auch dies glaubten sie noch mit der Entschuldigung tarnen
zu müssen: «damit keine Ungelegenheiten von bösen Leuten, Landstreichern
und Speyvögeln (Spionen und Provokateuren) mit Feuer
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 078 - arpa Themen Projekte
agitieren können». Sonst aber strömten sie völlig fried- und
freudetrunken wieder auseinander und trugen die «gute Botschaft
vom Wolhuser Bund» in den hintersten Winkel ihres schönen Landes.
Nur die meisten Führer blieben noch den ganzen andern Tag zu
Beratungen in Wolhusen.
Mit der singend, juchzend und musizierend heimströmenden
Menge zogen, vom selben Taumel ergriffen, die Emmentaler, Oberaargauer
und Solothurner Bauern und trugen die gute Botschaft über
die Landesgrenzen hinaus. Denn sie hatten sich in Wolhusen Abschriften
vom Bundesbrief geben lassen, um «damit für die Sache
der Bauern zu Hause, in Huttwil, im Emmen- und Simmentale zu
agitieren». Darunter war auch der Christian Blaser aus dem Emmental,
«der den ersten Prügel aus dem Emmental ins Entlebuch getragen»
hatte und der dafür später hingerichtet wurde. Darunter
war auch der Kirchmeier von Huttwil, Ulrich Brechbühler von Nyffel,
der später im Gefecht von Herzogenbuchsee für die Bauern'-
sache fiel. Da waren auch noch zwei weitere Huttwiler, der Wirt.
Melchior Käser und Andreas Nyffenegger; dann der Weibel Hans
Weyermann von Gondiswil und Jakob Müller von Rohrbach. Und
viele andere, die kein Bericht bei Namen nennt. Sie sind die ersten
Vorboten der nun auch im Bernerland langsam, aber von Grund auf
in Gang kommenden Revolution.
Kein Wunder, dass die Berner Regierung bereits am Siebenundzwanzigsten
nicht nur auf ihre eigenen Untertanen, die mit den
Luzernern sich verschworen, fahndete, sondern auch «auf zwölf gutgekleidete
Entlebucher, welche die Aufwiegelung des Berner Landvolkes
betrieben»; und dass sie durch «einflussreiche Ratsherren» in
eigener Person «den Markt von Langnau überwachen» liess, darunter
den Venner Samuel Frisching, «den man unter dem, Vorwande von
Privatgeschäften nach Langnau, wo er ein Gut besass, zum Aus.
spähen geschickt hatte». Denn schon am Tag nach der Stiftung des
Wolhuser Bundes hatte dessen nunmehriger «Ratschreiber» Johann
Jakob Müller auch eigene Boten mit anfeuernden Sendschreiben aus
dem Entlebuch ins Bernische abgeschickt, darunter sogar den Landesfähnrich,
der dabei jedoch im hohen Schnee auf den Grenzbergen
beinahe umgekommen wäre. Der Schulmeister Müller berief sich in
diesen Schreiben zur Gewinnung der Berner weniger auf die Religion,
die sie trennte, als auf das Rechtsgefühl, das sie einte. Die Luzerner
Bauern, so meinte er, hofften, man werde das Sprichwort an ihnen,
den Bernern, nicht brechen, «wie vor altem gesagt worden, dass, so
(selbst) ein Türk über Meer herkäme und Rechts begehrte, er solches
bei den Eidgenossen finden würde».
Es fragt sich nur, bei welchen Eidgenossen! Denn der Rat von
Bern «erkannte (auch seinerseits) bereits am 27. Februar, es könnte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 079 - arpa Themen Projekte
lieben Vaterlande ein böses Feuer angezündet werden»!
Da muss es sich offensichtlich um zwei «Vaterländer» gehandelt
haben...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 080 - arpa Themen Projekte
Kaspar Steiner
"Oberst" der Rothenburger Bauerntruppen, bald Kapitulant,
bald Scharfmacher in den Verhandlungen mit den Herren
(Jesuitenzögling).
Nach einem zeitgenössischen Originalstich in der Landesbibliothek
in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 080 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 081 - arpa Themen Projekte
VI.
Die «Katz im Sack» —
und wie die Bauern sie «verzappeln» liessen
Schon am siebenundzwanzigsten Februar, als die meisten
Bauernführer sich noch in Wolhusen berieten, traf Kasper Steiner,
ohne von ihnen Auftrag zu haben, in Malters mit Abgeordneten der
vier alten Orte Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug zusammen. Diese
nämlich waren, auf den Ruf der Luzerner Regierung, bereits am
Aschermittwoch nach Luzern geeilt, zur gleichen Zeit, als die Bauern
in Wolhusen zusammenströmten. Sie kamen als «eidgenössische
Ehrengesandte», das heisst als «Vermittler» zwischen den Bauern und
den Luzerner Herren. Aber immer sassen sie mit den Herren zusammen,
immer führten sie nur deren Instruktionen aus.
So zweifellos auch bei der Zusammenkunft mit Kaspar Steiner.
Noch eben, am Sechsundzwanzigsten hatten sie mit den Luzerner
Herren zusammen beschlossen, den ganzen Apparat der Eidgenossenschaft
aufzubieten, um des Aufruhrs Herr zu werden, nicht nur,
wie bisher, die katholischen Orte und die beiden Stände Zürich
und Bern. Diese hatten übrigens ihre Hülfe unverzüglich zugesagt,
und von Solothurn und Freiburg waren ebenfalls bereits «Ehrengesandte»
als «Vermittler», das heisst als Verstärkung der Herrenposition
der Luzerner Regierung, in Luzern eingetroffen. Alle diese
Herren nun hatten das äusserste Interesse daran, Zeit zu gewinnen.
Denn bis der von ihnen aufgebotene Apparat in nützliche Bewegung
kam, das heisst, bis man die Luzerner Bauern von allen Seiten «eidgenössisch»,
diplomatisch und militärisch, eingekreist haben würde,
konnten viele Wochen vergehen. Also hiess es, die Bauern inzwischen
mit allen Mitteln der Ueberredung, des Schöntuns, des scheinbaren
Entgegenkommens — nur unter eifersüchtiger Vermeidung nicht
wieder gut zu machender Preisgaben des Herrenprinzips, des Gottesgnadentums
der «Souveränität» — hinzuhalten, zu vertrösten, zu «befrieden»,
das heisst sie möglichst zu zersetzen, zu korrumpieren, sie
auf diesem «gütlichen» Wege zur Selbstentwaffnung zu bringen und
sie so am entscheidenden Handeln zu hindern. Das erste Glied in
dieser Kette war die Unterredung zwischen den «Vermittlern» und
dem Jesuitenzögling und «Diplomaten» Kaspar Steiner.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 082 - arpa Themen Projekte
Zwar auf den ersten Versuch der «Vermittler», mit Kaspar
Steiner zu einer — dem eben beschworenen Bundesbrief schnurstracks
zuwiderlaufenden — Sonderverhandlung für sein Amt, das
Amt Rothenburg, zu kommen, gab er «eine ausweichende Antwort».
Für ihr Prinzip des Zeitgewinnens aber haben sie Kaspar Steiner
ganz offensichtlich gewonnen! Ob er es wusste und wollte oder nicht,
so hat er doch nur das Geschäft der Herren besorgt, als er noch am
selben Tage an den Landespannermeister Hans Emmenegger schrieb,
«man solle ja nicht mit einem Vergleiche mit dem Rate von Luzern
eilen, denn man müsse noch vielerlei hervorsuchen und vorher mündlich
besprechen». Während noch am Tag zuvor in Wolhusen einmütig
beschlossen worden war, «der Rat von Luzern sei anzuhalten,
sofort die Verhandlungen zu eröffnen». Damit hat Kaspar Steiner den
gutgläubigen Hans Emmenegger zum Zögern veranlasst, ihn zudem
in seinem edlen Wahn von der erlösenden Kraft alter Papiere bestärkt
und so seinen Willen von der Tat abgelenkt. Er hat ihn aber
noch dazu in falsche Sicherheit gewiegt, als er seinen Brief in dem
Satze gipfeln liess: «Wir haben allbereits die Katz im Sack, wir wollen
sie ein wenig lassen verzappeln»!
In der Tat haben in den nächsten Tagen die Bauernführer viel
kostbare Zeit damit verloren, «durch urkundliche Beweise ihre alten
Rechte und Freiheiten darzutun». Der Luzerner Rat, den Zeitgewinn
erkennend, der für ihn daraus erschiessen konnte, legte den Bauern
noch ausdrücklich diesen Köder aus, indem er noch am selben Tage, da
die «Vermittler» vor den Toren der Stadt mit Kaspar Steiner verhandelten,
mit diesen zusammen «die alten Urkunden über die Erwerbung der
Vogteien Entlebuch und Willisau verlas» und den Beschluss zu Einzelverhandlungen
mit den Aemtern (auf der Basis dieser Urkunden)
«durch die Standesweibel von Schwyz, Zug und Luzern den noch in
Wolhusen versammelten Führern der Bauern» zustellte. Und gerade
die Rothenburger —Kaspar Steiners Amtsgenossen, wenn auch sicher
nicht die revolutionärsten unter ihnen — waren es, die sogar umständlich
eine eigene Deputation ausschossen und sie zum Burgerrat
von Zug schickten, um «über die ihr Amt betreffenden Rechte, die
in Zug liegen sollen», Auskunft zu begehren. Sie erhielten dort am
1. März den Bescheid: «man wisse nicht so viel von ihren Freiheiten
und Rechten, dass man darüber nachschlagen könne»! Im übrigen
sei «die Behandlung dieser Angelegenheit... den Ehrengesandten
übertragen worden».
Auch an die Entlebucher haben die «Vermittler» der vier alten Orte
sich sofort nach der Heimkehr der Bauernführer von Wolhusen herangemacht,
um sie zu Sonderverhandlungen, das heisst zum Bruch
des eben beschworenen Bundes, zu verführen. Ein Hans Emmenegger
gab jedoch keine bloss «ausweichende Antwort», sondern schrieb
prompt zurück, dass für einen solchen Fall «die Aemter zuerst untereinander
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 083 - arpa Themen Projekte
Brief die eine Scharte zum Vorschein, in die Kaspar Steiner gehauen
hatte: «Vor allem aber», meint Hans Emmenegger, «müsse Luzern
dem Lande Entlebuch die verlangten Urkunden ausliefern». Immer
diese Verhandlungen über die «Urkunden»! Statt sie mit Heeresmacht
in Luzern selber zu holen, solange man dazu noch in der Lage war!
Am kraftvollsten lehnten wiederum die Willisauer den Einbruchsversuch
des Feindes ab. Sie schrieben auf die Zumutung von
Sonderverhandlungen: sie seien zwar bereit, Verhandlungen in Willisau
beizuwohnen — aber nur «sofern der Rat von Luzern alle zehn
Aemter nach Willisau einlade»! Als sie daraufhin die Entlebucher anfragten,
ob diese zu solchen eventuellen Verhandlungen geneigt wären,
bekamen sie die enttäuschende Antwort: «man wolle nicht eilen, sondern
8-10 Tage hinhalten und inzwischen die Stimmung in den ,Ländern'
erforschen». Das war die andere Scharte, in die Kaspar Steiner
gehauen hatte...
Dies alles, und noch manches Aehnliche, geschah bereits in den
ersten drei Tagen nach dem Richtfest des Aufruhrs. Und zwar war
es nicht zufällig, dass alle Versuche der «Vermittler», die einzelnen
Aemter, Gerichte und Gemeinden zu Sonderverhandlungen zu bewegen,
diese auf den anschliessenden Sonntag, den 2. März festzulegen
versuchten. Das war vielmehr ein mit den Luzerner Herren verabredeter
Schachzug in ihrem Sabotageplan am Wolhuserbund, einem
Plan, der mit beinahe bewundernswerter «Schlagartigkeit» einsetzte
und nun zäh und zielbewusst durchgeführt wurde.
Es scheint nämlich, dass der Schulmeister Johann Jakob Müller
sich unter dem Eindruck der energischen Politik der Willisauer in
Wolhusen dazu entschloss, dem «Urkunden»-Wahn den Rücken zu
kehren und zur Tat zu schreiten. Dafür sprechen schon seine sofortige
Rückkehr nach Schüpfheim und seine bereits tags darauf von dort
nach dem Bernerland ausgesandten Missionen, die die Berner Bauern
zu schleunigster Hülfeleistung anfeuern sollten. «Lehrer Müller wollte
an vier bis fünf Punkten rasch angreifen und am 8. März die Belagerung
von Luzern eröffnen. Um das Volk zu diesem Plane zu begeistern,
hatte der Amtsweibel von Münster die Rothenburger nach Ruswil
eingeladen; es sollte eine Prozession nach Germund stattfinden;
Entlebuch, Willisau und Ruswil sollten nach Werthenstein wallfahrten.»
Diese «Prozessionen von einem Amt ins andere» sollten ganz
offensichtlich den aggressiveren Geist der Willisauer, der auf dem
Tag zu Wolhusen unterlegen war, im ganzen Lande ausbreiten und
das Volk zum Sturm auf Luzern reif machen. Und alle diese «Prozessionen»
waren bereits auf den folgenden Sonntag, den 2. März, angesetzt.
Darum die fieberhafte Anstrengung der «Vermittler», ihre
spalterischen Sonderverhandlungen im ganzen Land just auf diesen
Tag anzusetzen.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 084 - arpa Themen Projekte
Das nämlich war von ihnen in einer «Sitzung der geheimen
Kriegsräte» am 28. Februar, «zu welcher auch die Gesandten von Uri,
Schwyz, Ob- und Nidwalden und Zug beigezogen waren», mit den
Luzerner Herren ausdrücklich abgekartet worden. Waren sie doch auf
dieser Sitzung betreffend die Verhandlungen mit den Bauern ausser.
dem instruiert worden: 1. (dies um Zeit zu gewinnen) «Die Begehren
sollen in eine bessere Form gebracht und moderiert werden, da sonst
die Vermittlung unmöglich wäre»; 2. «Die Waffen sollen niedergelegt»
und 3. «Die Wachen aufgehoben werden». Während gerade auf
diesem Kriegsrat die Rüstung der Stadt aufs Höchstmögliche gebracht
und beschlossen wurde, ausser den bereits aufgebotenen und bereitgestellten
Truppen in Luzern selbst, sowie in den «vermittelnden»
Urkantonen, «im Geheimen» sich nach fremden «Soldtruppen» (!) umzusehen
und etwa «400 bis 600 Mann aus der Grafschaft Baden» (d. h.
aus einem von den «acht alten Orten» gemeinsam bevogteten Untertanenland!)
«oder anderwärts her, ohne Aufsehen zu erwecken, heranzuziehen».
Dies alles in Gegenwart der «unparteiischen» Vermittler!
Doch damit nicht genug: derselbe Luzernische Kriegsrat gab ihnen
noch die ausdrückliche Instruktion mit auf den Weg: «Sollten die
Verhandlungen nicht zum erwünschten Ziele führen, so sollen die
Vermittler bei Tag und Nacht so schnell wie möglich dem Kriegsrate
Bericht erstatten, damit die Stadt ,in omne eventum' (d. h. für jedes
eintretende Ereignis) gerüstet sei»! Damit ist eindeutig klargestellt,
was diese angeblich «neutralen Schiedsrichter» waren: nichts anderes
als politische Werkzeuge der einen, der Herrenpartei, ja militärische
Spione des Kriegsrats der «souveränen» Aristokratie von Luzern!
Damit ist auch klargestellt, in welch verhängnisvolle Illusion die
Bauernführer verstrickt waren, wenn sie sich von ihrer Vorliebe für
die «guten, alten Zeiten» so weit narren liessen, dass sie die alten
«Landsgemeinde-Kantone» noch jetzt für das Urbild der reinen Demokratie
hielten, für das sie blind schwärmten und das ihnen als
Ideal vorschwebte für alles, was sie in ihrer jetzigen Revolution zu
erreichen hoffen durften. Hätten sie nur die Augen aufgerissen, dann
hätten sie sehen müssen, wer da als Vertreter der urschweizerischen
«Demokratie» vor ihnen stand: das waren nicht — oder nur in ganz
nebensächlichen Figuren —wirkliche Volksvertreter, das waren genau
so grossmächtige junkerliche Herren wie die in Luzern! Und sie
waren von ihren Herren, nicht vom Volk geschickt worden. Denn
auch in den Urkantonen waren alle einträglichen Aemter längst in den
mehr oder weniger erblichen Besitz «regierungsfähiger» Aristokratengeschlechter
gelangt; die «Landsgemeinde» aber war dort längst zu
einer Farce, zu einem spanischen Schirm geworden, hinter dessen
schönem Helgeli-Theater die Herren umso unbekümmerter ihre blutbefleckten
Söldnergeschäfte mit den fremden Fürsten besorgen konnten,
als dies auf dem «demokratisch» hingestreckten Buckel eines
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 085 - arpa Themen Projekte
stolz für «eidgenössische» Geradheit zu halten.
Nur zwei, drei der tätigsten und wichtigsten von den überaus
zahlreich erschienenen «Ehrengesandten » der vier alten Orte seien
hier bereits mit Namen genannt. Da sind vor allem der Urner Landeshauptmann
Oberst Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach und der
Zuger Landammann und Landschreiber Beat Jakob zur Lauben zu
erwähnen. Diese beiden «neutralischen Schidherren» und «Ehrengesandten»
haben sich als «Vermittler» derart um die Sache der Luzerner
Aristokraten verdient gemacht, dass ihnen der Rat zum Dank
dafür noch im selben Jahr mit vollendeter Courtoisie das Bürgerrecht
der Stadt Luzern, mit allen damals damit verbundenen Vorrechten
des Patriziats, für sie und ihre Nachkommen schenkte und ihnen
ausserdem Tausende von Gulden — wie übrigens auch den anderen
«Vermittlern» — als «Ehrengeschenke» nachwarf. Nur einer bekam
nichts, wurde vielmehr als «gefährlicher Demagog» und «Händelstifter»
von allen Herrenchronisten bis auf den heutigen Tag verschrieen:
der Zuger Landammann Peter Trinkler von Menzingen, der
unter dem Druck einer bauernfreundlichen Minderheit des Zuger
Rates der übrigen Herrengesandtschaft dieses Standes noch nachträglich
beigeordnet werden musste und der als einziger den Mut
aufbrachte, sich für die gerechten Forderungen der Bauern einzusetzen
und sie gegen die Hetze der Herren zu verteidigen. Aber wie
sollte Peter Trinkler gegen solche grossmächtigen Herren wie den
Zwyer aufkommen — war doch dieser nicht nur österreichischer
General und Feldmarschall, sondern der in der ganzen Schweiz bekannte
allmächtige «erste Agent des Kaisers», der die habsburgischen
Dublonen mit zu verteilen hatte!
Solche Vertreter der «demokratischen» Urkantone also kamen
nun zu den Bauern aufs Land, um von ihnen zu fordern, sich wehrlos
den Aristokraten von Luzern auszuliefern! Sie, die «Landsgemeinde»-Vertreter,
sollten, nach den Instruktionen der Luzerner Herren, den
Bauern «nachweisen, dass der Wolhuser Bund unstatthaft sei»; «dass
aus den eingesandten Beschwerden diejenigen Punkte ausgeschieden
werden müssen, welche die Hoheitsrechte verletzen» — d. h. gerade
die demokratischen Artikel der Schötzer (Willisauer), der Ruswiler
und der Hochdorfer Landsgemeinden, mit denen sie schüchtern versuchten,
ihre uralten Landsgemeinderechte wiederherzustellen! Und
wenn sich die zehn Aemter nicht fügen wollten, so sollten die «Vermittler»
ihnen mit der unverzüglichen «Intercession (d. h. mit dem
militärischen Eingreifen) der ganzen Eidgenossenschaft» drohen. Auf
diese konnten die Luzerner Herren mit Fug pochen; denn auch die
«Eidgenossenschaft» war längst kein Volks bund mehr, sondern ein
Herrenbund; ihre «Tagsatzung» nichts weiter als der «eidgenössische»
Klub der «regierungsfähigen» Aristokratengeschlechter aller dreizehn
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 086 - arpa Themen Projekte
die Luzerner Herren ja bereits in ihren Händen.
Zwar kriegten die Herren «Ehrengesandten» das Luzerner Volk
auf den Sonntag, den 2. März, in keinem einzigen Landesteil zu einer
abtrünnigen Gemeinde zusammen. Aber der Zweck, den die bäuerliche
Kriegspartei mit den für diesen Tag angesetzten «Prozessionen
von einem Amt ins andere» verfolgte, wurde trotzdem vereitelt. Denn
als schon am Samstag der Misserfolg der «Vermittler» sich deutlich
abzeichnete, da wurde «im Namen der Regierung» (!), «um diese
Prozessionen zu verhindern», der bischöfliche Kommissar vorgeschickt
mit der für das ganze Land verbindlichen «Verordnung»: «Am
2. März soll zu Erhaltung des Friedens das allgemeine Gebet in allen
Kirchen des Kantons abgehalten werden». Damit hatte zum erstenmal
in diesem Kampfe auch die Herren partei in der Kirche sich amtlich
zum 'Worte gemeldet, die nun, im ständigen Auftrag der Regierung,
eifrig ans Werk ging, der Volkspartei in derselben Kirche das
Wasser abzugraben. Um die Aktion des bischöflichen Kommissars zu
unterstützen, findet sich unter den Instruktionen der darin sich
selber so nennenden — «weisen Obrigkeit in Luzern» an die Herren
«Ehrengesandten» auch die: «Den Aemtern sei auch vorzuhalten, dass
sie durch ihr Vorgehen ,der Wallfahrt der katholischen Religion
gleichsam die Gurgel abschneiden'...»
Zu gleicher Zeit wurden die Klöster in der Stadt und auf dem
Lande als Festungen und Munitionsdepots eingerichtet. «Im Archiv
des Franziskanerklosters (zu Luzern) wurden Kugeln und Munition
untergebracht.' Auch nach dem grossen Stiftskloster Münster (Beromünster)
wurde Munition geschafft, dafür aber vom Propst Meyer
am Dritten und Vierten der reiche Stiftsschatz und das Stiftsarchiv
«nach Luzern in Sicherheit gebracht». Die besonders volkstümlich
predigenden Kapuziner — darunter der «echte Eidgenosse», nämlich
aus Freiburg im Breisgau gebürtige, Pater Placidus, Prediger in Luzern
— wurden aufs Volk losgelassen, ins Entlebuch und ins Willisauer
Amt geschickt, «um das Volk zu beruhigen». Und wozu solch
fromme Stätten und Menschen in gefährlichen Zeiten sonst nützlich
sind... Wobei wir nicht verschweigen wollen, dass einer dieser Patres,
namens Antonin, den Mut hatte, zu berichten: er «habe im Entlebuch
die 25 Artikel verlesen gehört; ihm scheinen höchstens zwei derselben
unannehmbar»! Aber auch in den gar nicht zu Luzern gehörenden
«Freien Aemtern» «hatte die Regierung von Luzern in Verbindung
mit den Klöstern Muri und Engelberg Gegenminen gelegt. Dadurch
wurden die Geistlichen mit in die Bewegung hingerissen, besonders
die aus Engelberg stammenden Pfarrgeistlichen von Sins». meldet
unser katholischer Herrenchronist. Sie waren es aber auf der Volksseite
schon vorher, wie wir gesehen haben.
Noch vor dem 2. März setzte der Luzerner Rat «ein Schreiben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 087 - arpa Themen Projekte
Crivelli in Mailand» auf. «Der letztere sollte laut Vertrag mit Spanien
200 Reiter und 300 Mann zu Fuss gegen die zehn Aemter in Mailand
ausheben und nach Luzern führen.» So «patriotisch» waren diese.
Herren, die sonst inländische Söldner mit grossem klingenden Gewinn
ins Ausland exportierten, dass sie jetzt auch beträchtliche Kosten
nicht scheuten, um einmal auch ausländische Söldner — und zwar
schwer bewaffnete und gepanzerte — ins Inland zu importieren, jetzt,
wo es um die Machtstellung ihrer Klasse dem eigenen Volke gegenüber
ging! Und so heilig nahmen sie ihr dem Volk dutzendfach gegebenes
Wort, keine «gefrorenen Welschen» ins Land zu rufen. Hätten
sie dies Vorhaben ausgeführt, das ganze Land wäre wie ein Pulverfass
in die Luft geflogen. Angesichts dieser Volksstimmung aber
fanden selbst die Herren Ehrengesandten', dies sei zu riskiert, und
sie rieten ihren von Furcht verblendeten Luzerner Freunden, auf
diesen gefährlichen Import für den Augenblick zu verzichten.
Dafür schrieben diese nun Hülfsgesuch um Hülfsgesuch: an die
Landvögte der von den acht alten Orten regierten «Freien Aemter»,
an den Landvogt der Grafschaft Baden und an den im Rheintal, an
den Abt von St. Gallen, an die «Landschaft Wallis», an den «Obersten
von Mollendin, Gouverneur von Neuenburg', an den Bischof von
Basel, ja auch an die «drei Bünde» und an die «italienischen Vogteien»,
das heisst an die eidgenössischen Landvögte im Tessin. Alles
dies zwischen dem 2. und dem 6. März. Aber zum Beispiel aus den
«Freien Aemtern», die ja unmittelbar. an die luzernischen Aemter
anschlossen, kam schon am Zweiten, dann noch verstärkt am Vierten,
die Kunde nach Luzern, dass dort bereits Entlebucher und Rothenburger
am Werk seien und das Land aufwiegelten, mit dem Erfolg,
dass die Aemter Hitzkirch und Meyenberg für eine Werbung von
Hilfstruppen für Luzern gar nicht in Betracht kämen. Am Vierten
schrieb der Landvogt Jost am Rhyn auch aus Baden: «Durch geheime
Agenten haben die Bauern bereits das Landvolk aufgewiegelt; eine
offene Werbung' für Luzern müsste auf grossen Widerstand stossen...»
Gar im eigenen Michelsamt die 300 Mann, auf die der Luzerner
Rat immer noch hoffte, auszuheben, war ein Wahn, da der
Propst ja aus Furcht vor seinen eigenen Stiftsleuten bereits selber
evakuierte. Ja, selbst aus dem bisher «treuen» Amt Habsburg, aus
dem die 'Regierung bereits 100 Mann ausgehoben hatte, ging jetzt eine
Deputation an die in Willisau versammelten Ausgeschossenen der zehn
Aemter, um die Aufnahme in den Wolhuser Bund zu verlangen. Wobei
die «Habsburger» allerdings vom Stephan Lötscher wegen ihrer
bisherigen Haltung nicht übel abgeputzt und nicht eher zugelassen
wurden, als «bis sie 400 Gulden an die Kosten bezahlt haben». So
rar konnte sich der Bund nun schon machen!
Um die Wahrheit zu sagen: die Luzerner Herren zitterten vor
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 088 - arpa Themen Projekte
sich. Anfang März evakuierte der Schultheiss Ritter von Fleckenstein
Hals über Kopf seine Güter auf dem Land und brachte u. a. «seine
beste Habe aus dem Schloss Heidegg nach Luzern in Sicherheit».
Für Viele aber war gerade die Frage, ob in Luzern noch Sicherheit
sei? Denn «in der Stadt begann man, Silbergeschirr in die Urkantone
zu flüchten, bis der Rat am 5. März dieses Flüchten verbot». Kein
Wunder aber, dass am Sechsten seine Ratlosigkeit wie die der gesamten
Bürgerschaft auf den Gipfel stieg: an diesem Tag nämlich verbreitete
sich die Kunde von der schmählichen Niederlage, die die zehn
Aemter dem Rat und seinen «Vermittlern» auf dem mit grossem
Aufwand begangenen «Versöhnungs»-Tag in Willisau beigebracht
hatten. Da verliess die stolzen Herren für einen Augenblick alles
Selbstvertrauen; ja, ihr Sündenbewusstsein presste ihnen ein wahrhaft
asketisches Gelöbnis ab: «Rat, Hundert und Bürgerschaft gelobten
eine Wallfahrt nach Einsiedeln, um durch Fürbitte Marias Gnade
und Versöhnung zu erlangen. Aller Luxus (!) wurde verboten; innerhalb
der nächsten 20 Jahre (!) sollte niemand Goldschnüre (!) auf
Kleidern anbringen». Wenn das nicht half...
Am 5. März nämlich hatten die «Vermittler» endlich eine Bauerngemeinde
in Willisau zusammengebracht. Aber es war keine separatistische,
sondern eine Gemeinde der Ausgeschossenen aller zehn
Aemter, wie sie der Wolhuser Bund vorschrieb. Luzern hatte von den
«Vermittlern» den Obersten Sebastian Bilgerim Zwyer als Hauptredner,
Landammann Beat Jakob zur Lauben als «Neutralen Ratsschreiber»
und einen andern Zuger Ammann, Georg Sidler, dahin entboten;
ausserdem aber als neue «Vermittler» die Gesandten Nikolaus
Diesbach von Freiburg und den Ammann Gugger von Solothurn.
Beide wurden auf dem Rathaus zu Willisau vom Luzerner Schultheissen
Dulliker in ihrem neuen Amt feierlich begrüsst. Hier wurden
auch ostentativ alle Hülfszusagen der Stände Bern, Glarus, Schaffhausen
und Appenzell, sowie von Stadt und Abt St. Gallen verlesen.
Die Verhandlungen mit den Deputierten der zehn Aemter hatte
der Kapuzinerpater Placidus aus Freiburg im Breisgau mit einer
Predigt «über den Gehorsam gegen die Obrigkeit» einzuleiten. Dann
hielt Landammann, Oberst, General und (österreichischer) Feldmarschall
Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach in Uri, «ein geborener
Landsgemeinde-Redner», wie der Herrenchronist Cysat (in der Bearbeitung
des damaligen Kaplans von Willisau, Jakob Wagenmann)
lateinisch meldet, «eine zierliche und so rührende Rede an die
Bauern, dass selbst Scythen hätten weich werden können». Aber weder
die Luzerner Bauern, noch die Willisauer Bürger waren Scythen.
«Gemurmel und Geräusch unterbrach den Redner», und plötzlich
ertönte die rauhe Stimme eines Entlebuchers und «ermahnte den
Landammann, endlich einmal aufzuhören und zu schweigen, da noch
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 089 - arpa Themen Projekte
Herrenchronist Theodor von Liebenau, der dies nach den Originalquellen
erzählt, fügt zwar stolz hinzu: «Trotzdem fuhr Zwyer fort
und brachte seine Rede zu Ende.» Im nächsten Satz aber schon berichtet
er: «Unter dem Jubel des Volkes zogen die Bauern aus der
Kirche, voraus die Deputierten des Entlebuchs mit fliegender Fahne»!
Wer also von den Bauern etwas wollte, der musste ihnen nachlaufen,
und unter diesen Umständen war ja wirklich nicht viel zu erreichen.
Dabei riskierte man nur harte Anreden. So stiessen die Bauern etwa
die Drohung aus: sie würden demnächst eine «Prozession' nach
Sursee unternehmen, um diese ihnen widerspenstige Stadt samt ihren
Kanonen zum Anschluss zu zwingen, und als Gipfel des Hohns luden
sie den grossmächtigen Herrn Feldmarschall Zwyer höflich ein, sie
auf dieser «Prozession» zu begleiten...
Kurzum und leicht verständlich: «Aus den in Willisau gepflogenen
Verhandlungen gewannen die Vermittler wie die Ratsherren
sofort die Ueberzeugung, dass an eine gütliche Vereinbarung nicht
zu denken sei. Schultheiss Fleckenstein schrieb an Abt Dominik in
Muri den 7. März: ,Die Bauern sind hartnäckig und härter als Stein,
sie wollen von ihren Punkten nicht eines Nagels breit weichen oder
etwas abgehen lassen'.» Für diese Niederlage — dafür nämlich, dass
diese steckköpfigen Bauern das Spiel der Herren «Vermittler» durchschauten
und ihnen partout nicht auf den Leim kriechen wollten —
war es kein ausreichender Trost, dass die «Vermittler' noch in Willisau
ein vom Dritten datiertes Schreiben des Rats zu Bern erhielten:
«er habe den Untertanen der Vogtei Trachselwald die Korrespondenz
mit den Entlebuchern und deren Anhängern verboten und werde denjenigen
nachforschen, die... den Willisauern vier Fässchen Pulver
verkauft haben»!
Darüber wussten der Däywiler Bauer und der Fridli Bucher,
etwa auch der Mauriz Kneubühler, besser Bescheid. Ja, sie waren
auch besser als die Berner Herren darüber unterrichtet, wie nah
das Wetter im Bernerland selbst vor dem Ausbruch stand. Denn sie
waren es, die den nun immer dichter werdenden Verkehr zwischen
den Berner Bauern und Willisau ganz ebenso trefflich organisierten
wie die Entlebucher den ihren. Nicht ohne Grund fürchteten die
beiden Freiburger Gesandten schon zu dieser Zeit, «der Aufstand
möchte sich durch die Berner Bauern auch nach ihrem Kantone verpflanzen'
und mahnten deshalb ihre Herren in Freiburg «zu getreuem
Aufsehen und zur Benachrichtigung Berns». Und dies zwar
auf Grund dessen, was sie im Luzernerland selber sahen und hörten.
«Rysträger» durchzogen das Land; was sie aber verkauften, sei nicht
Reis, sondern Pulver — schrieb am Zehnten der andere Freiburger
«Ehrengesandte», der Seckelmeister Beat Jakob von Montenach, an
den Freiburger Rat, und er fügte hinzu: «ringsum höre man nichts
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 090 - arpa Themen Projekte
auch sonst die Augen offen gehabt zu haben. Am Elften schrieb er
an den Schultheissen von Graffenried in Bern: «Il ne pas meins quo
quelque Selg. estant Ballif n'ayent employé le coustau de St. Barthelemy,
q'ast occasionen ceste revolte»; was zu deutsch etwa heisst:
«eine Hauptursache des Aufstandes bilde das Schindermesser des heiligen
Bartholomäus, dessen sich einzelne Herren Landvögte bedient
hätten».
In der Tat ist dies einer der Haupteindrücke, von denen die «Vermittler»
nun Tag für Tag bedrängt wurden. Sie hatten sich nach der
Niederlage von Willisau bescheiden müssen, die uns bekannten Klagen
der Bauern von Amt zu Amt, von Ort zu Ort zu banden der
Luzerner Herren einzusammeln nur weil die Bauern aller zehn
Aemter in Willisau erklärt hatten: «Ausschüsse senden sie absolut
nicht mehr in die Stadt». Die «Vermittler» wurden hierdurch zur Vermittlung
im wörtlichsten Sinne gezwungen und mussten für eine
Weile auf die hochfliegenden Pläne verzichten, die sie unter der Devise
«divide et impera» («trenne um zu herrschen») ins Werk zu
setzen begonnen hatten. Davon war nach Willisau keine Rede mehr.
Trotzdem erwuchsen aus diesen Unterhandlungen zwischen den Bauern
und den «Vermittlern» immer endlosere und immer erbittertere Diskussionen.
Denn gerade durch die vielen Umritte der «Ehrengesandten»,
die sich in Sondergesandtschaften aufteilten und in die verschiedenen
Landesteile ausschwärmten, um deren Klagen zu sammeln,
wurde die ganze Flut der Volksbeschwerden von grundauf neu aufgewühlt.
Diese zogen sich wie Gewitterwolken über ihren Häuptern zusammen,
wanderten mit ihnen durchs Land und sammelten sich immer
drohender über ihren Hauptstandquartieren Werthenstein und
später Ruswil.
Nun hatten die «Vermittler» allerdings von den Luzerner Herren
höchst sonderbare, mehr zum Provozieren als zum Versöhnen geeignete
Instruktionen mit auf den Weg bekommen. Sie hatten ganze Beschwerdebogen
mit numerierten Vorwürfen mit, die sie den Bauern
aus Prestigegründen bei jeder sich bietenden Gelegenheit einschärfen
sollten. An der Spitze stand natürlich die Gotteslästerlichkeit des Wolhuserbundes,
weil dieser ja den Luzerner Herren durch seine blosse
Existenz, ob er wollte oder nicht, gerade das gottgeschenkte Recht auf
Alleinregierung bestritt. «Der Rat von Luzern fand, das Aergste an
den Verhandlungen in Wolhusen bestehe darin, dass man hier Sachen
vorgebracht, über die man sich vorher niemals beim Rate beschwert
habe, dass die Bauern einen Eid zusammen gegen die Obrigkeit geschworen,
diese zur Aushändigung der Urkunden angehalten, dass sie
beschlossen, Wachen auszustellen, dass sie sich vereinbart, kein Amt
dürfe ohne Zustimmung der andern mit Luzern sich vergleichen, dass
sie beschlossen, Rache an Luzern zu nehmen, wenn dem Geringsten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 091 - arpa Themen Projekte
worden, dieser Eid solle den Rechten Luzerns keinen Abbruch
tun, da man nicht einen weitläufigen Handel, sondern eine gütliche
Vereinbarung wünsche.»
Im Einzelnen sehen die Klagen der Luzerner Herren — die im
übrigen zuhanden der Vermittler alle uns bekannten «Vergehen» der
Bauern seit dem Januar rekapitulieren — oft höchst possierlich aus.
So beklagt sich ausgerechnet der Luzerner Rat, der kreuz und quer
verschwistert und verschwägert war und in dem wenige Familien mit
allen ihren männlichen Gliedern auf Lebenszeit regierten, folgendermassen
im Klagebogen gegen die Entlebucher: «Es sei oft unmöglich,
ein unparteiisches Gericht in Schüpfheim zu finden, weil die Richter
untereinander verwandt und verschwägert seien»! Und man denke: «An
Feiertagen gehen viele Geschworene und Landsassen auf die Alpen
und besuchen keinen Gottesdienst»! Viel ernsthafter dagegen war der
Vorwurf: «In dem Schreiben an den Rat haben die Entlebucher den
üblichen Stil geändert und sich einer Schreibart bedient, als wären sie
,ein Stand'.» Ja, das war der heimliche Traum der Entlebucher, aber
auch der Willisauer: ein eigener eidgenössischer Ort zu werden...
Als nun die Entlebucher seit dem' Siebenten in Werthenstein von
den «Ehrengesandten» auf Grund solcher Frage- und Klagebogen
«verhört» wurden, da haben sie diesen denn auch echt «eidgenössisch»
Bescheid gegeben. Zunächst mal marschierten sie dort «gravitätisch»
auf wie ein «eigener Stand»: hatte jeder der «Ehrengesandten» seinen
Standesweibel, so hatte jeder Entlebucher Gesandte seinen «Leibschützen»
mitgebracht: der Pannermeister Hans Emmenegger erschien
in hohen Reitstiefeln, und so wohl auch die übrigen, der Landeshauptmann
Glanzmann, der Landessiegler, die Weibel Krummenacher,
Emmenegger (ein Vetter Hansens) und Hofstetter, aber auch
Stephan Lötscher, der grosse Hans Krummenacher, Käspi Unternährer
mit seinen beiden anderen Tellen und sogar der Schulmeister
und Bundesschreiber Johann Jakob Müller. Dieser «führte das grosse
Wort». Und das Erste, was er für alle erklärte, war: «ohne Anwesenheit
der übrigen Aemter lassen sie sich in gar keine Verhandlungen
ein»! Also mussten Ausgeschossene der übrigen Aemter eiligst geholt
werden, oder sie waren schon da; denn Werthenstein wimmelte bald
von Bauern aus anderen Aemtern. Das Zweite, was Schulmeister
Müller im Namen der Entlebucher erklärte, war: «Für sich und die
übrigen Aemter verlangen sie freies Versammlungsrecht»!
Dann erst gingen Klagen und Gegenklagen aufeinander los. Auf
die Klage, die Entlebucher hätten die Mandate des Rates verletzt, die
die Aufnahme von Leuten ins Entlebucher Landrecht von dessen Bewilligung
abhängig machen, antworteten sie: «man habe nach altem
Brauch aufgenommen, wen man gern habe». Auf die Klage, sie überschätzten
ihre Gültenpfänder (auf die die Luzerner Herren Hypotheken
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 092 - arpa Themen Projekte
zu teuer und den Bauern zu wohlfeil». Auf die Klage «über die Unordnung
bezüglich Mass und Gewicht» erging prompt die Gegenklage:
die unrichtigen Masse und Gewichte seien «von den obrigkeitlichen
,Feckern' gekauft worden». «Der Rat von Luzern klagte über Eingriffe
in die Hochwildjagd, Entlebuch über Beschränkung der niederen
Jagd. Als Luzern sich beschwerte, dass die Geschworenen die
Fehlbaren nicht vorzeigen, rückte Entlebuch mit der Gegenklage heraus,
es werden immer noch eher zu viel Unschuldige als Schuldige
gestraft.» Als schliesslich die missgünstigen Luzerner Herren sich sogar
die Klage nicht verkneifen konnten: «die Sennen leben mit schönen
Bernerinnen den Sommer über auf den Alpen» (!) — da lächerte
es die Bauern nicht wenig, und sie erwiderten mit grimmigem Witz:
«das ist ja gerade des Landvogts grösster Gewinn; denn dieser lässt
keinen straflos»! Und sie fügten hinzu: «Uebrigens vertreiben die Profosen
(d. h. die Polizeibüttel) diese Bernerinnen, so weit möglich.. .
«Die Entlebucher behaupteten auch, sie hätten der Obrigkeit weit
grössere Käse als Zins für den Hochwald übermittelt, als durch Vertrag
festgestellt worden sei; sie wollten künftig diesen Fehler vermeiden»...
Als die Entlebucher schliesslich den Vorwurf hören mussten,
sie hätten zu wenig Reisgeld (Kriegssteuern) eingezogen, da kam
es zurück: nein, nein, das nicht; aber «wir haben nicht, wie andere
Aemter, das Reisgeld nach Luzern abgeliefert; diesen hat man den
achten oder vierten Teil davon genommen, während wir noch die
ganze Summe besitzen».
Begreiflich, dass dieses grausame Spiel der Bauern die eidgenössischen
«Vermittler» sehr nervös machte und «oft in grosse Verlegenheit
brachte». Es musste ihnen von Tag zu Tag klarer werden,
dass hinter diesem Spiel ein unbezähmbarer Kampfwille stak, der
denn auch immer offener hervorbrach und sich gelegentlich sogar in
sehr gewaltsamen Szenen Luft machte. Die Bauern nämlich wurden
immer ungeduldiger, je länger die Herren ihrerseits ihr Spiel trieben,
stets von Luzerner Ratsherren begleitet im Land herumritten, die
Bauern «verhörten» und nach Werthenstein zitierten. Denn nach den
Entlebuchern wurden hier am achten März auch die Leute vom Michelsamt
und die Willisauer verhört, am Neunten die Ruswiler usw.
Ausserdem hatten die Luzerner Patrizier es für rätlich befunden,
sogar die Herren von der stadtluzernischen Bürgeropposition hierherzuschicken,
in der schlauen Spekulation nämlich, diese von ihren
eigenen revolutionären Anwandlungen durch den Anblick des Bauernschrecks
zu heilen, «da die Begehren der Bauern gerade die Bürger
am meisten verletzen mussten»! So waren hier in Werthenstein auch
die Führer im sogenannten Bürgerhandel, Jakob Wegmann, Mazol,
Rüttimann und Ammann Nikolaus Gilli, gewissermassen als befohlene
Zaungäste, aufmarschiert, was die Bauern nur noch wilder machte.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 093 - arpa Themen Projekte
offen für die Patrizier Partei; während allerdings andere, wie z. B.
Rüttimann und Mazol, diese Gelegenheit nutzten, um sich heimlich
mit den Bauern zu verschwören.
Kurzum, Werthenstein wurde für die Herren «Ehrengesandten »
wie für die Luzerner Herren zu einem selbstangerichteten Hornissennest,
in dem sich gerade die stachligsten Elemente der Bauern je
länger je mehr anhäuften. Diese Kriegspartei machte seit dem achten
März reissende Fortschritte. Sie war der Meinung: «Man wolle mit
diesem Herumziehen (der Vermittler) nur die Sache verzögern und
Zeit gewinnen, bis sie, die Landleute, von allen Seiten durch fremde
Kriegstruppen... umzingelt seien und damit umso leichter massakriert
werden könnten». Sie nannten die Gesandten offen ins Gesicht
«Schelme und Verräter» und drohten ihnen, sie zu verhaften und als
Geiseln zu behalten, wenn die Gerüchte sich bestätigen sollten. Die
«Vermittler» hatten also einen höchst persönlichen und dringlichen
Grund dafür, den Luzerner Rat immer wieder um Aufschub des Imports
fremder Söldner zu ersuchen.
In einer solchen Auseinandersetzung zwischen Bauern und «Vermittlern»
ging es einst so heiss zu, dass einmal der grosse Hans Krummenacher,
der «stärkste Eidgenoss», dem grossmächtigen General
und Feldmarschall Zwyer die Pistole auf den Leib setzte und ihm den
«Garaus machen» wollte. «Schade!» rief später, im Kampfgetümmel
der Niederlage, ein Rothenburger dem Hans Krummenacher zu, «hättest
du ihn nur erschossen, dann wär' es uns Bauern nit also übel ergangen
und viel Unglück erspart worden!» Derselbe Hans Krummenacher
war es, der dem Ueberläufer Ammann Gilli von der Stadtbürger-Opposition
für seine herrenfreundliche Rede in Werthenstein «Geifer
in das Maul» strich.
Die ersten, die entschlossen zur Tat schritten, waren wiederum
die Willisauer. Schon während ihre Bauernführer, der Däywiler Bauer
Hans Häller, der Fridli Bucher und der Führer des unteren Amts,
Jakob Sinner, in Werthenstein noch mitten im Verhör der «Vermittler»
standen und dort den übrigen Bauernführern gegenüber klagten:
«man gehe zu gemach vor, die Ihren werden schwerlich mehr zu halten
sein» — schon am achten März nämlich —, mobilisierten die
Willisauer die gesamte waffenfähige Mannschaft von Stadt und Amt.
Sie stellten zwölf kriegsstarke Kompanieen auf und besetzten die
Kommandostellen durch offenes Stimmenmehr einer Landsgemeinde
auf dem Marktplatz von Willisau: als obersten Befehlshaber, mit dem
Titel «Oberst», wählten sie den Bauern Jakob Bircher aus dem
Lutherntal, der die erste Verbindung mit den Entlebuchern geschaffen
und in zäher Arbeit ausgebaut hatte; als «Oberstlieutenant» den
Bauern Balthasar Schauer aus Gunterswil; und erst den drittobersten
Posten, den eines «Oberstwachtmeisters» oder «Kapitänlieutenants»,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 094 - arpa Themen Projekte
Aber auch die in Werthenstein abwesenden Bauernführer Hans Häller,
Jakob Sinner und Fridli Bucher wählten sie zu Hauptleuten von
Kompanieen; ebenso die Bürgerführer Heinrich Peyer, Kronenwirt,
und Jakob Stürmli, Metzgermeister. Ausserdem den sehr heissblütigen
Hans Diener von Ebikon, dessen Vater noch als Savoyarde eingewandert
und in der Stadt Willisau als Hintersässe angenommen worden
war und dessen Familienname Valet übersetzt den Namen Diener
ergab; und andere mehr.
Die Nachricht von der Rüstung der Willisauer setzte schon am
Neunten die Mehrheit der Bauern vieler Aemter, die in Werthenstein
angehäuft waren, in einen wahren Kriegstaumel — die «Vermittler»
begreiflicherweise in Schrecken. Die meisten Bauern wollten sofort
ebenfalls «den Harnisch anziehen», wenn es auch noch genug andere
gab, die «noch den Ausgang der Verhandlungen abwarten» wollten.
Am gleichen Tag kam auch die Nachricht, die Rothenburger hätten
vor der Kirche ihres Amtshauptortes eine starke Gemeinde abgehalten,
auf der eröffnet worden sei: «die Entlebucher wollen am Mittwoch
Sursee überrumpeln und alles niedermachen, wenn man ihnen
nicht freiwillig die Kanonen überliefere. Bereits haben die Entlebucher
eichene (!) Kanonen mit Zwingen gemacht, mit denen man gewaltig
schiessen könne...» Und abermals am selben Tag verbreitete
sich von Luzern her die Kunde elektrisierend übers Land: dort seien
Nachrichten eingetroffen, «dass auch die Berner Bauern revoltieren,
dass der Landvogt von Lenzburg die Audienzen abgestellt habe, dass
der Aufstand in den eidgenössischen Vogteien bevorstehe und dass
die Willisauer Sursee bedrohen und erklären, wenn nicht in zwei
Tagen alles in Ordnung sei, so greifen sie die Stadt an fünf Orten
an...» Und im untern Amt hatten die Willisauer «bereits den Pfaffnauern
befohlen, Wachen auszustellen und Späher aufzufangen», wie
sie dem Abt Edmund vom mächtigen Stift St. Urban auf Bernerboden
schrieben, zu dem die Paffnauer auf Luzernerboden stiftsgenössig
waren; und sie schrieben dies dem Abt deshalb, weil sie «mit höchstem
Bedauern vernommen» hätten, «dass er die Berner (d. h. die
Berner Regierung) ersucht habe, eine Salva Guardia ins Kloster zu
legen».
Die Erregung in den Massen steigerte sich durch all dies am
zehnten März derart, dass unter den «Aufwieglern» in Werthenstein
selbst der Pfarrgeistliche von Gaiss «sich hervortat, der sich als Führer
und Feldprediger anerbot und die Regierung verspottete». Dies
war am Tag der Verhörung der Leute vom Ruswiler Amt. Diese liessen
es nicht mehr beim Verhör bewenden. An Ort und Stelle, «vor
den Fenstern der eidgenössischen Gesandten», hielten sie abends um
sechs Uhr eine Landsgemeinde ab. «Sie beschlossen, am Morgen eine
Waffenschau abzuhalten und übermorgen auszuziehen. Dieser Beschluss
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 095 - arpa Themen Projekte
Zu diesem Beschluss waren sie auch durch die anwesenden Entlebucher
angefeuert worden. Der Käspi Unternährer, in dessen Haus
am Thomas-Abend die erste Verschwörung zustandegekommen war,
hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede auf offenem Platz, in der er —
wie der Herrenchronist Cysat meldet — die Ruswiler ermahnte, «sich
bestermassen zu bewaffnen und wegfertig zu halten; sie sollen auf
den gemeinen Mann, nicht auf die Geschworenen sehen». Das zeigt,
dass die kriegerische Wendung aus der Stimmung der Massen geboren
war und sich gegen das Schwanken mancher der beamteten Führer
durchzusetzen hatte. Anfeuernd waren hier auch die Entlebucher
Hinteruli, der lange Zemp, Peterli Root und der Minder, lauter nicht
beamtete Führer.
Kein Wunder, dass bei dieser Sachlage eine neue Angst- und Panikwelle
die ganze Stadt Luzern durchschauerte und dass am zehnten
März Schultheiss, Hat und Hundert abermals zu Gott und allen Heiligen
schworen, «Leib und Gut zur Wahrung der Rechte der Stadt zu
wagen» — zu demselben Gott und zu demselben Heiligen, deren Fluch
die Bauern zu gleicher Zeit auf die Herren herabbeschworen. Nach
allen Seiten schaute sich der Rat fieberhaft nach der versprochenen
Hülfe der Urkantone, der Landvögte der Untertanenländer, der ennetbirgischen
Vogteien und besonders nach derjenigen der Bischöfe von
Basel und St. Gallen um. Aber deren Zuzug lag noch im weiten Feld.
Und die Urkantone, obwohl sie bereits heimlich einige Truppen in die
Nähe der Stadt gesandt hatten, durften ja, solange ihre «Ehrengesandten»
am Werk der «Vermittlung» waren, noch gar nicht offiziell
Truppen ausheben. Ja, bereits verlangten die Schwyzer, die Zuger und
die Nidwaldner Bauern energisch die Zusicherung, dass sie nicht gegen
ihre «Brüder», die Luzerner Bauern, ausgehoben werden dürften.
Unter dem Druck dieser Volksstimmung beschloss am Elften eine
Nidwaldner Landsgemeinde in Stans sogar ausdrücklich, «die Frage
der Hilfeleistung einzustellen, bis man wisse, wer recht oder unrecht
habe». Das sah alles für die Luzerner Herren verzweifelt aus. Dies
umsomehr, als die Ereignisse sich zu überstürzen drohten, bevor die
allgemeine eidgenössische Herrenhilfe überhaupt beschlossen werden
konnte; denn die Tagsatzung war durch den Vorort Zürich mit Einladung
vom zweiten März, die noch dazu erst am zwölften verschickt
wurde, erst auf den achzehnten einberufen — und schon bis dahin,
geschweige bis die Hülfe selbst eintraf, konnte alles bereits verloren
sein. Es war ein Wettlauf, der verzweifelt einem Sprung in den Abgrund
ähnlich zu sehen begann.
Diesen Wettlauf begriff aber auch der Jägerinstinkt der Bauern;
und zwar in diesem Stadium vielleicht so gut, wie schon wenige Tage
danach nicht mehr und später nie wieder! Gerade an diesem Tage,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 096 - arpa Themen Projekte
Niklaus Leuenberger
Führer der Emmentaler Bauern
"Obmann' des Sumiswalder- und Huttwiler-Bundes.
Einziges authentisches Bild seines Aussehens vor der Gefangennahme,
so wie er den Bauern bekannt war.
Dieses Bild wurde daher mitsamt den Druckbogen des Werkes,
in dem es erscheinen sollte (des Herrenchronisten und Zürcher
Pfarrers Johann Conrad Wirz "Ohnpartheiische substanzliche
Beschreibung der Eydtgenössischen Unruhen im Jahr Christi
1653", die noch während der Unruhen geschrieben worden war),
auf Betreiben der Berner Regierung noch während des Druckes
im Jahr 1653 durch die Zürcher Regierung eingezogen und vernichtet.
Nur wenige Exemplars entgingen dieser Vernichtung.
Unsere Abbildung ist die getreue Wiedergabe des einzigen heute
in Bern noch aufzutreibenden Exemplars des Originalstichs, eines
Exemplars, das offensichtlich in Eile und sorglos (ohne den
Plattenrand) aus dem Wirz'schen Buch (das in Bern nicht aufzutreiben
ist) herausgeschnitten wurde. Originalstich in der
Berner Stadtbibliothek.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 096 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 097 - arpa Themen Projekte
am Elften, traten sie nun geschlossen und grundsätzlich mit der hochpolitischen
Forderung hervor: «Der Rat von Luzern dürfe keine Gesetze
erlassen, bevor er dieselben den einzelnen Aemtern zur Prüfung
vorgelegt habe»! Damit hatten sie die drei politisch vorgerücktesten
Artikel der Aemter Willisau, Ruswil und Hochdorf aus Einzelforderungen
ausdrücklich zum gemeinsamen Postulat aller zehn Aemter
erhoben. Aber nicht genug damit. Gleichzeitig verlangten sie, und dies
zum erstenmal: «dass ihnen der Bezug des Ohmgeldes überlassen
werde». Das bedeutet grundsätzlich, wenn auch vorerst nur inbezug
auf eine Steuer, nichts weniger als den Anspruch auf die Steuerhoheit!
Und um das Mass voll zu machen: am Tag darauf, am Zwölften, erhoben
die Entlebucher — wie ein «eigener Stand», der mit Luzern
auf Gleich und Gleich verhandelt und seinen Gegner bereits für verurteilt
hält — die Forderung auf «Schadenersatz und Vergütung der
Kosten»; das heisst: Schadenersatz für die von Luzerns ganzem volkswidrigem
Aristokratenwahn als Notwehr erzwungenen Umtriebe und
Erstattung der dieserhalb gehabten Kriegskosten.
Diese drei gemeinsamen Forderungen der Luzerner Bauern waren
stolz und kühn wie vielleicht nichts im ganzen Bauernkrieg! Denn,
wie der grosse konservative Geschichtsschreiber Leopold Ranke in
seiner Geschichte der römischen Päpste sagt: «Es hat keine Zeit gegeben,
welche der Aristokratie günstiger gewesen wäre als die Mitte
des siebzehnten Jahrhunderts». Ihr die Vorrechte, die sie sich angemasst,
wieder abfordern, hiess also die vernichtende Uebermacht
eines ganzen Zeitalters herausfordern. Und wenn sich die Entlebucher
dabei der geschichtlichen Tragweite ihres Anspruchs auch kaum voll
bewusst waren, so ist doch an der tiefen Grundsätzlichkeit ihres Begehrens
gar kein Zweifel möglich. Denn sie haben den ihnen heiligen
Grundsatz der Rechtsgleichheit in eben diesem Schreiben, mit dem sie
den «Ehrengesandten» ihren Anspruch auf Schadenersatz und Vergütung
der Kosten am zwölften März anmeldeten, ausdrücklich als Begründung
ihrer Begehren ausgesprochen. Man müsse ihre Begehren, sagen
sie darin, «nach göttlichem und natürlichem Gesetz im Grund betrachten,
welches in aller Welt das rechte Landrecht ist». Das ist
nicht nur eine der Art dieser katholischen Bauern gemässe religiöse,
sondern eine direkt naturrechtliche Begründung, wie sie erst eigentlich
ins revolutionäre achtzehnte Jahrhundert, und auch dort noch in
eine weit höhere Bildungsschicht gehört...
Dieses hohe Rechtsbewusstsein kommt nicht zuletzt in der vollendeten
Höflichkeit zum Ausdruck, mit der in diesem Schreiben «der
Landespannerherr, Landeshauptmann, Landesfähnrich, die vierzig
Geschworenen und die ganze Gemeinde Entlebuch» die «Vermittler»,
die sie ja gar nicht herbeschieden, die ihnen vielmehr der Luzerner Rat
auf den Hals geschickt hatte, aus eigener Machtvollkommenheit verabschieden,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 098 - arpa Themen Projekte
besser, was Recht ist! Diese «eidgenössischen Ehrengesandten» hatten
nämlich soeben die genannten Begehren der Bauern als «ungebührlich»,
weil mit den Herrschaftsinteressen der Luzerner Herren (und
mit ihren eigenen) unvereinbar, mit Empörung zurückgewiesen. «Diese
Begehren fanden alle Vermittler insolent », schreibt unser moderner
katholischer Herrenchronist, und er kann sich dabei auf den Brief
eines der «Vermittler» selber, des Freiburger Gesandten Beat Jakob
von Montenach an den Schultheissen von Graffenried in Bern vom
11. März berufen. Und gerade in dem Augenblick, als andererseits die
Empörung der Bauern darüber den Siedepunkt erreicht hatte, wo sie
in Krieg ausbrechen musste, «verdankten» die Entlebucher «zwar den
eidgenössischen Schiedsrichtern ihre Bemühungen»; sie gaben aber
zugleich ihrer Ueberzeugung Ausdruck, dass sie «durch den eidgenössischen
Bund», durch «die jeder Zeit wolerhaltene liebreiche Nachbarschaft,
Treue und Redlichkeit» über den Vorwurf erhaben seien, «irgend
etwas Ungebührliches begehrt zu haben». Mit solch ruhig überlegener
Geste entlässt ein wirklicher «eigener Stand» fremde Gesandte,
die er nicht mehr brauchen kann...
Am elften März gaben die Entlebucher noch ein weiteres Zeugnis
ihres gereiften politischen Bewusstseins: in dem Augenblick, wo alle
zehn Aemter sich zum Heereszug gegen Luzern anschickten, versuchten
sie ihre Verbindung mit der stadt bürgerlichen Opposition gegen
die Patrizierherrschaft, trotz aller Skepsis gegen die Bürger, zur
Kampfgenossenschaft auszubauen. Das war zweifellos soeben in der
geheimen Verschwörung mit den revolutionären Führern des «Bürgerhandels»,
Rüttimann und Marzell, in Werthenstein verabredet worden,
wozu der Luzerner Rat selber, durch die Zitierung dieser Bürger an
die Bauernverhandlungen in Werthenstein, in so schlauer Weise beigetragen
hatte. Jetzt also richteten die Entlebucher ein «Schreiben an die
Bürgerschaft von Luzern», worin sie ausführten, «dass ihr Unternehmen
nicht gegen die Bürger, sondern gegen die Herren gerichtet sei,
die durch ihre Tyrannei Stadt und Land bedrohten». Die klugen Bauern
aber — und erst recht Rüttimann und Marzell — wussten sehr
wohl, dass nicht reiner Idealismus die Bürger an ihre Seite bringen
würde, sondern allein ihr nacktes eigenes Interesse. Darum fügten sie
hinzu: «Wenn die Bürger sich nicht den Bauern anschliessen, so werde
man in Wolhusen einen Markt für das Entlebuch errichten und in
der Nähe der Stadt Luzern einen solchen für Uri, Schwyz und Unterwalden.»
Da die Bauern schon seit längerer Zeit den Marktgang zwischen
Land und Stadt bald lockerer, bald schärfer unterbunden hatten,
so wussten die Bürger Bescheid, dass es für sie den geschäftlichen
Ruin bedeuten würde, wenn es den Bauern gelänge, den Marktverkehr
für dauernd von der Stadt fortzulenken.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 099 - arpa Themen Projekte
Wie klug diese Politik der Bauern war, geht schon daraus hervor,
dass auch der zeitgenössische Herrenchronist Cysat(-Wagenmann) in
seiner lateinischen Beschreibung des Bauernkriegs gerade von diesem
Moment des Kampfes folgendes berichtet: «Auch in der Stadt war
nicht alles gesund, da einige faule Glieder (sic!) dem Haupte grosse
Beschwerde machten, und, wär' es zum Treffen gekommen, so hätte
vielleicht von den innern Feinden mehr Gefahr gedroht, als von den
äussern (sic! nämlich von den Bauern!); denn der schon vor dem
Bauernaufruhr entstandene Bürgertumult glomm, übel gedämpft,
noch immer unter der Asche, um bei der Abneigung einiger Bürger
gegen die Regierung, beim ersten Anlasse zur hellen Flamme
auszubrechen.» Aber man ersieht auch daraus klar, woran es bei den
Bauern fehlte: am militärisch-strategischen Verständnis im Gebrauch
ihrer Massenkräfte...
Dafür aber hatten inzwischen die Luzerner Bauern in der Diplomatie
der Verschwörertechnik allerhand hinzugelernt. Jetzt überliessen
sie auch die Beziehungen zum «Ausland», das heisst zu den
Bauern jenseits der Kantonsgrenze, nicht mehr dem Zufall der vielen,
aber meist auf eigene Faust handelnden Einzelgänger, die jenseits
der Grenzen privat zu tun hatten. Schon während den Unterhandlungen
in Werthenstein hatten sie dafür gesorgt, dass vertraute Ausgeschossene
der Bauern aus den Kantonen Luzern, Bern, Solothurn und
Basel — zum erstenmal aus allen vier zusammen — zu einer geheimen
Besprechung ihrer gemeinsamen Beschwerden und zum Versuch der
Aufstellung eines gemeinsamen Aktionsplans zusammentraten. Dies
war, nach der damaligen Herrenauffassung des Verhältnisses zwischen
Obrigkeit und Untertanen, der reine «Hochverrat», der noch weit über
den des Wolhuser Bundes hinausging und schon an sich die Todesstrafe
verwirkte. Das wussten die Bauern aller vier Kantone —und dennoch
kamen sie zu einer solchen «illegalen» Beratung gerade an diesem
ereignisreichen elften März, und zwar in Olten, zusammen. Das war
der erste Keim zu dem späteren grossen Bauernbunde, der die Landleute
von Luzern, Bern, Solothurn und Basel verband! Und zugleich
gewannen sie in der Folge eine weitere —nächst Willisau die zweite —
Stadt, nämlich Olten selbst, für die Sache der Bauern!
Im «Inland» aber kam es zunächst noch zu allerhand verzögernden
Vorspielen, bevor es zu einem Bruch kam, welcher Krieg bedeutete
und doch kein rechter war. Eines dieser Verspiele enthüllt so recht
eine spezifische Schwäche der Bauern, bei der die Herren sie immer
und immer wieder zu nehmen verstanden. Es ist ein Bockspiel des Urkundenwahns,
das sich noch am zwölften März abspielte und das einmal
mehr lediglich dazu geeignet war, die Kraft der Bauern von ihrem
wahren Ziele abzulenken. Gewiss hatten sowohl die Willisauer wie
die Entlebucher recht, wenn sie die Auslieferung bezw. die Rückerstattung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 100 - arpa Themen Projekte
verlangten. Aber für Viele, für allzu Viele, und besonders
für einige Führer unter ihnen, so vor allem immer noch für Hans
Emmenegger, steckte in diesem hartnäckigen Verlangen die zähe Hoffnung:
durch eine noch auf dem Verhandlungswege erreichte Auslieferung
der Originalurkunden zugleich den Frieden und die Freiheit zu
retten! Hier hat sie der politische Instinkt völlig verlassen; denn bei
den «Briefen und Siegeln» ging es um das «Venerabile» ihrer zutiefst
in unwiederbringlichen Zeiten wurzelnden politischen Gefühlswelt,
gegen die der politische Verstand nicht aufkam. Es war ungefähr das,
was viele, allzu viele heutige Bürger in unrettbarer Verfallenheit an
«liberale» Illusionen längst vergangener Zeiten bindet...
Die Luzerner Herren hatten die Entlebucher, genau so wie die
Willisauer, durch stete Hinauszögerung der Urkundenfrage und dann
durch die Zusage blosser «beglaubigter Abschriften» der betreffenden
Dokumente im Luzerner Archiv hinzuhalten versucht — was ihnen bis
dahin ja auch trefflich gelang. Nun aber, an demselben zwölften März,
an dem alles bereits in den Harnisch drängte, gab sich das gesteigerte
Selbstbewusstsein der Entlebucher auch darin kund, dass sie unter
Pochen und Drohen die blossen «beglaubigten Abschriften» ablehnten
und «auf der Vorlegung der Originalurkunden und der Restitution der
ihnen und dem Amte Willisau abgenommenen Urkunden beharrten».
Ausgerechnet an diesem kritischen zwölften März nun «entschlossen
sich Schultheiss und Rat von Luzern mit Zuzug von 31 Bürgern» —
dies letztere natürlich, um den Bauern die Aussichtslosigkeit ihres
Bündnisversuchs mit den Bürgern vom Tag vorher zu demonstrieren
— «zur Vermeidung des Aeussersten (!) den Pfandbrief des Entlebuchs
in Original» nicht etwa den Entlebuchern endlich auszuliefern, sondern
«dem Kapuziner Pater Dominicus in Sursee zu übergeben, der
denselben nach Werthenstein überbringen und dem dortigen Mutter-Gottesbilde
in die Arme legen sollte»! Die Luzerner Herren wussten
eben genau, dass dies der Köder war, auf den die Bauern auch in diesem
kritischen Augenblick anbeissen würden und mit dem man sie
wieder hin und her ziehen und gar am Ende wichtige Teile ihrer Führerschaft
von den hitzigeren Massen trennen könnte. Darum sollte
diese theatralische Szene so langwierig und feierlich wie nur möglich
aufgezogen, der Köder den Bauern nur vor die Nase gehängt, ja nicht
sofort in den Rachen geworfen werden. «Nach Erstellung einer beglaubigten
Abschrift» sollte der kostbare Pfandbrief, in Anwesenheit
der Bauern und natürlich unter strenger Bewachung, «neben dem Venerabile
auf den Altar gelegt, gezeigt und vorgelesen, hernach aber
wieder in Sicherheit gebracht werden»! «Lieber hätten sie (d. h. die
Räte und Hundert) an einem unparteiischen Orte, wenn möglich in
Bremgarten, diese Urkunde aufgelegt» — will sagen: noch weiter entfernt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 101 - arpa Themen Projekte
genossen und natürlich ohne Waffen, als simple Pilger, hätten
aufziehen müssen —noch dazu in einer Gegend, die diese gefährlichen
Gesellen in entgegengesetzter Richtung von Luzern weit abzog..
Eine ähnliche Diversion in kleinerem Masstabe war die Ueberführung
des «grossen roten Urbarbuches» des Michelsamtes aus dem Stift
Beromünster ebenfalls zur Wallfahrts-Madonna von Werthenstein. Sie
wurde vom Junkerpropst Wilhelm Meyer persönlich, «mit dem Bauherrn
des Stifts» zusammen, ebenfalls am Zwölften ausgeführt, begleitet
von einer Eskorte bewaffneter Bauern unter Anführung des
Bauernführers des Michelsamtes Hans Amrein von Holdern, welche
dadurch aus ihrem Amte in ein anderes entfernt wurden. Ausserdem
förderte Propst Meyer die Ablenkung der Bauernkräfte dadurch, dass
er just auf diesen selben Tag die einst für den zweiten März geplante
«Prozession» der Bauern nach Germund endlich gestattete, «welche
dem Anschluss an den Bauernbund die religiöse Weihe verleihen sollte»;
dies jedoch nur unter der Bedingung, «dass nicht alle Gemeinden
am gleichen Tage dort erscheinen sollten». Jetzt nämlich bedeutete
eine solche «Prozession» nicht mehr wie noch am zweiten März,
Weckung und Sammlung, sondern im Gegenteil Zersplitterung der inzwischen
geweckten und gesammelten Kräfte der Bauern. Als der
Propst Meyer in Werthenstein vor den «Schiedsrichtern» erschien, um
vor ihnen mit seinen Amtsleuten auf Grund des Urbars zu verhandeln,
erklärten sich die «Vermittler» prompt für unzuständig, indem sie
fingierten, dass sie nur zwischen der Luzerner Regierung und ihren
Untertanen zu «schlichten» hätten, das Michelsamt aber (ein luzernisches
Amt!) in Propst Meyer seinen eigenen Herrn habe. Und als darauf
der Propst sich weigerte, auf die Begehren der Bauern, besonders
der hitzigen Neudorfer, einzutreten, «wäre er von den mit Harnisch,
Gewehr und Munition aufrückenden Entlebuchern (!) bald gefangen
worden». Das war aber auch Alles.
Und doch nicht Alles! Denn am selben Tag, am zwölften März,
erliess der Pannermeister Hans Emmenegger mit den Geschworenen
vom Entlebuch die dringende Mahnung «an die Willisauer und an die
anderen verbündeten Aemter»: «mit halber (!) Macht auszuziehen und
am Fünfzehnten auf dem Emmenfelde sich einzufinden, wo die Heerschau
(!) stattfinden soll». Das aber ist vielleicht der Beginn der Niederlage
gewesen! Denn jetzt galt es, mit ganzer Macht auszuziehen,
und zwar nicht zu einer «Heerschau» am Fünfzehnten vor den Toren
der Stadt, sondern zu einer unverzüglichen Einschliessung Luzerns,
seiner Abschliessung von jedem Truppenzuzug, zwecks sofortiger Erzwingung
eines rechtsgültigen Friedens, wie ihn die Bauern wollten.
So aber wurde dieses halbe Aufgebot der Entlebucher an die zehn
Aemter für die Herren in Luzern nur das Signal zur unverzüglichen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 102 - arpa Themen Projekte
sie sofort verfügen konnten, hätten noch auf lange hinaus nicht entfernt
hingereicht, um die Bauernlawine aufzuhalten, wenn diese sich
unverzüglich in ihrer vollen Gewalt gegen Luzern in Bewegung gesetzt
hätte. Nur die Schwyzer Hülfstruppen konnten die Luzerner Herren
noch am Zwölften in ihre Mauern hereinnehmen und mit ihnen «den
Turm bei Franziskanern» besetzen; aber das werden kaum mehr als
200 Mann gewesen sein. Vom Bischof von Basel lag am selben Tag
nur die Nachricht vor, dass 500 Mann zu Fuss und 100 Reiter in seinem
Gebiet «marschbereit» ständen. Also galt es für die Luzerner
Herren, alle Kräfte auf die Anstiftung neuer «Diversionen» zu werfen;
das heisst, auf noch wirksamere Mittel als die Urkundenprozessionen
zu sinnen, um die Kräfte der Bauern hinzuhalten, zu hemmen und in
sich selber zu spalten. Dazu mussten die Herren das Heft wieder ganz
in die eigene Hand und den «Vermittlern» aus den Händen nehmen.
Noch am Zwölften konstatierten daher Schultheiss, Rat und Hundert
von Luzern, «dass die Vermittlungsversuche der sechs katholischen
Orte und der Kapuziner erfolglos geblieben seien».
Damit war zwar der «eidgenössische Auftrag» der Vermittler nicht
aufgehoben, und die Herren haben sich seiner auch weiter bedient.
Aber auf Grund dieses Beschlusses übernahmen die Luzerner Herren
nun offen die Führung, die sie bisher dem Scheine nach den «Vermittlern»
überlassen hatten; ja, sie rissen deren Befehlsgewalt über die
eigenen Truppen derselben an sich. Am Dreizehnten teilten sie ihnen
als fart accompli nach Werthenstein mit: «da die Bauern ihren ,bösen
Capricio noch mit Gewalt und Zwang' alles gegen das Recht zu erpressen
suchen und zu diesem Zwecke ihre Truppen schon aufgemahnt
haben, so sehe er (der Luzerner Rat) sich gezwungen, die
Posten in und um die Stadt zu besetzen und zu diesem Zwecke vorläufig
etwa 200 Mann in die Stadt aufzunehmen» (das werden die
Schwyzer gewesen sein, die bereits seit dem Abend vorher in der Stadt
waren) «und die übrigen Truppen der vier Orte vorläufig ausserhalb
der Stadt zu postieren», allerdings «unter Vorbehalt der Genehmigung
von Seite der Gesandten in Werthenstein». Doch schon am selben Tag
abends 6 Uhr meldete der Rat diesen weiter: «er habe sich gezwungen
gesehen, die Waldstätte zu ersuchen, je 100 Mann in die Stadt zu senden,
weil die Rothenburger am hellen Tag mit über 100 Mann die Emmenbrücke
besetzt, einen Wachtposten von 15 Mann an der Reuss und
einen bei dem ,Frieren Brunnen' gegen Littau hin ausgestellt haben».
Doch dies waren nur örtliche Defensivmassnahmen, von denen
der Luzerner Rat selber am besten wusste, dass sie zu weiter nichts
hinreichten. Worauf es in dieser Lage ankam, das waren politische
Diversionen. «Um die Ergreifung der Waffen von Seite der Bauern zu
verhindern», so teilte der Rat den «Ehrengesandten» schon im ersten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 103 - arpa Themen Projekte
(von Obwalden), Ammann Sidler (von Zug) und von Montenach
(von Freiburg) nach Rothenburg abgeordnet zu einer heimlichen Gemeindeversammlung,
um so eine Diversion vorzubereiten». Das Amt
Rothenburg liegt Luzern direkt nördlich vor den Toren. Der weitaus
einflussreichste Mann in diesem Amte aber war der den «Ehrengesandten»,
wie wir wissen, schon sehr wohl bekannte Kaspar Steiner
von Emmen. Wohl um auch die leiseste Kritik seitens der «Ehrengesandten»,
die sich etwa gegen diese Art der Verwendung «unparteiischer
Schidsherren» hätte erheben können, zum vornherein auszuschalten,
fügte der Luzerner Rat unverfroren — aber sicherlich nicht
unbegründet — hinzu: «Zu eben diesem Zwecke (!) sei auch von Zürich
die Tagsatzung (!) nach Baden einberufen worden»!
Doch dieser Rückenstärkung bedurften die «Ehrengesandten»
wohl kaum. Schon am Tag zuvor hatte einer der ihren, Herr von Montenach,
an seine Regierung, den Rat von Freiburg, geschrieben: er ersuche
diesen «um Veranstaltung einer Konferenz zwischen den Ständen
Bern, Freiburg und Solothurn, die darauf Bedacht nehmen sollte,
die Bauern zu einer Diversion zu bestimmen». Um seinen und den Berner
Herren damit Eile zu machen, gab er in diesem Briefe eine Reihe
von Huronengerüchten wieder. «Es handle sich um Plünderung des
Klosters St. Urban (unweit Roggwil bei Langenthal), des Schlosses
Altishofen (eines Herrensitzes im Amte Willisau) und anderer Herrschaftssitze,
um für die Belagerung Luzerns die Lebensmittel aufzutreiben.»
Im ganzen Bauernkrieg ist jedoch nie ein Kloster und auch
nie ein Herrensitz geplündert worden. Wahr ist einzig, dass an demselben
Tag, als dieser Brief geschrieben wurde, zugleich mit dem «halben»
Aufgebot seitens der Entlebucher der Befehl an die Stifte und
Klöster gegeben worden war, «für Verpflegung der Truppen Korn zu
liefern», das diese nämlich in grossem Umfang gehortet hatten. Ferner
teilte Herr von Montenach seinem Rate das alarmierende Gerücht mit,
die Luzerner Bauern rechneten «auf ein Hülfsheer von 6-7000 Mann
aus dem Kanton Bern». Leider — für die Bauern war es zu diesem
Zeitpunkt im Bernerland noch lange nicht so weit: eben erst liefen die
Emmentaler zu ihrer allerersten Landsgemeinde nach Langnau, die
am Tag darauf, am Dreizehnten, begann. Und schliesslich bedauerte
der Seckelmeister von Freiburg in seinem Brief an die heimischen Herren
gar sehr, «dass der Rat von Luzern zu allen Konzessionen bereit
sei, dass er, selbst zum Nachteil für andere Kantone, auf wichtige Hoheitsrechte
verzichten. . . wolle». Das nämlich war die grosse Sorge der
Herren in der ganzen Schweiz: dass die Luzerner Aristokratie sich von
den Bauern, unter dem Druck der sich überstürzenden Ereignisse, ein
allzu grosses Loch in ihre Privilegien schiessen lassen könnte. Denn
das hätte unabsehbare und vielleicht nie wiedergutzumachende Folgen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 104 - arpa Themen Projekte
können...
Diese Sorge war es denn auch, die die Luzerner Herren jetzt zum
bedeutendsten politischen Diversions-Versuch antrieb. Es galt nämlich
jetzt am Zwölften und Dreizehnten, unmittelbar nach dem Bauernaufgebot,
das die «Heerschau» der Bauern zum Fünfzehnten auf das
Emmenfeld entbot, unter Hochdruck ein Dokument zu produzieren,
das zwei völlig entgegengesetzten Bedingungen entsprechen sollte.
Einerseits sollte es den Schein des Entgegenkommens so weit treiben,
dass die Mehrheit der Bauern in den Glauben versetzt werden konnte,
mit der Annahme dieser Artikel von beiden Seiten seien alle ihre
Hauptforderungen bewilligt, besiegelt und verbrieft, ein ehrenvoller
Friede erreicht und man könne deshalb die Waffen niederlegen und
beruhigt nach Hause ziehen. Denn so wie die militärischen Kräfte zu
diesem Zeitpunkt einander gegenüberstanden, etwa zehn zu eins zugunsten
der Bauern, war das — auch bei sehr viel schlechterer Bewaffnung
der Bauern — ein unbedingtes Erfordernis für die Herren.
Andererseits sollte dasselbe Dokument absolut keine Konzession an
die hochpolitischen Begehren der Bauern machen, mithin keinen
Schimmer von «Verzicht auf die Hoheitsrechte» enthalten (in dieser
Hinsicht konnte Herr von Montenach, und mit ihm alle anderen
Schweizer Herren, vollkommen beruhigt sein); ja, dieses Dokument
sollte so abgefasst sein, dass es rechtlich nicht zwingend verbindlich
blieb, sondern an dem Tag fallen gelassen werden konnte, an dem
man durch eidgenössischen Zuzug die zweifellose militärische Uebermacht
erlangt haben würde.
Zur Abfassung einer solchen Quadratur des Zirkels konnten die
Luzerner Herren keinen Besseren finden als den Urner Obersten und
österreichischen Feldmarschall Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach
—diesen Ruhm muss man dem «ersten Agenten des Kaisers in der
Eidgenossenschaft» neidlos lassen. Er ist der Schöpfer dessen, was
nun als «Erster gütlicher Vergleich» in die Geschichte einging. Zwyer
diktierte sein «Vermittlungsprojekt» in höchster Eile noch in Werthenstein
dem Unterschreiber J. L. Bircher in die Feder und brachte trotzdem
ein Dokument zustande, das in vollen 32 Artikeln mit grosser
Kunst vermeidet, von allen grundsätzlichen Forderungen der Bauern
auch nur ein Wort zu sagen, oder in denen die gegensätzliche Auffassung
der Herren als Vorrecht derselben wie das Selbstverständlichste
von der Welt vorausgesetzt wird. Während von all den konkreten
bäuerlichen Einzeldingen — von den Gülten, Schulden, Bussen, Salz-,
Vieh- und Pferdehandel, Massen und Gewichten, Beil- und Kaufbriefen,
Strassen und Kirchwegen, Birsen, Jagen und Fischen usw. usw. —
bis ins Detail geredet wird, und zwar so, dass immer ein Viertel-,
oder ein halbes, oder selbst ein ganzes Entgegenkommen in die Augen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 105 - arpa Themen Projekte
der obrigkeitlichen Souveränität, höchst kunstvoll in bescheidene
Sprache gekleidet, überall unauffällig eingeflochten. Ueber das Ganze
ist der den Bauern so teure Hauch des «guten alten Herkommens»,
von «Brief und Siegel» und «Alten Freiheiten», bei denen Dieses und
Jenes verbleiben solle, gestreut.
Gleich der erste und umfänglichste Artikel gilt den alten Briefen,
aus denen die Entlebucher «ihre Rechte und Freiheiten glauben beweisen
zu können», von denen der Rat zwar erklärt, «dass ihm von
solchen Urkunden nichts bekannt sei», dass er dafür aber «den Pfandbrief
von 1405 und das Vorkommnis von 1514 wegen des Hochwaldes
aufgelegt» habe; unter diesen Umständen wird gnädigst «erkannt, die
Entlebucher sollen bei den 1514 wegen des Hochwaldes getroffenen
Vereinbarungen geschützt werden»; treuherzig wird hinzugefügt:
«kommen später weitere Artikelbriefe zum Vorschein, so sollen diese
von den Parteien einander mitgeteilt werden». Ei, ei, wie freundlich
gegenüber den Rebellen! Aber das ist auch Alles! Keine Rede von der so
leidenschaftlich geforderten Rückgabe der Briefe, und auch kein Wort
der Begründung ihrer Verweigerung! Der einzige Artikel, der vorbehaltlos
bewilligt wird, ist der siebente: «Der Salzhandel wird freigegeben».
Dies aber war eine Konzession, die der Luzerner Rat — wie
sogar auch schon die Berner Regierung — schon seit dem Januar urbi
et orbi hatte verkünden (nicht etwa verwirklichen!) lassen; sie hatte
also ihre Köderwirkung längst eingebüsst. Dafür gibt es drei Artikel,
die ebenso apodiktisch ablehnend sind: und gerade sie betreffen die
Kernrechte. So schon der Artikel 26: «Ohne vorherige Bewilligung der
Obrigkeit dürfen keine Fremde als Landleute aufgenommen werden».
Wie erst recht der Artikel 28, in dem der Urner «Landsgemeinde-Demokrat»
Zwyer den Entlebuchern seine Meinung sagt: «Weil
Lands gemeinden in der Weise, wie solche jetzt begehrt werden, selbst
an solchen Orten der Eidgenossenschaft, wo freie Landsgemeinden
stattfinden nicht herkömmlich (!) sind, so sollen diese aberkannt(!)
sein. Wird eine Landsgemeinde notwendig erachtet, so soll diese mit
Bewilligung und im Beisein eines Landvogtes (!) stattfinden». Damit
wurde das uralt eidgenössische freie Versammlungsrecht — unter
heuchlerischer Berufung auf ein «Herkommen», das die Aristokraten
erst geschaffen haben — rundweg verweigert und durch eine rein
«autoritäre» Besammlung ersetzt.
So musste es aber sein, und in diesem Punkt konnte auch die in
allem übrigen sonst so schlau berechnete Absicht dieses ganzen «gütlichen
Vergleichs» den Herren unmöglich einen Kompromiss gestatten;
denn nur so konnte auch die Frucht des freien Versammlungsrechtes,
der Wolhuser Bund, als ungesetzlich, als Verbrechen gebrandmarkt
werden! Ihm nämlich gilt der dritte von den apodiktisch verneinenden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 106 - arpa Themen Projekte
schärfste ist: «Der Bund, den die 10 Aemter zu Wolhusen geschlossen,
ist null und nichtig. Ein solches Zusammenlaufen und Vergreifen an
der Obrigkeit darf auch nicht mehr geschehen». Hier hat der Herrenzorn
die ganze Fuchsklugheit der Herren verblendet. Denn dieser Artikel
ist die Bombe geworden, die für sich allein genügte, den Bauernzorn
zur Explosion zu bringen und nicht nur das Nachwerk dieses
«gütlichen Vergleichs», sondern das ganze Netzwerk des damit erstrebten
Endzwecks auseinanderzureissen. Und wenn das auch nicht
jetzt sogleich vollständig geschah — so doch später, gewissermassen
durch Fernzündung in immer neuen und immer weiterzündenden Explosionen.
Erst der auf solche Weise verfemte und dann, unter Berufung
auf diesen Artikel, immer ausgebreiteter verfolgte Wolhuser Bund
ist der weiterzeugende Vater des Sumiswalder und des Huttwiler Bundes
geworden, welcher auf seinem Höhepunkt sich zum ersten allgemeinen
Volks und gegen den Herrenbund der Regierungen in der
schweizerischen Geschichte erhob...
Zu diesem, bei ihrer Zugehörigkeit zur Aristokratenklasse unvermeidlichen
Fehler fügten die Herren von Luzern einen trotz dieser
Zugehörigkeit durchaus vermeidlichen. Oberst Zwyer hatte dem
Schluss des Vertrags zwei sehr schlau auf die Bauernpsyche berechnete
Artikel (30 und 32) eingefügt, die dem Durchschnitt der Bauern
den Albdruck des schlechten Gewissens für ihre Teilnahme an solch
ungewohnten obrigkeitswidrigen Dingen, d. h. die Angst vor den immerhin
möglichen Folgen, vor der behördlichen Strafe, von der Seele
nehmen sollten. Zudem wurde durch den letzten Artikel so verführerisch
die Illusion der Freiheit des Entschlusses und der Gleichheit der
Partnerschaft geweckt, dass der Schlussatz von der Pflicht zu neuer
Huldigung, der all dies wieder einebnete, leicht übersehen werden
konnte. Artikel 30 lautete: «Auf Bitten der Schiedsrichter wollen die
Herren von Luzern die Entlebucher als Anstifter dieser Unruhe nicht
entgelten lassen, da dieser Auflauf nicht in böser Meinung, noch aus Ungehorsam
geschehen.» (Vergl. dagegen vier Tage später die Schimpflawine
des Manifestes der Luzerner Regierung und weiter sechs Tage
später diejenige der Tagsatzung, die beide hundertprozentig das Gegenteil
behaupten!) Artikel 32 lautete: «Wird dieser Vertrag und Spruch
nicht von beiden Teilen angenommen, so soll er keinem Teile Vorteil
oder Schaden bringen, sondern als nicht zu Papier gebracht betrachtet
werden. Wird er angenommen, so soll er den Gemeinden ganz vorgelesen
werden, damit niemand sich mit Nichtwissen entschuldigen könne.
Darauf soll dem Landvogt neuerdings gehuldigt werden.» Diese beiden
Artikel aber wurden von den Luzerner Herren sofort gänzlich
verworfen, «wegen allzu milder Auffassung des Streites und Behandlungsart
des Vertrags»!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 107 - arpa Themen Projekte
Als nun die «Vermittler» diesen vom Luzerner Rat revidierten
Entwurf zum «ersten gütlichen Vergleich» eiligst noch am Dreizehnten
zu den 230 Ausgeschossenen der 10 Aemter in Werthenstein brachten,
da entdeckten die Bauern sofort, was Alles unter dem Deckmantel des
Entgegenkommens ihnen verweigert werden sollte. Auch das unverzügliche
Angebot der «Vermittler» zur Verbesserung der einen oder andern
von zahllosen konkreten Bagatellsachen, die ihnen von den
Bauern schon während des Lesens an den Kopf geworfen wurden,
nützte ihnen nichts. Denn nun stiessen diese auf den Artikel 29: das
strikte Verbot des Wolhuser Bundes! Und gleich ging Alles in die Luft!
Nicht nur verlangten sie wild und drohend die sofortige Streichung
dieses Artikels — jetzt fiel ihnen auch, gerade wegen der drohenden
Schärfe der Sprache desselben, das völlige Fehlen einer Zusage über
die Straflosigkeit auf. Sie verlangten stürmisch einen Artikel darüber,
nein, mehr, viel mehr: auch über den Kosten- und Schadenersatz! Als
weder die «Ehrengesandten», noch die anwesenden Luzerner Herren
auf diese Begehren eintreten wollten, da «entstand» wie Vock, nach
dem mitanwesenden Luzerner Herrenchronisten Cysat, berichtet —
«unter den Bauern Zorn, Wut und wahnsinniges Toben». Sie fühlten
sich von den «Vermittlern» verraten und verkauft; sie drohten ihnen,
dass sie sie, «wofern sie mit unredlicher Absicht umgingen», schon «zu
bewachen und zu behalten wissen werden»! Sie lehnten alle weiteren
«mündlichen Erörterungen» ab und forderten statt eines «gütlichen
Entscheides» jetzt einen klaren «rechtlichen Spruch». «Die Rothenburger
dagegen waren sehr ungestüm und verlangten Pulver.» «Es erscholl
das Geschrei: Zu den Waffen! Und in alle Aemter eilten Boten,
das Volk zum unverweilten Aufbruch gegen die Stadt anzumahnen..»
Am vierzehnten März, «als schon überall die Trommeln wirbelten,
die Fahnen wehten und das Volk sich in Kriegsscharen ordnete»,
bestiegen die «Ehrengesandten» in Werthenstein ihre Pferde und galoppierten
nach Luzern zurück.
Am selben Tag eilten Entlebucher und Emmentaler Bauern freudig
erregt über alle Pässe ins Luzerner Land, um diesem die anfeuernde
Botschaft vom erhebenden Anlauf der ersten grossen aufständischen
Landsgemeinde der Berner Bauern in Langnau zu überbringen...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 108 - arpa Themen Projekte
VII.
Die «Katz im Sack» —
und wie die Bauern sie laufen liessen
«Noch war von keiner Seite der Krieg erklärt; aber die Truppen
beider Parteien standen sich bewaffnet gegenüber.» So fasst unser
moderner Luzerner Herrenchronist von Liebenau die Lage an diesem
entscheidenden Wendepunkt des luzernischen Verlaufs des Bauernkriegs,
in den Tagen vom vierzehnten bis zum sechzehnten März 1653,
richtig zusammen. Und er legt sofort, ebenso zutreffend, den Finger
auf den wunden Punkt bei den Bauern, wenn er unmittelbar fortfährt:
«Die Bauern aber, obwohl damals im Vorteil, wagten nicht, die Stadt
anzugreifen; sie verlegten sich vielmehr wieder auf Verhandlungen».
Dies aber war genau das, was die Luzerner Herren von damals in
ihrer traurigen militärischen Lage am heissesten vom Himmel erflehten!
Zwischen den Zeilen dieser Darstellung des modernen Herrenchronisten
ist auch deutlich zu lesen, was den damaligen Herren allein
imponiert hätte: wenn die Bauern wirklich «gewagt» hätten, «die Stadt
anzugreifen»! Schliesslich waren die Bauern bereits seit dem Zwölften
durch die Entlebucher aufgeboten, auszuziehen, wenn auch nur mit
«halber Macht» und zu einer blossen «Heerschau» auf dem Emmenfelde
am Fünfzehnten. Aber auch diese «halbe» Macht hätte noch am
Vierzehnten, noch am Fünfzehnten, noch am Sechzehnten genügt, mit
einem entschlossenen Handstreich die Stadt in die Hand der Bauern
zu bringen.
Was sie daran gehindert hat, ist wohl in erster Linie die wahrhaft
bemitleidenswerte Unfähigkeit zur militärischen Organisation ihrer
Massenkräfte. In hellen Scharen durchzogen sie kreuz und quer das
ganze Land, ohne dass auch nur das mindeste Anzeichen von irgendwelchem
Aufmarschplan ersichtlich wäre. Das einzige, was — wenn es
im Rahmen wirklicher Truppenbewegungen geschehen wäre — danach
aussehen könnte, ist die «Fruchtsperre» (Getreidesperre), die die
Bauern am Vierzehnten gegen Luzern anordneten, die Besetzung der
Brücken über die Emme und die Reuss am gleichen Tag, sowie die
Seesperre, die die Fischer von Langensand und Meggen etwas später
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 109 - arpa Themen Projekte
über den See legten. Aber nicht einmal der Aufmarschbefehl zu der
«Heerschau» wurde auch nur von der Hauptmacht befolgt. Zwar lagerten
bereits vom Vierzehnten an 3000 bewaffnete Bauern auf der
Allmend zwischen Kriens und der Stadt Luzern. Diese 3000 Mann aber
waren nur ein Bruchteil von der Gesamtmacht, die schon an diesem
Tag im ganzen Land herum auf den Beinen war, jedoch planlos bald
da, bald dort grosse, untätig herumliegende Heerhaufen bildete, hauptsächlich
im Rothenburgischen. Doch selbst die 3000 Mann, die auf
dem Krienser Boden wie Hochwasser im Sumpf zusammengelaufen
waren, hätten, gut und kühn geführt, die ganze Lage entscheiden können.
Wer aber waren ihre militärischen Führer? Sie waren bestenfalls
vom Schlage Schybis! Dieser alte Landsknecht, jetzt «Oberst» der
Entlebucher, fand nichts besseres zu tun, als einen Grossteil der Mannschaft
mit Holdrio auf den Gütsch hinauf zu führen, dort aus purem
Mutwillen den Vogelherd zu zerstören und dann auf dem Knubel ein
neues Lager aufzuschlagen... «Fromme Entlebucherinnen trugen
ihren Männern Fastenspeisen auf den Gütsch» Fröschenbeine und
Brotschnitten! .
Ueberhaupt die Verpflegung — das war der schlimmste Punkt
in der militärischen Organisation der Bauern! Dafür war auch nicht
das Mindeste vorgesorgt. Jeder Mann nahm von zuhause mit, was er
in den Kittel oder in den Hosensack stecken konnte, eine Wegzehrung
für einen oder zwei Tage. Daher kam es, dass in den meisten Lagern
schon am zweiten oder dritten Tag die Hungersnot ausbrach. Und mit
hungrigem Magen entwickelt man bekanntlich wenig Heldenmut. So
kam es, dass viele Mitläufer allein um des lieben Brots willen die
Truppen schon unterwegs verliessen oder aus den Lagern nach allen
Seiten ausschweiften, um etwas Essbares aufzutreiben.
Bei dieser trostlosen Verpflegungslage ist es geradezu als ein
Wunder der Gutmütigkeit dieser Bauern zu bezeichnen, dass — wie
selbst die Herrenchronisten erstaunt berichten —sogut wie keine Plünderungen
vorkamen. Ein einziger solcher Fall wird aus dem Amte
Rothenburg gemeldet: «In dieser Not wurden die Kornspeicher des
Klosters Rothhausen (nicht das Kloster) geplündert und Wagen mit
Wein und Korn, die für die Stadt bestimmt waren, als Beute behandelt».
Als jedoch beispielsweise die Truppen an der Emmenbrücke
am Siebzehnten natürlich auch schon mächtig Not litten, da wandten
sie sich treuherzig an den reichen Junkerpropst des Stiftes Münster,
er möge ihnen Proviant liefern, indem sie allerdings, zur grösseren
Sicherheit, der Bitte beifügten, dass «sonst 400 Mann aus dem Michelsamt
selbst solchen holen werden». Das war eine herrliche Gelegenheit
für den fröhlichen und witzigen Alchemisten, als den wir diesen Propst
kennen lernten, sich mitten in dem bedrohlichen Bauernsturm als
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 110 - arpa Themen Projekte
anerkannt hatten, aufzuspielen und zu erklären, er wolle sich
«unparteiisch halten und den Bauern ein Namhaftes an Korn und
Wein ausfertigen lassen». Es versteht sich von selbst, dass diese gemeine
Not der Bauern für die Herren ein höchst erwünschtes — und
von ihnen auch sofort bemerktes und ausgenütztes — Einfallstor bedeutete,
durch das sie das trojanische Pferd der Zersetzung und des
Verrats in ganze Truppenteile hineinzubringen vermochten.
Ueberhaupt war in diesen bedrohlich aussehenden Tagen die
politische Diversion mehr denn je das Hauptmittel der Herren, um die
Lawine der Bauern in fieberhafter Anstrengung von innen her aufzuspalten,
aufzuhalten und in ungefährliche Niederungen abzulenken.
Sofort, am Vierzehnten, machten sie sich ans Werk. Gleichzeitig mit
den sich jagenden, geradezu flehentlichen und mit reitenden Eilboten
in jede Richtung der Windrose ausgesandten Hülfsgesuchen an alle
früher bereits angeschriebenen Mächte sandten die Luzerner Herren
sämtliche «neutralen Schidherren», die «Ehrengesandten» der sechs
katholischen Orte, in Begleitung luzernischer Ratsherren und Landvögte
in alle zehn Aemter aus. Sie konnten sich dabei auf die Verhandlungssucht
eines Grossteils der Bauern verlassen und sich ausserdem
auf soundsoviele Beschlüsse von Bauernausschüssen berufen, die
(wenn auch mit ganz anderen Hoffnungen!) auf beschleunigten Abschluss
eines definitiven Abkommens mit der Regierung drängten, die,
wie sie sich selbst ausdrückten, «des Dings halber an eine Endschaft
kommen wellen». Kurz, es brachen Tage der Wollust für die «Blodermäuler»
an. Und die sind gar leicht über den Löffel zu halbieren. Ja,
bei diesen sind sogar Drohungen oft das wirksamste Mittel, um etwas
zu erreichen.
Es scheint in der Tat, dass auch die unmittelbare Initiative zu den
nun neuerdings üppig ins Kraut schiessenden Verhandlungen von den
Bauern selbst ausgegangen ist, und zwar direkt von den Ausgeschossenen
der zehn Aemter, die eben noch in Werthenstein permanent versammelt
gewesen waren; oder sagen wir besser: von einem Teil dieser
Ausgeschossenen, denen nämlich, die nicht mit ins Feld gezogen waren.
Diese müssen ihren Sitz noch am Vierzehnten nach Ruswil verlegt
haben, angeblich weil dieses um eine Fusstunde näher bei Luzern
liegt, wohin nun die Bauernlawine allerdings sowieso gravierte. Und
zwar muss mit den am Morgen desselben Tags nach Luzern galoppierten
«Ehrengesandten» bereits abgemacht gewesen sein, sie in Ruswil
wieder zu treffen. Denn am Morgen des Fünfzehnten schreiben die
Ausschüsse einigermassen enttäuscht an diese nach Luzern: «Sie haben
gehofft, die Gesandten in Ruswil zu treffen, da dies nicht möglich gewesen,
so ersuchen sie dieselben, heute nochmals nach Ruswil zu kommen,
und zwar mit vollmächtiger Gewalt. Es wäre ihnen auch lieb,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 111 - arpa Themen Projekte
desto eher in aller Freundlichkeit vertragen könnte. Wenn ein rechtlicher
Spruch, dem göttlichen und billigen Recht gemäss erfolge, so
werde man sich dazu bequemen und sich demselben, wenn immer möglich,
unterwerfen. Kämen die Gesandten nicht noch am heutigen Tag,
so müssten die 10 verbündeten Aemter annehmen, man wolle die Sache
auf die lange Bank schieben und sie mit Versprechungen von einem
Tag zum andern hinhalten».
Die erstaunlichste — und bedenklichste — Wandlung, die die
Ausgeschossenen zugleich mit ihrer Umsiedlung nach Ruswil vollzogen
haben müssen, drückt sich im Eingang dieses Schreibens aus, worin
sie den Herren «Ehrengesandten» «ihr Bedauern darüber äusserten,
dass verdächtige Reden gefallen und die Drohung ausgesprochen
worden, sie in Arrest zu halten oder ungütlich mit ihnen umzugehen.
Das könnte höchstens von einem Amte geschehen sein...»! Wir müssen
daraus fast zwingend schliessen, dass die Männer, die nach Ruswil
übergesiedelt sind, nicht mehr dieselben waren, die in Werthenstein
den Ton angaben, und dass die wirklich entschlossenen Revolutionäre
inzwischen alle ins Feld gezogen waren. Darunter vor allem die Entlebucher
gegen die sich die Denunziation im letztzitierten Satze richtet
und aus deren Amtsbereich, in dem Werthenstein liegt, das «Rumpfparlament»
vermutlich nach Ruswil geflüchtet ist! Das wird fast zur
Gewissheit erhoben, wenn man in diesem höchst seltsamen Schreiben
weiter liest, dass diese nicht minder seltsamen «Rebellen» als Begleiter
aus der Stadt für die «Ehrengesandten» neben dem Landvogt Keller
ausgerechnet den «alten Raubgeier» Schultheiss Fleckenstein, den
wohl bestgehassten Luzerner, zu sich nach Ruswil wünschten, welche
beide, wie die Bauern in ihrem Schreiben sagen, «den Rothenburgern»
(wem? etwa Kaspar Steiner?) «ihr Erscheinen zugesagt» hätten...
Gerade dieses Detail weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine den
Herren bereits gelungene Teil-Zersetzung bei den Rothenburgern
handeln muss, von der wir auch bald mehr zu berichten haben
werden.
Jedem strategischen Laien muss es in die Augen springen, dass
eine solche Haltung immer noch führender Männer unter den Bauern
den bereits in Gang gesetzten «Kriegsoperationen» derselben nichts
weniger als förderlich sein konnte. Vielleicht ist es gar ein wirklicher,
von den «Linden» unter den Bauernführern gegen die ins Feld
gezogenen «Harten» organisierter «Dolchstoss» gewesen, den sie dann
allerdings im entscheidenden Augenblick geführt haben! Der Ausgang
dieser Ruswiler Verhandlungen und damit des ganzen bisherigen
Kampfes der Bauern auf Luzerner Boden wird uns jedenfalls in den
Reihen der Bauern — nach der bisher erlebten Einmütigkeit — derart
verblüffende Lähmungserscheinungen offenbaren, dass diese ohne
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 112 - arpa Themen Projekte
Niklaus Leuenberger
Unveröffentlichtes Originalaquarell (Pendant zu Abbildung 11)
im Kupferstichkabinett des Basler Kunstmuseums.
Zeitgenössische Konstruktion nach dem einzigen authentischen
Bildnis des bärtigen Leuenberger (siehe Abbildung 6), vermutlich
kompositionell abhängig von Abbildung 9 oder Abbildung 10.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 112 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 113 - arpa Themen Projekte
eine planmässige Mitwirkung führender Bauern selber, das heisst ohne
organisierte Sabotage, gar nicht denkbar sind.
Und jedenfalls ist es klar, dass sich die Luzerner Herren diese geradezu
bauern-offizielle, wenn auch unter ihrer eigenen geheimen Mitwirkung
zustande gekommene Möglichkeit zu einer entscheidenden
Haupt- und Staats-Diversion —in Erwartung besserer Dinge hinsichtlich
ihrer eigenen militärischen Rüstung — nicht zweimal anbieten liessen!
Spornstreichs ritten am Fünfzehnten die «unparteiischen Schidherrn»
nach Ruswil — nachdem sie an dem einen Tag, den sie in Luzern verbracht
hatten, «in höchster Eile» nicht nur den Vorort Zürich zuhanden
aller übrigen Orte gegen die Bauern aufgehetzt, sondern auch
einen direkten «offenen Mahnbrief» an den Landvogt der Grafschaft
Baden geschrieben hatten, ihm «befehlend, ihnen (den GH Herren und
Obern von Luzern) einen ansehnlichen Succurs von der Mannschaft»
zu senden, um «ihnen damit in ihren Nöthen beizuspringen». An der
Spitze der Gesandtschaft stand wiederum der unentbehrliche und wirklich
einzige überragende Kopf der gesamten innerschweizerischen Aristokratie
Oberst Zwyer von Evibach. Dieser hatte von den Luzerner
Herren den Auftrag, in Ruswil aus den verbliebenen Bauernführern,
die derart «entgegenkommend» nach Luzern geschrieben hatten, jetzt
noch viel mehr für die Wiederherstellung der obrigkeitlichen «Souveränität»
herauszuholen als beim «Ersten gütlichen Vergleich». Jetzt
sollte der «Rechtliche Spruch», den die Bauern in Werthenstein so
stürmisch verlangt hatten, aufgerichtet werden —aber nicht das Recht
der Bauern, sondern das «Recht» der Herren sollte dabei nun mehr
denn je der ausschliessliche Leitstern sein.
Das konnte viele Tage dauern. Darum konnten die Luzerner Herren
in ihrer derzeitigen Lage den Ausgang der Ruswiler Verhandlungen
unmöglich abwarten. Solange die Aemter von ihren revolutionärsten
Kräften entblösst waren, weil diese natürlich alle mit dem allgemeinen
Landsturm ins Feld aufgebrochen waren, sollte vielmehr jeder
einzelne Tag den Herren in Luzern einen Vorteil im Hinterland der
Bauernarmee, an deren Heimfront, einbringen. So hatten denn die
andern «Ehrengesandten», die am Vierzehnten in alle übrigen Aemter
ausgeschickt worden waren, den Auftrag, vorläufig auf Grund des
«Ersten gütlichen Vergleichs» zu verhandeln und möglichst jedes Amt
einzeln zur Annahme desselben zu bringen. Was dabei noch allzusehr
zugunsten der Bauern ausfallen mochte, würde durch das Ergebnis
des «Rechtlichen Spruchs», der ja fürs ganze Land durchzusetzen war,
und unter dem Druck der wachsenden militärischen Rüstung schon
wieder eingeebnet werden.
In Durchführung dieses Planes hatte man schon am Dreizehnten
von Werthenstein aus niemand Geringeres als den Dekan von Ruswil
und Wolhusen, den päpstlichen Protonotar Dr. Lüthard, der den Wolhuser
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 114 - arpa Themen Projekte
«Gütlichen Entscheid» ins gefährliche Amt, ins Entlebuch, geschickt.
Den Luzerner Herren war es also inzwischen gelungen, diese religiöse
Säule des Wolhuser Bundes für die «Vermittlung», das heisst für sich
zu gewinnen. Selbst die zuhause gebliebenen Entlebucher aber liessen
sich durch seine Hochwürden und den von seinen Beamten dem Volke
eröffneten Vertrag nicht blenden. Das Volk benahm sich sogar «sehr
ungestüm und verlangte die Aufnahme mehrerer Artikel in denselben.
Dann gab man sofort den verbündeten Aemtern hievon Kenntnis und
mahnte sie um Hülfe.» Darum sandten die Luzerner Herren am Vierzehnten
die «Ehrengesandten» Altstatthalter Michael Jakob An der
Matt von Zug ins Entlebuch, und dies schon nicht mehr um kirre zu
machen, sondern um zu drohen, «wenn das Land sich dem eidgenössischen
Rechte nicht füge, so habe es die Folgen selbst zu tragen».
Ins Amt Kriens und Horw hatte man, um dieses allzunahe den
Stadttoren gelegene Amt sofort zu unterwerfen, schon am Vierzehnten
früh, noch bevor die «Ehrengesandten» von Werthenstein zurückgekehrt
waren und bevor die Heermacht der Entlebucher auf dem Krienser
Boden eingetroffen war, den dortigen Landvogt Wendel Schumacher
sowie den Willisauer Landvogt Jost Pfyffer geschickt. Als die
Leute sich rundweg «weigerten, die gütliche Vermittlung anzunehmen»,
drohte Schumacher den Kriensern mit einem Ueberfälle «mit
Hülfe fremder Truppen»; der forsche Jost Pfyffer gar verstieg sich zu
der Drohung, «wenn das Oertlein Horw sich nicht füge, so werde es
bis 12 Uhr ein Schutthaufen sein»! Dies musste der Bevölkerung umso
glaubhafter erscheinen, als die soeben durchmarschierten, vom Luzerner
Rat herangezogenen Hülfstruppen aus Nidwalden, wie die Fama
ging, «in Horw und Langensand sich Beschädigungen erlaubt» haben
sollten. Diese Drohungen der beiden Landvögte gaben also sehr begreiflicherweise
das Signal zu einer wahren Panik im ganzen Amt, sodass
Frauen und Kinder von Kriens und Horw «in die Wälder flohen»
—und es ist nur ein Zynismus mehr, wenn sich unser moderner Herrenchronist
(der uneheliche Abkömmling einer Fürstin von Donau-Eschingen)
über die «Mordnacht von Horw» in der Art lustig macht,
dass er behauptet, diese «bilde wohl den heitersten Punkt im ganzen
Bauernkrieg»; wobei dieser «streng wissenschaftliche Historiker» sich
ausschliesslich auf ein paar niedrige Verse aus einem Spottlied des damaligen
Luzerner Ratsherrn Konrad Sonnenberg stützen kann! Diese
Drohungen wurden selbst von dem zahmeren «Rumpfparlament» der
nicht ins Feld gezogenen Bauern, das sich in Ruswil niedergelassen
hatte, so ernst genommen, dass es sich in seinem sonst so «entgegenkommenden
» Schreiben vom Fünfzehnten an die «Ehrengesandten»
nicht enthalten konnte, als Schluss hinzuzufügen: «Da sie soeben vernommen,
dass die Luzerner viel ,Völker' (Kriegsleute) in die Stadt gezogen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 115 - arpa Themen Projekte
überfallen wollen, so erklären sie, die 10 Aemter, hiemit, dass sie diesen
Verbündeten auf erfolgte Mahnung Hülfe zugesagt haben.» Noch
zu anderem aber gab diese Panik im Amte Kriens und Horw das Signal:
sie war der unmittelbare Anlass dazu, dass die bereits in Marsch
befindliche Entlebucher Mannschaft, von den erschreckten Krienser
und Horwer Boten flehentlich gerufen, schon am Vierzehnten in Eilmärschen
über die Berge auf den Krienser Boden vormarschierte, wo
auch die von Malters und Ruswil zu ihnen stiessen und so das historische
Heerlager vor den Toren Luzerns bildeten.
Die weitaus verheissungsvollste Diversion der Luzerner Herren
und ihrer «Vermittler» aber — ausser der in Ruswil begonnenen Haupt-
und Staats-Diversion — schien die im Amt Rothenburg, wie wir wissen,
bereits am Dreizehnten ins Werk gesetzte werden zu sollen. Da
waren die an jenem Tage abgeschickten «Ehrengesandten» Imfeld,
Sidler und von Montenach mit Hülfe des Schultheissen Fleckenstein
und des Abtes Dominik von Muri so erfolgreich am Werk, dass unser
moderner Luzerner Chronist in folgender, überaus bezeichnender
Weise darüber berichten kann: «Am 14. März belebte die Regierung
von Luzern neue Hoffnung auf gütliche Beilegung des Streites. In
höchst geheimer Weise teilten einige ehrliche (!) Personen dem Rate
mit, drei ehrsame (!) Männer aus dem Amte Rothenburg hätten ihnen
eröffnet, sie wollten gern zu Gunsten ihrer lieben und werten Obrigkeit
(!) ein grosses Werk vollbringen, nämlich die ganze Grafschaft
Rothenburg von dem eingeschlagenen Wege abbringen, dieselbe bestimmen,
die Waffen nicht gegen die Obrigkeit zu wenden, sondern
sich mit ihr friedlich zu vergleichen. Erfreut über diese Zusage gelobten
Schultheiss und Rat, diese drei biderben Männer nicht nur für ihre
Bemühungen, falls das Werk gelingen sollte, zu entschädigen (!), sondern
sie und ihre Erben und Nachkommen auch an Leib, Ehre und
Gut zu schützen, wenn ihnen dieser Tat wegen irgend etwas widerfahren
sollte, auch ihre Namen geheim zu halten (!) ... Ueber den Gang
der geheimen Vermittlung sind wir nicht näher unterrichtet.» Begreiflich,
unter den eben erwähnten Bedingungen, die nur mündliche «Vermittlung»
zuliessen. Immerhin fand sich wenigstens ein Schriftstück:
es ist die Anweisung des Luzerner Rates an einen der Spione, wohl
eines der Hauptwerkzeuge der Herren «Ehrengesandten», an einen
«Leutnant Severin Felix». Dieser soll «die von Rothenburg» versichern,
«dass dieselben bei ihren alten Freiheiten, wie sie ihre Altvorderen besessen,
sollen gehandhabt werden» (d. h. nur die «Altvordern» ab 1570,
in welchem Jahr den Rothenburgern, die sich damals mutig allein
gegen die sich befestigende Selbstherrschaft der Luzerner erhoben
hatten, bereits alle wesentlichen Freiheiten geraubt worden waren!).
Ferner soll «der gütliche und rechtliche Spruch von der Obrigkeit getreulich
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 116 - arpa Themen Projekte
Punktes seitens derselben, «alle verbesserung geschächen». «Stellen
sich die Rothenburger gehorsam ein, so soll ihnen alles verziehen und
in Ewigkeit ,nit fürzogen werden'. Sie sollen auch wohl bedenken, was
ihnen geschehen könnte, ,wilen sie die ersten an dem Anbutsch'.» «Nach
Abschluss des Vertrags soll eine pergamentene besiegelte Urkunde ausgehändigt
werden», auf deren Besitz ja alle Bauern so erpicht waren.
So geringfügig war der Köder, den die Luzerner Herren den Rothenburgern
hinlegen zu können glaubten.
Nun gibt es aber in diesem subalternen Schriftstück einen Passus
von hochpolitischem Interesse. Als Anweisung dafür, was man der
«Gegenpartei», das heisst den ehrlichen Rebellen, zur Abschreckung
entgegenhalten möge, heisst es darin: «dass die Entlebucher den Rat
von Luzern nicht mehr als Obrigkeit anerkennen, auch keinen Landvogt
mehr annehmen wollen»! Das allerdings konnte bei ehrlichen Rebellen
nur das Bestreben auslösen, es den Entlebuchern gleich zu tun,
was jedoch ein Ratsgehirn ganz unmöglich zu fassen vermocht hätte!
Darum fügten die Luzerner Herren dieser Anweisung noch eine ähnlich
gescheite weitere bei: «dass dieselben (die Entlebucher) notorische
Schulden und Hypotheken nicht mehr anerkennen wollen, ,welches
von Thürken noch keiner anderen Nation niemolen ist erhört worden'...»
Kurz, es war schlechte Greuelpropaganda, was damit bezweckt
wurde. Sie hat auch bei der revolutionären Kriegspartei der
Rothenburger niemals verfangen.
Wohl aber ist als Tatsache zu erkennen, dass den Luzerner Herren
gelang, eine Sabotagepartei aus den «Linden» zu bilden, die, wenn
sie auch nicht offen hervortreten durfte, doch allerhand den Herren
nützliche Dienste leistete. So haben solche «Rothenburger» (natürlich
werden sie von den Herrenchronisten als «die» Rothenburger bezeichnet)
beispielsweise einen in diesen Tagen von der Bauernwacht in Ebikon
abgefangenen und in Eisen gelegten Boten der Luzerner Regierung
befreit und das ihm abgenommene Schreiben, ein militärisch
höchst wichtiges dringliches Hülfsgesuch des Luzerner Rates an die
Zürcher Regierung, den «Ehrengesandten», d. h. den Luzerner Herren,
ausgeliefert. «Den Bauern wurde dagegen die Versicherung gegeben,
dass die Truppen von Zürich nicht ins Gebiet von Luzern einmarschieren
sollen.» Ebensolche «Rothenburger» waren es natürlich, mit
denen «einige streitige Punkte vereinbart» werden konnten; aber selbst
mit diesen war «über die Frage betreffend die Aemterbesetzung und
Reduktion des Umgeldes... ein Ausgleich nicht möglich». Ebensolche
«Rothenburger» waren es aber erst recht, von denen wenige Tage
später «ein Schreiben einlief, unterzeichnet von Hauptmann und gemeinen
Offizieren des Amtes Rothenburg» (ohne Namensangaben!):
«wenn die Urkunden ,in die leere Amtsthruken' gelegt seien, wollen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 117 - arpa Themen Projekte
erzeigen»! Wer aber wohl als treibende Kraft hinter dieser «Verhandlungspartei»
stak, das ist vermutlich — trotz seines kriegerischen Getues
als «Oberst» der Rothenburger — der schlaue Kaspar Steiner von
Emmen. Denn von ihm kann der Pater Placidus am Siebzehnten aus
Ruswil an den Schultheiss Dulliker berichten —, mit ihm seien «direkte
Verhandlungen» eröffnet worden! Kaspar Steiner schlage vor: «bei den
Aemterbesetzungen soll das Amt je zwei, der Landvogt einen dritten
Kandidaten vorschlagen und dann das Amt die Wahl haben». Das
aber war zu diesem Zeitpunkt bereits die halbe Kapitulation... Sofort
wurde denn auch — von welcher Seite, ist klar — das Gerücht im
ganzen Land ausgestreut: Rothenburg habe sich bereits unterworfen!
Nun muss aber, um der historischen Gerechtigkeit willen, auch
von der Tätigkeit der anderen Rothenburger die Rede sein, von den
ehrlichen Rebellen. Als diese die zersetzende Wirksamkeit der «Ehrengesandtschaft»,
welcher auch der Zuger Ammann Sidler angehörte. in
ihrem Amt bemerkten, rafften sie sich sofort, schon am Vierzehnten,
zu einer Gegenaktion auf. Sie wussten dank ihrer intimen Nachbarschaft
zu den Zuger Bauern genau. dass die beiden herrenfreundlichen
Anführer der Zugerdelegation in der «Vermittlung» der Urkantone.
Sidler und Zur Lauben, nicht den Willen des Zuger Volkes ausdrückten;
ja, dass es sogar im Zuger Rat eine starke bauernfreundliche Minderheit
gab. Darum schickten sie an diesem Tag eine dringende Botschaft
nach Zug und ersuchten diesen Stand, sie bei ihrem alten Recht,
freie Amtsgemeinden abzuhalten, zu schützen. Zugleich baten sie die
Zuger eindringlich, die einseitig herrenfreundliche Zugerdelegation in
dem Sinne zu korrigieren, dass sie unverzüglich auch bauernfreundliche
Männer in die «Vermittlung» delegierten, und natürlich wussten
sie, wer dafür in Frage kam. Sie drangen damit beim Rate durch, und
dieser sandte am Sechzehnten den Altlandammann Peter Trinkler von
Menzingen, sowie den Bauherrn Johann Stöckli als ergänzende «Ehrengesandte»
nach Ruswil und Rothenburg. Im Begleitschreiben an die
Rothenburger wurden diese beiden ausdrücklich als bevollmächtigte
«Schidherrn» bezeichnet. Ausserdem schrieben «Stadt und Amt Zug»
den Rothenburgern: «in Folge des Begehrens um Trost, Rat und Hilfe
sende man diese beiden Herren». Damit war in der Tat, wie selbst der
herrenfreundliche moderne Luzerner Chronist sagt, «eine indirekte
Anerkennung des Bauernbundes ausgesprochen». Und auch darin hat
dieser Herrenchronist recht, wenn er behauptet, dass «durch diesen
Gegenzug der Kriegspartei», das heisst durch die von ihr durchgesetzte
Berufung Peter Trinklers, «der Gang der Unterhandlungen» (will sagen:
die Sabotage!) «gehindert» wurde, ja, dass «damit die Aussicht
auf eine gütliche Vereinigung vernichtet war».
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 118 - arpa Themen Projekte
Denn Peter Trinkler war wahrlich kein Lauer und kein «Linder»
—im Gegensatz zu seinem Mitgesandten, dem Bauherrn Stöckli, der
«auf geschehene Vorstellungen» sofort den Hasenstrich nahm und von
Ruswil nach Zug zurückkehrte. «Er aber blieb» — wie der Domdekan
Vock berichtet — «den Vermittlern zum Aerger und Trotz, und begann
sein demagogisches (!) Spiel. Er mischte sich» (man denke sich!) «unter
die Ausschüsse der Bauern, trank mit ihnen im Wirtshaus zur Linde
und bearbeitete sie mit grosser Tätigkeit. Er erklärte ihnen, dass er
von seiner Regierung Gewalt habe, ihre Streitigkeiten auszumachen und
ermahnte sie, sich in keine gütliche Vermittlung einzulassen, sondern
die parteiischen Gesandten abzuschaffen oder sie, zu schneller Beendigung
des Handels, in Arrest zu setzen»! «Welches die Bauern gegen die
Herren sehr ungeduldig machte», wie es in einer Beschwerdeschrift
der Herren «Vermittler» über Ammann Trinklers «Umtriebe» an die
Tagsatzung sehr glaubhaft heisst. In Rothenburg aber, wo Trinkler
am Siebzehnten gewiss nicht ohne Absicht mit den schärfsten Bauernführern
des Willisauer Amtes, mit Jakob Sinner, Fridli Bucher und
Kaspar Bircher, zusammentraf, soll er zu diesen gesagt haben: «diese
Ehrensätze kosten viel und die Sache gehe langsam, besser wäre eine
andere Komposition des Schiedsgerichtes, die Herrn und Bauern sollten
je einen Herrn und einen unparteiischen Bauern ins Schiedsgericht
erwählen».
Etliches zu der «Ungeduld» der Bauern trug auch Trinklers Amtsdiener,
der Weibel Stöcklin bei, der in der Beschwerdeschrift der
«Ehrengesandten» an die Tagsatzung eine Hauptrolle spielt und darin
ja wohl kaum mit dem so willigen Bauherrn Stöckli verwechselt worden
ist; denn diese Schrift ist auf Betreiben von genauen Kennern der
persönlichen Verhältnisse, von Trinklers Zuger Rivalen Zur Lauben
und Sidler, abgefasst worden. Darin heisst es u. a.: «Unterweibel Stöcklin,
Ammann Trinklers Diener, hat seines Herrn Instruktion den Bauern
zu Russwil öffentlich an dem Tische vorgelesen, das Siegel daran
gezeigt und geredet, ihn bedünke, dass die Gesandten, in förderlicher
Usmachung der Sache, ihre Ehre und ihren Eid schlecht betrachten
und sie werden wenig Ehre davon tragen, besonders Landammann
Zweyer und Ammann Zurlauben.» Und dafür werden in der Schrift
dieser «ehrengesandtlichen» «Dätschmäuler» drei verhörte Zeugen aufgeführt.
«Item hat Weibel Stöcklin die Bauern gestärkt, sie sollen nicht
aus dem Felde ziehen, sie haben denn sechs Siegel (der sechs katholischen
Orte) und den Leodegari (Luzerns Staatssiegel) in Mitte des Briefs
erhalten und in Händen.» (Zwei verhörte Zeugen.) «Item hat Weibe!
Stöcklin geredet: ,Luzern, das Licht, habe einen Kolben bekommen,
und die Bauern wollen denselben mit Knütteln abbrechen'.» (Ein verhörter
Zeuge.) Dieser Ausspruch ist unter den Bauern zum geflügelten
Wort geworden. Aber auch ein Ausspruch Peter Trinklers selbst, der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 119 - arpa Themen Projekte
abtanzen»!
Kurz und gut: diese beiden Männer scheinen, trotz ihrem amtlichen
Herr-und-Diener-Verhältnis, auf echt demokratisch freundschaftlichem
Fusse zu einander und zum Volke gestanden und beide das Herz
auf dem rechten Fleck gehabt zu haben. Sie zogen beide kräftig am
gleichen Seil, an dem der Bauernsache, und trugen volkstümlich klare
Losungen von politischer Schlagkraft in die Masse. Grund genug, dass
sie damals wie heute von allen Herrenchronisten gehasst und verlästert
worden sind. Dies umsomehr, als Peter Trinkler — wie amtliche
Verhörprotokolle aus den späteren Kriegsgerichten beweisen —
seiner politischen Ueberzeugung auch nach der Niederlage unerschütterlich
treu geblieben ist, zu einer Zeit, als es ringsum von Verrat, Angebereien
und unterwürfiger Aemtlihascherei grausig wimmelte...
Während jedoch der zähe und tapfere Zuger Altlandammann, als
der einzige von allen Herren, die Verteidigung des Rechts der Bauern
an die Hand nahm; während es Peter Trinkler gelang, dem Schultheiss
Fleckenstein, dem Abt von Muri und den übrigen «Ehrengesandten»
das Amt Rothenburg wieder aus den heuchlerisch behandschuhten
Würgerhänden zu winden und damit auch den Lauen und «Linden»
in den Bauernausschüssen den Rücken wieder zu härten: währenddessen
entfesselte der Luzerner Rat, treulich sekundiert von den «Ehrengesandten»,
im ganzen Schweizerland herum eine Greuellügenpropaganda
gegen seine eigenen «Untertanen» von einem Ausmass und
einer Wildheit, wie sie die Annalen der Schweizergeschichte bis dahin
noch nie entfernt ähnlich zu verzeichnen hatten. Die ganze schlotternde
Angst und Feigheit der Luzerner Herren vor dem scheinbar unaufhaltsam
nahenden Gericht der Bauernlawine flüchtete sich in ein
wahres Zetermordio-Hülfsgeschrei an sämtliche anderen Herren der
Schweiz. Dieses Geschrei lieferte der Tagsatzung den Wind, aus dem
diese Herrenzentrale im Kompressor ihrer Beschlüsse den Sturm erst
fabrizierte, der aus dem luzernischen schliesslich einen gemeineidgenössischen
Aufruhr machte. Denn erst der Volkszorn über diese Beschlüsse
hat in der Folge den überall ringsum, im Emmental und im
Oberland, im Oberaargau und in der Grafschaft Lenzburg, in den
Freien Aemtern, im Kanton Solothurn und im Baselland herumliegenden
Zündstoff zur gemeinsamen Flamme angefacht. Und dies gerade
in dem Augenblick, als das Feuer im Luzernischen selbst bereits endgültig
in sich zusammenzubrechen schien; gerade zeitig genug jedoch,
um es wieder in den allgemeinen Brand mit emporzureissen...
Doch eilen wir nicht zu weit voraus und versuchen wir den praktischen
Zweck des allgemeinen «Landgeschreis» zu erfassen, das der
Luzerner Rat gerade in dem Augenblick im Rücken seiner angeblichen
Vertragspartner erhob, als er den Bauern und der ganzen Welt vormachte,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 120 - arpa Themen Projekte
zur Selbstäusserung grossmütigen Frieden angeboten zu haben. Bereits
in der Nacht vom 13. auf den 14. März nämlich hatten sich Schultheiss,
Rat und Hundert in gewaltiger Aufregung versammelt. Um zwei
Uhr früh ward ein «offenes Mahnschreiben» an Zürich als Vorort der
eidgenössischen Tagsatzung beschlossen und schon in den ersten Morgenstunden
durch rettenden Boten nach Zürich gesandt. Darin wurde
nicht etwa um sofortige Einsetzung der Tagsatzung als wirkliches eidgenössisches
Schiedsgericht ersucht, vor dem beide streitenden Parteien
auf Gleich und Gleich ihr Recht auszufechten hätten. Vielmehr
wurde die Sache der Bauern als eine von vornherein gerichtete behandelt.
Die Luzerner Herrenpartei ist als von Gott eingesetzte Obrigkeit
ganz selbstverständlich der allein berufene Richter, und das Einverständnis
der Zürcher Herren sowie der Tagsatzung wird ebenso selbstverständlich
vorausgesetzt, und sie werden nur — in Ermangelung
eigener Truppen — flehentlich um unverzügliche Exekution der Sünder
gebeten.
Und zwar geschieht das so: die Luzerner Herren geben «unsern
guten, lieben, alten Eidgenossen des löbl. Vororts höchst schmerzlich
zu vernehmen, was Gestalt dieser Zeit unsere, in der Rebellion vertiefte
Unterthanen in ihrer Bosheit (!) so weit gewachsen und geraten,
dass sie nicht allein der Pflicht, Treue, Gehorsam und Untertänigkeit
gegen Uns, als ihre natürliche und von Gott geordnete Obrigkeit, entschlossen»,
nicht allein «unsere ihnen im höchsten Grad anerbotenen»,
durch die «ansehnlichen Herren Ehrengesandten zu Werk gesetzten
und wohl versicherten Gnaden (!) spöttisch verworfen, sondern auch
die Wehr wirklich wider Uns und unsere Hoheit ergriffen, und jetzt
sogar die Herren Ehrengesandten in Arrest, ohne alle Ursache, genommen»
— welch letzteres eine Lüge ist, da, wie schon Vock nachgewiesen
hat, die «Ehrengesandten» nur mit Verhaftung bedroht worden
waren, und zwar für den Fall, dass sie wirklich hinter dem Rücken
der Bauern die Hand dazu bieten sollten, diese durch fremde Truppen
abschlachten zu lassen! Dann geht es weiter: die Herrn von Zürich
möchten doch ja um Gotteswillen die Herren von Luzern «durch
Euern, wie auch anderer löbl. Orte männlichen Beistand vor dieser
unrechten, der Natur und allen Völkerrechten (!) widerstrebenden Gewalt,
Drang und Unfall retten»! Und zwar, um «den bisher mit einander
genossenen Frieden und souveränen Stand... fürbass zu behalten
und zu erhalten» und um «die Gegenwehr gegen diese Feinde und
Zerstörer der allgemeinen Ruhe.., desto ernstlicher wenden» zu können,
«so bitten und vermahnen wir Euch, unsere G (etreuen) L (jeden)
A(lten) Eidgenossen, bei Eurer höchsten Treue, Ehre und Eiden,
Uns... sonderlich in Kraft unserer zusammenhabenden geschworenen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 121 - arpa Themen Projekte
ganz eilend mit einer wirklichen Macht zu folgen, und Uns... in dieser
Noth nicht zu lassen, sondern tröstlich, tapfer und herzhaft beizuspringen.
Unterdessen wolle Gott uns mit seiner Allmacht stärken! —
Datum und mit unserer Stadt gewöhnlichem Sekretinsiegel verwahrt
den 14. März um 2 Uhr 1653.» Zugleich wurde um schnelle Mitteilung
dieses Mahnbriefs an alle eidgenössischen und zugewandten Orte gebeten.
So liess denn Zürich in der Tat, ohne die auf den 18. März angesetzte
Tagsatzung abzuwarten, noch am Abend des Vierzehnten
«durch reitende Boten die Waffenmacht gesammter Eidgenossenschaft
aufbieten, und nach einigen Tagen begannen überall kriegerische Zurüstungen».
Es versteht sich nunmehr nachgerade von selbst, dass die «Ehrengesandten»,
die just vom 14. auf den 15. März wieder vollzählig in Luzern
versammelt waren, den Schritt des Luzerner Rates beim Vorort
Zürich unverzüglich, bevor sie «auf den heutigen Tag (den 15.) wieder
ins Land hinausreiten» — nämlich nach Ruswil, um dort den «Rechtlichen
Spruch» mit den Bauern zu verhandeln —, auf das nachdrücklichste
unterstützten. Sie schickten «an den Vorort und die eidgenössischen
Stände» ein sehr schlecht geschriebenes, ausführliches «Memoriale»
(Denkschrift), in dem sie sich u. a. lebhaft beklagen, dass sich
die Bauern «nicht gütlich weisen lassen (!) wollten»; «dass sie bei
ihrem vermeinten Bund und Eidschwur zu bleiben und die prätendierten
Artikel dadurch zu erhalten gedenken»; dass sie «sich nicht sättigen
wollten, sondern andere Mitinteressierte und, wie sie es nennen,
ihre Bundsgenossen zu gleichem Auszug verleiteten», wie die Entlebucher,
die «gerad urplötzlich mit Wehr und Waffen und offenen Fahnen
aufgebrochen sind». Im übrigen ist dieses Schreiben der «Ehrengesandten»
in einem nicht ganz so hetzerischen Ton abgefasst wie das
des Luzerner Rats, obwohl es zwar ebenfalls von zu befürchtenden
«wirklichen Attentaten zu weiterem Unfrieden und Unruh» redet und
in der Versicherung gipfelt: das von den Urkantonen und sonst für die
Stadt Luzern aufgebotene «Volk» (Kriegsvolk) sei zu nichts anderem
da, «als gegen widerrechtliche und gewalttätige Anfechtung gegen die
Stadt zu verwahren»!
Dies alles ist jedoch nichts als ein sanftes Vorspiel zu der geradezu
ungeheuerlichen Flucht in die breiteste Oeffentlichkeit, die der Rat
mit seinem berüchtigten, am 16. März als Flugblatt publizierten «Manifest»
vollzog, ein Hetzschreiben der Regierung gegen das eigene Volk,
mit dem für die Ehre der Herren nicht viel Staat zu machen ist und
das darum der moderne Luzerner Herrenchronist, der sonst sogut wie
alles im Wortlaut wiedergibt, mit zwei Sätzen erwähnt und sonst wortlos
unter den Tisch fallen lässt. Grund genug für uns, uns dieses
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 122 - arpa Themen Projekte
«Wir... (etc. pp.) tun kund und zu wissen Männiglichem, an was End
und Ort, sowohl inner unserer angehörigen Landschaft als ausserhalb
derselben, wohin dieser gegenwärtige Bericht und Manifest kommen
und gelangen wird»! Was tun die Luzerner Herren darin zu kund und
zu wissen? Sie hetzen mit einer Flut von Lügen und Verleumdungen
die ganze Eidgenossenschaft gegen die Bauern auf, um auf den Wogen
der so erzeugten «Empörung» eine umfassende Kriegsaktion möglichst
des ganzen Schweizervolkes für die Rettung der Herrenprivilegien, das
heisst für die Aufrechterhaltung und Neubefestigung der bestehenden
Sklaverei des Volkes, zu erzielen! Darum wollen diese Aristokraten
auffallenderweise einmal «insonderheit bei dem gemeinen, einfältigen
Mann» im ganzen Schweizerland Gehör finden.
Wir wollen es uns versagen, die elf Buch seiten langen Heucheleien
der Herren und die lange Liste der bäuerlichen «Verbrechen» zu
rekapitulieren. Unter den ersteren ist nur die geschichtsnotorische
Lüge bemerkenswert, dass nicht durch sie, die Luzerner Herren, die
«Ehrengesandten» der vier Urkantone sowie Freiburgs und Solothurns
aufgeboten worden seien, sondern dass diese allein «durch das gemeine
Landgeschrei und sonst berichtet wurden», «ihre ansehnlichen
Rathsbotschaften ungesäumt in diese Unsere Stadt abzufertigen»! Auch
ist die Versicherung der Luzerner Herren possierlich, sie seien bestrebt
gewesen, die «Ehrengesandten» «von der ersten Urhebe dannen bis auf
Jetzt gegenwärtigen Kurs ganz unpassioniert zu berichten»! Unter den
«Verbrechen» der Bauern aber figurieren so schwerwiegende wie: dass
sie «hin und her anfingen, sich anzuhängen, Punkte und Beschwerden
anzufüllen»; sowie die «allein zum Schein gebrauchte Untertänigkeit».
trauliche Gespräche zu pflegen»; dass sie «freien Willens und wider
altes Herkommen (!) Versammlungen gehalten»; dass «ein jeder nachtrachte,
Uns mit gemeinen und besonderen Beschwernissen die Ohren
anzufühlen»; sowie die «allein zum Schein gebrauchte Untertänigkeit».
Wir ersparen es uns auch, die Lamentationen der Herren über den
«mit aller Unform und Hinansetzung des Uns schuldigen Respekts und
Gehorsams gestifteten Wolhuser Bund wiederzugeben und notieren nur
gebührend, dass «diese weit aussehenden Punkte sammt der Form, Uns
Maass und Regel vorzuschreiben, Uns nicht unbillig zu Gemüths ging».
Das Sendschreiben der Luzerner Herren «an Alle» gipfelt selbst
in 16 Punkten von denen wir zur Veranschaulichung der Kultur dieser
Herren nur die beiden letzten wiedergeben wollen. Sie sind weit weniger
«weit aussehend» als die Punkte der Bauern, dafür aber umso aufschlussreicher
für die Psychologie der eben auf den Gipfel ihrer Macht
strebenden Schweizeraristokratie der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die
beiden Punkte lauten in ihren Kernpartieen:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 123 - arpa Themen Projekte
Punkt 15: « . . . . und da Wir nun aus diesem allem, und was weiteres
dabei eingelaufen, handgreiflich verspüren und erfahren müssen, dass
durch solche Gewalt und Feindthätlichkeiten unserer eigenen angehörigen
Unterthanen Wir an unserer Ehre, Hoheit, Freiheiten und Gerechtigkeiten,
wider Gott, Recht und alle Billigkeit. angetastet. betrübt
und beschädigt, und damit sogar in höchste Gefahr ferner zu erwartenden
Uebels, wie auch eine gesammte löbl. Eidgenossenschaft in
Wehr und Waffen zu bringen, gesetzt werden, — so haben Wir, aus
Noth gedrungen. . . » (eben gerüstet und die Truppen der vier «Vermittler»-Kantone
in die Stadt genommen und erklären, dass Wir) «...
hiemit vor Gott, unserm Schöpfer, und der ganzen ehrbaren Welt in
bester und kräftigster Form protestirt haben wollen, an dieser Weit.
läufigkeit, Unruh' und Empörung, auch an allem dem Unheil, Aufruhr
und Unglück, so weiters daraus entstehen und herrühren möchte,
keine Schuld noch Ursache zu tragen, sondern wir überlassen es
denjenigen zu verantworten, die diesen bösen Willen in ihren untreuen
Herzen empfangen und von demselben auf andere ausgegossen haben,
dass also letztlich dieses elende Wesen daraus entstand»!
Punkt 16: «Was aber dieser unserer Meinung. wie sie oben erläutert
ist, zuwider und entgegen bei Vielen oder Geringen, Hohen und Niedern
hin und her möchte ausgegeben, in die Ohren geblasen, oder ausgebreitet
worden sein, widersprechen Wir, dass Alles faul, falsch, erdichtet
und unwahrhaft sei, und dass Uns damit Gewalt, zu kurz und
Unrecht beschehe, und, dass unsere Erklärung die pure und lautere
Wahrheit sei, nehmen 'Wir über Uns, vor dem strengen Richterstuhl Gottes
in jener Welt zu verantworten; Der wolle die so hart verstockten Gemüther
mit den Augen seiner grundlosen Barmherzigkeit ansehen,
durch solche Gnadenstralen erleuchten, und zu wahrer Erkenntnis
ihres schuldigen Gehorsams bringen, dass also Wir auf solches wieder
zu langwierigem, friedlichem, freiem und ruhigem Wohlstande befreulich
gelangen mögen, Amen.»
Dies also ist der Schuss in den Rücken des angeblichen Verhandlungspartners,
den man währenddessen in Ruswil mit «Verhandlungen»
über den «Rechtlichen Spruch» hinhielt. Dieses «Manifest» ist so
ziemlich der schamloseste Verrat, der zwischen einer Regierung und
einem Volk überhaupt begangen werden kann; um mit den gegen die
Bauern gerichteten Worten der Luzerner Regierung zu sprechen: «dass
von einem offenen und erklärten Feinde nicht wohl Aergeres folgen
und beschehen könnte»!
Inzwischen war es den Luzerner Herren — trotz der «Einschliessung»
der Stadt durch die Bauern —gelungen, etwa tausend Mann in
die Stadt zu ziehen. Ferner war inzwischen eine feste Zusage des Landvogts
Leopold Feer im Rheintal eingegangen, «600 Mann Luzern zuzuführen»;
er «hoffe auch auf Hülfe von Seite des Grafen von Hohen-Ems
und des Gubernators in Bregenz» (also von ausländischen Feudalherren!).
Ebenso wusste man seit dem Fünfzehnten in Luzern, dass
«1000 Thurgauer kriegsbereit» gemacht seien. Der Landvogt Jost am
Rhyn allerdings musste aus der Grafschaft Baden berichten, dass zwar
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 124 - arpa Themen Projekte
(!) sei. Denn es wolle zuerst wissen, ob die Bauern oder die Obrigkeit
Recht habe»! Dafür konnte andererseits der Landvogt Peter Zelger
«aus Lauis» melden, «dass Luzern über 400 gut bewaffnete Leute aus
seiner Landvogtei verfügen könne». Auch vom Urner Landvogt Bässler
in Locarno kam etwas später die Zusage aus seiner Landvogtei.
Der Rat von Bremgarten meldete am Sechzehnten, «dass 100 Mann aus
den Freien Aemtern nach Luzern marschieren». Aber auch hier war
«die Stimmung für die Stadt an den meisten Orten keineswegs günstig»,
was schon aus der geringen Zahl des Zuzugs aus diesen volkreichen
Aemtern hervorgeht. Die Bauern seien bereits «eingeschüchert» —d. h.
sie gehorchten den Parolen ihrer Klassengenossen in den luzernischen
Aemtern — und sie «wagten nicht, die Befehle der Obrigkeit auszuführen».
Gewissermassen zwischen zwei Feuern fasste eine Amtsgemeinde
in Hitzkirch am Sechzehnten «nach vollendetem Gottesdienst»
den Beschluss, «weder der Regierung von Luzern, noch den Unterthanen
derselben Hülfe zu leisten, sondern bis auf weiteren Bescheid
zu Hause zu bleiben», womit jedenfalls eher den Bauern als den Herren
gedient war. Das geht auch daraus hervor, dass Freiämter-Bauern
auch in ihrem Gebiet Boten nach Luzern, wie z. B. den des Stiftes
Münster, abfingen «und sie untersuchten bis aufs Hemd»! Dagegen
erklärte die Pfarrei Villmergen «mit einhelligem Mehr, dass sie einem
Hülfsbegehren der vier unpartheiischen katholischen Orte Folge leisten
werde».
Schon auf den Notschrei des Luzerner Rates an den der Zürcher
vom Vierzehnten hatte dieser das Hülfsgesuch der Luzerner Herren,
noch am selben Tag abends 10 Uhr, durch reitende Boten an die Räte
von Basel, Bern, Freiburg, Solothurn und St. Gallen weiterspediert, und
Basel «ersuchte am 15. März den Rat von Mülhausen, mit Rücksicht
auf die rasche Ausdehnung des Aufstandes 60 oder 80 Mann zu werben».
Sodann sandte der Zürcher Rat zwei seiner Ratsherren den
Statthalter Salomon Hirzel und den Bergherr Johann Heinrich Lochmann,
eiligst nach Luzern. Sie sollten sich erstens darüber vergewissern,
«dass der Streit nicht im Mindesten mit der Religion irgendwie
zusammenhänge», was denn auch nicht schwer war. Zweitens sollten
sie sich genau über den Stand der Verteidigung erkundigen. Ihnen
schien die Stadt «in gutem Stande, so dass eine Verteidigung wohl
möglich sei»; sie erklärten aber auch, dass «die Rebellen auch gute
Ordnung halten, ziemlich gut verfasst sind, Kriegserfahrene unter sich
haben und die meisten Pässe in ihre Gewalt gebracht haben». Dieses Urteil
ist umso interessanter, als dieselben Gesandten auf ihrem Hinweg
nach Luzern von den Bauerntruppen zu Root und Ebikon «einige Stunden
lang aufgehalten» und angeblich auch «mit Worten und Werken
beschimpft» worden waren. Sie selber allerdings berichteten dem Zürcher
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 125 - arpa Themen Projekte
jedoch um Geduld und ein wenig ze warten gebetten worden» seien.
Aber militärische Sachverständige waren die beiden Zürcher Ratsherren
offensichtlich nicht.
Trotz all der Vorkehren herrschten in Luzern noch am Sechzehnten,
an demselben Tag, als der Rat in seinem «Manifest» Feuer und
Galle über die Bauern in die Welt spie, «eine deprimierte Stimmung»,
von der der moderne katholische Herrenchronist als besonders charakteristisches
Zeichen meldet, dass ihr «auch der sonst so lebhafte Kapuziner
Pater Placidus» (der «Eidgenosse» aus Freiburg im Breisgau)
«sich nicht entziehen konnte, als er am 16. März bei Franziskanern die
Anrede an die Truppen halten musste».
Offensichtlich von dem in Luzern herrschenden Defaitismus —
von dem anscheinend nur die Bauern nichts merkten — unterrichtet,
schrieb Oberst Zwyer noch am selben Tag abends um 11 Uhr aus Ruswil
einen aufmunternden Bericht an den Luzerner Rat, und zwar in
italienischer Sprache; denn jetzt geschah es Tag für Tag, dass die
Bauern Briefe der Herren abfingen, sie lasen und sie manchmal sogar
— wenn auch mit etlicher Verspätung — treuherzig an die Herren
weiterspedierten! Denn mit «welscher» Korrespondenz, ob nun italienisch
oder französisch, «wussten die Bauern und ihre Ratgeber geistlichen
und weltlichen Standes... doch nicht viel anzufangen». Und:
was der Bauer nicht weiss, macht ihm nicht heiss..
Item, in diesem italienischen Bericht des österreichischen Feldmarschalls
Zwyer an die Luzerner Herren kommt nun ein wirklicher
militärischer Sachverständiger zu Worte, der ihnen besser als die Zürcher
Ratsherren den Kriegsmut wieder zu heben vermochte. Dies umsomehr,
als der Herr «Vermittler» und Feldmarschall nun selber
kriegslustig wurde. Er berichtet, dass soeben «1200 Mann aus der
Landvogtei Willisau über Sursee nach Rothenburg marschiert seien:
aber alles sei in Konfusion und für Verpflegung der Truppen sei nicht
gesorgt, sodass diese bald Hunger leiden müssen». Sodann gibt er
diplomatisch-politische Ratschläge: «Wenn es gelinge, die Entlebucher
und Willisauer zufrieden zu stellen, dann werden die andern kleinen
Vogteien sich bald fügen. Die Stadt soll also den Schiedsrichtern Vollmacht
geben, mit diesen beiden Aemtern eine Vereinbarung zu treffen;
dann seien die Bauern auch gezwungen, eine ähnliche Vollmacht auszustellen.
Denn er sei fest überzeugt, dass die Bauern im Grunde durchaus
nicht den Krieg wollen — sonst würden sie nicht in einem fort auf
baldige Beendigung der Verhandlungen dringen. Die Obrigkeit habe
hiedurch noch Zeit zu Rüstungen gewonnen. Gelinge ihr nur ein
Streich, so sei sie Sieger. Lieber wollte er mit dem Schwerte in der
Hand den Bauern entgegen treten, als hier sich von diesen injurieren
lassen»!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 126 - arpa Themen Projekte
Das muss man sagen: dieser «Friedensvermittler» hat sich endlich
selbst die Maske vom Gesicht gerissen und offen den Kriegsmann gezeigt.
Aber «offen» war seine Sprache nur den Herren gegenüber, die
ohnehin wussten, wen sie an ihm hatten. Die Bauern aber wollte er
mittels ihrer ihm sehr genau bekannten Schwächen, insbesondere
ihrer Friedensliebe, solange an der Nase herumführen, bis die Rüstungen
der Herren ihm hinreichend erschienen, um einen «Streich» zu führen
und «Sieger» zu sein!
Dieser Brief Zwyers versetzt uns zugleich wieder mitten in die «Verhandlungen»
der Herren mit dem «Rumpfparlament» in Ruswil. Er
gibt die denkbar wünschenswerteste Klarheit über den Geist des Volksverrats,
in dem diese Haupt- und Staatsdiversion seitens der «Ehrengesandten»
geführt wurde. Die beiden Hauptämter, Entlebuch und Willisau,
die selbst in diesem «Rumpfparlament» die Hauptburgen der
Bauernrevolution blieben, sollten durch verlockende Angebote zum
Bruch des beschworenen Bundes verführt werden. «Divide et impera»
war wieder die Losung. So bot der Rat von Luzern, «um die Aussöhnung
zu erleichtern», der Stadt Willisau «die freie Wahl des Stadtschreibers,
Schultheissen und Grossweibels» an, «wenn der Spruch sofort
angenommen werde». Die Stadt Willisau aber hielt über diese
Frage am Siebzehnten eine Gemeinde ab, die einmütig beschloss, die
Aemterbesetzung dürfe überhaupt «nicht dem rechtlichen Spruche
unterstellt» werden. Dawider erhoben sich jedoch die Hochdorfer und
forderten: «das Schiedsgericht solle alle Klagen rechtlich entscheiden».
Da dieselbe Willisauer Gemeinde auch beschlossen hatte, «dass der
Landvogt niemals in der Stadt Willisau wohnen dürfe», zog der Luzerner
Rat sein Angebot an die Willisauer Bürger unverzüglich wieder
zurück. Und mit diesem ganzen Handel war es den «Schiedsrichtern»
gelungen, einen gefährlichen Keil in eine der Hochburgen zu treiben!
Ja, es fanden sich sogar ein paar wenige Willisauer Bürger, so
Hans Georg Barth, der einzige bürgerliche «Kapitän-Lieutenant» der
Willisauer Kriegsmacht, sowie der Statthalter Ulrich Gut — und als
Mitverräter auch einer aus Ruswil —, die hinter dem Rücken ihrer
Kampfgenossen noch am Siebzehnten zum Rat nach Luzern liefen
und diesem «goldene Berge versprachen»: «wenn nämlich die Wahl
des Stadtschreibers und Grossweibels» (vom Schultheissen ist nicht
mehr die Rede) «der Bürgerschaft in Willisau überlassen werde, so sei
der ganze Handel beigelegt und das Volk (die Truppen der Willisauer,
aber auch der Ruswiler) in Horw und bei der Gislikoner Brücke werde
sofort abgeführt»! Der Rat jedoch willigte jetzt nur noch in die freie
Wahl des Stadtschreibers ein, «behielt sich aber die Bestätigung vor
und gab den drei Gesandten (!) eine Urkunde hierüber». Selbst, für
einen derart entwerteten Preis ritten diese, in Begleitung des «Stadtreiters»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 127 - arpa Themen Projekte
Sabotage zu vollenden, die sie für einen immerhin höheren Preis versprochen
hatten. Aber siehe da: am «gemeinen Mann» aus dem Volke
scheiterte der ganze teuflische Plan! «Die dortigen Truppen erklärten,
gleich den Entlebuchern und Rothenburgern, dass sie nicht abziehen,
bis sie eine besiegelte Urkunde über die ganze Friedensverhandlung
haben»! Das Volk der Willisauer Bürger und Bauern war, wie
das der Ruswiler, der Entlebucher und der Rothenburger, um keinen
Preis meineidig und bundesbrüchig zu machen. Im Gegenteil: «die
Truppen an diesen Orten erhielten gerade jetzt wieder Verstärkungen,
und neue Truppen zogen gegen den Stutz und nach Tripschen».
Dagegen ist am gleichen Tag dem Zusammenwirken der «Ehrengesandten»
in Ruswil und einiger Landvögte, die bei den Amtsleuten
für den Fall eines Sonderfriedens die hohe Gunst der Luzerner Herren
anzupreisen hatten, ein ähnliches Manöver dem Amt Malters gegenüber
geglückt. «Denn am 17. März erklärte sich das Amt Malters»
(d. h. seine «Vertreter» im «Rumpfparlament» von Ruswil) «mit der
Gewährung der 4 Artikel befriedigt» (vier! von vielleicht sechs- oder
achtmal soviel!). Und noch am gleichen Tag «räumten die Truppen
von Malters das Feld» bei Kriens! Noch am selben Tag aber wurden
sie durch Rothenburger ersetzt, die von den Kriensern sofort herbeigerufen
worden waren...
Was das Verhalten der Entlebucher mitten in diesem Wirbel von
Verratsaktionen, mit denen das Land überschwemmt wurde, betrifft,
so ist es noch heute mit dunklen Rätseln umgeben. Das Rätselhafteste
daran ist, dass während der ganzen Ruswiler Verhandlung, ja auch
während der ganzen «Belagerung» von Luzern niemals der Name des
Pannermeisters Hans Emmenegger und niemals derjenige des Bundeskanzlers
Johann Jakob Müller genannt wird! Das wird wohl zu einem
guten Teil auf die besondere Abneigung der zeitgenössischen wie der
späteren Herrenchronisten gegen diese beiden Männer wie gegen die
Entlebucher überhaupt, zurückzuführen sein. Dafür tauchen andere
bekannte Namen in dem höchst verdächtigen Licht ihrer Gunst auf,
das vielleicht sogar absichtlich auf sie gerichtet worden sein mag, um
auch die Geschichtschreibung noch in ihrer revolutionierenden Wirkung
zu zersetzen. So wird von den Ruswiler Verhandlungen nur berichtet:
«die Entlebucher» — welche Entlebucher? — «versprachen
zwar, bei ihren Leuten für die Annahme des Vergleichs zu wirken».
(Es werden solche gewesen sein wie die heimlich nach Luzern gelaufenen
drei Willisauer.) Unser Herrenchronist, der dies berichtet, muss
jedoch sofort hinzufügen: «sie hatten aber schlechte Hoffnung, die
Leute aus dem Felde heimzubringen (!), da die Begehren wegen Vergütung
der Kosten, Appellation und Umgeld nicht acceptiert wurden».
Als ob nicht weit wichtigere Gründe die Entlebucher hätten veranlassen
können, im Felde zu bleiben!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 128 - arpa Themen Projekte
Niklaus Leuenberger
als Gefangener im Berner "Mörderkasten"
Die Berner Regierung hat dem im "Mörderkasten"angeschmiedeten
"Hochverräter' den Bart, den Stolz und das Ehrenzeichen
des damaligen Bauern, abnehmen lassen.
Nach einem zeitgenössischen Originalstich in der Landesbibliothek
in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 128 - arpa Themen Projekte
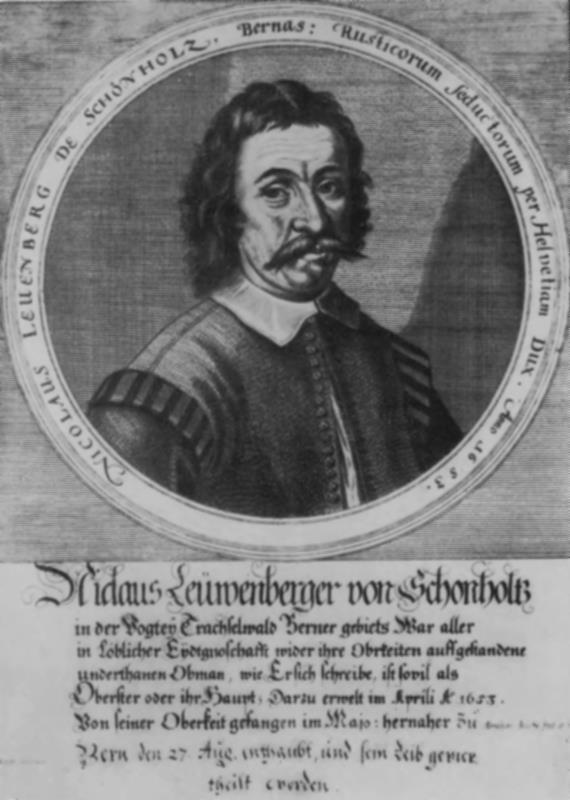
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 129 - arpa Themen Projekte
Gerade von den Entlebuchern aber, die im Felde standen, werden
höchst merkwürdige Dinge berichtet. So sollen der Landeshauptmann
Nikolaus Glanzmann und der Landesfähnrich Nikolaus Portmann aus
dem Feldlager bei Kriens «an Schultheiss und Rat von Luzern' geschrieben
haben: «sie beabsichtigen nichts Feindseliges gegen die
Stadt (!), sondern erwarten hier ruhig den Spruch der Schiedsrichter
(!); wenn dagegen die Luzerner einen Ausfall machen und Angehörige
des Wolhuser Bundes schädigen würden, so könne es allerdings
,keine gute Sache gehen'». Den «Vermittlern» in Ruswil hinwiederem
sollen sie geschrieben haben: «die Truppen von Entlebuch
seien' (nur!) «deshalb nach Kriens gezogen, weil dort die Verpflegung
leichter sei, da dort Milch genügend vorhanden und die Lebensmittel
billig seien»! Selbst unser Heissporn Stephan Lötscher, jetzt «Oberstwachtmeister»
der Entlebucher, habe in einem an den Bürgeroppositionsführer
Anton Marzell gerichteten Schreiben versucht, «die Bürgerschaft
von Luzern zu beruhigen (!), indem er erklärte, die Entlebucher
seien nur nach Kriens und Horw gezogen, um diese Aemter
vor einem Ueberfälle von Seite Luzerns zu schützen; die Entlebucher
verlangen nichts als das göttliche Recht...» Da kann etwas nicht
stimmen! Das sieht, alles zusammengenommen, zu verdächtig nach
absichtlicher Verwedelung der geschichtlichen Wahrheit aus.
Eins allerdings muss uns stutzig machen: dass jedenfalls Nikolaus
Glanzmann auch später nie für seine Teilnahme am Bauernkrieg,
und an so hervorragender Stelle, gestraft, vielmehr von den siegreichen
Luzerner Herren an Stelle des gemarterten und geköpften Hans
Emmeneggers zum Landespannermeister befördert worden ist! So
könnte es also wohl sein, dass es den Luzerner Herren schon während
der «Belagerung» ihrer Stadt gelungen ist, diese Säule mit geheimen
Versprechungen aus dem Gebäude des Entlebucher Aufruhrs herauszubrechen
und damit einen Keil in dessen Herz zu treiben... Und
dann wäre es auch ohne weiteres erklärlich, dass Nikolaus Glanzmann
noch am Vorabend des ersten Zusammenbruchs der stolzen Bauernmacht
vor Luzern, am 18. März nachts, den «Ehrengesandten» der
sechs katholischen Orte aus Malters — dem bereits abgefallenen Amt
—geschrieben haben soll: sie sollten «sich durch das Stürmen und
das Geschrei des gemeinen Mannes (!), der Weiber und Kinder nicht
beirren lassen, sondern in Verbindung mit dem Dekan» (der von den
Luzerner Herren bereits früher herausgebrochenen religiösen Säule
des Wolhuser Bundes!), aber auch mit «dem Schulmeister» (? dem Johann
Jakob Müller? Dann aber nur als Gegengift!) «die noch ausstehenden
Punkte zu verbessern und dann den Spruchbrief herauszugeben».
Dieser «Spruchbrief» nämlich, das werden wir noch sehen, war
nichts anderes als die besiegelte Niederlage der Bauern...
Von Stephan Lötscher aber wissen wir zuverlässig, dass er auch
im Feldlager vor Luzern der alte Heissporn geblieben ist! Denn sein
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 130 - arpa Themen Projekte
als ein Beweisstück für den Defaitismus der Bauern am Achtzehnten
zitiert, stellt sich bei näherem Zusehen im Gegenteil als ein Versuch
der Bauern heraus, ihre Verschwörung mit der Bürgeropposition, die
sie in Werthenstein begonnen und dort in geheimen Zusammenkünften
auch während der Ruswiler Verhandlungen fortgesetzt hatten, jetzt
in den Dienst eines nun erst (zu spät!) geplanten Sturms auf die Stadt
zu stellen! Die Bürger sollen den Sturm nicht als gegen sie, sondern
nur als gegen den gemeinsamen Bedrücker, gegen die Alleinherrschaft
der Aristokratie, gerichtet erkennen. Wie richtig diese Darstellung ist,
darüber verrät sich unser Herrenchronist an anderer Stelle selbst, wo
er als Antwort auf dieses Schreiben (ohne Namensnennung Lötschers!)
schreibt: «Allein die Bürger, deren Interessen ganz andere waren wie
jene der Bauern, hüteten sich wohl, gemeinsame Sache mit den Revolutionären
zu machen, so sehr ihnen auch das Patriziat der Stadt verhasst
war; sie wollten nicht nur getrennt marschieren, sondern auch
getrennt den gemeinsamen Feind schlagen» — was ihnen übrigens
später gründlich zum Verhängnis geworden ist. Stephan Lötscher war
es auch, der in der Nacht vom 18. auf den 19. März, die eine Verzweiflungsnacht
für alle echten Rebellen war, zur Ausführung des gewiss
nicht «beruhigenden» Planes riet, «durch Schwellung des hochgehenden
Kriensbaches die Stadt zu schädigen»! Und keiner auch würde so
trefflich wie er als Urheber der andern in dieser Nacht ausgestossenen
Drohung der Bauern passen, «die Stadt zu verbrennen»! Was übrigens
beides unausgeführt blieb.
So ist es auch von der Grosszahl der Entlebucher und ihrer Führer
gewiss (alle späteren Ereignisse beweisen es unwiderleglich), dass sie
genau so wie die Willisauer fest blieben mitten im Sturm des Verrats,
der von Ruswil ausging. Ein Dokument gibt es, das den echten Geist
des unerschütterlichen Widerstandes atmet, den der Verrat der Herren
in Ruswil fand. Es betrifft die Willisauer und ist ein Brief des Zuger
«Ehrengesandten», Ammanns und Landschreibers Beat Jakob Zur Lauben,
den dieser servilste Diener der Luzerner Herren gegen Ausgang
der Verhandlungen aus Ruswil schrieb. «Die Willisauer» — heisst es
da — «sind ganz ertaubet und wild mit Drohen und Bochen, sie sind
entschlossen, weder einen Stadtschreiber noch einen Grossweibel von
Luzern zu gedulden; einige sagen, sie wollen lieber den Tod ausstehen,
als heimlich oder öffentlich sich diesen Beamten fügen. Andere sagen,
sie würden eher mit Habe und Gut das Land verlassen, als diese zwei
Beamten dulden.» Das ist echter, unbrechbarer Eidgenossengeist! In
diesem Trotz steckt aber zugleich der Wille einer Klasse — es waren ja
Willisauer Bürger —, die von der Geschichte dazu berufen war, die Aristokratie
zu zerschlagen und die Welt umzuwälzen. Entwickeltere Bürger,
aber aus demselben Holz geschnitzte Leute, brachen damals in England
wirklich auf, um jenseits des Ozeans die neue Welt zu begründen...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 131 - arpa Themen Projekte
Der achtzehnte März war der entscheidende Tag; für die Ergebnisse
der Verhandlungs-Diplomatie seit der Errichtung des Wolhuserbundes
ebenso, wie für die militärische Lage. Er war auch der Gipfel
der von der Regierung und ihren «ehrengesandtlichen» Helfershelfern,
mit Unterstützung der Kapuziner, angestifteten Wirrnis von Diversionen,
wie der tragischen Selbstverstrickung des Volkes in diese Verrätereien,
eines Volkes, das in diesem entscheidenden Augenblick seiner
Geschichte vollkommen führungslos war. Hätte in Hans Emmenegger
auch nur ein Funke eines Thomas Münzer geschlummert: in
diesen Tagen hätte er als helle, wegweisende Flamme zum Himmel
lehen müssen! Aber eben dass dies nicht geschah, dass selbst sein Name
in diesen Tagen wie aus der Geschichte gestrichen zu sein scheint;
dass, mit anderen Worten, die leidenschaftlich aufgehäufte Kraft von
zehntausend bewaffneten Bauern keinen Thomas Münzer mehr hervorzubringen
vermochte: das zeigt deutlicher als alles andere, dass die
Zeit für die Bauernklasse, auf eigene Faust Geschichte zu machen, endgültig
vorüber war. Ihre geschichtliche Tat war die Gründung der Eidgenossenschaft
gewesen. Darum blickten sie so gern darauf zurück —
und nicht vorwärts! Diese Eidgenossenschaft war ihnen inzwischen
aber von neuen Zwingherren unwiderruflich aus der Hand gewunden
worden.
Ein solcher Zwingherr war jetzt der Herr der Situation im ganzen
Bauernhandel. Es war der Urner Oberst Sebastian Bilgerim Zwyer
von Evibach, österreichischer General und Feldmarschall, erster Agent
der habsburgisch-spanischen Feudalmacht und des Heiligen Römischen
Reichs Deutscher Nation in der Schweiz, derzeit führender eidgenössischer
«Ehrengesandter» der sechs katholischen Orte beim
siebenten katholischen Ort, als solcher auch von den sechs evangelischen
Orten der Eidgenossenschaft begeistert anerkannt und von der
gesamten Herrenklasse der Schweiz für seinen geschichtlichen Auftrag
mit heissen Wünschen begleitet; für den Auftrag nämlich: mit dem
alteidgenössischen Wahn des freien Bauerntums endgültig Schluss zu
machen; der Bauernklasse den letzten Rest des Heftes, mit dem man
Geschichte macht, aus der Hand zu winden und sie für immer in die
Ohnmacht der Geschichtslosigkeit zurückzustossen. Nur so nämlich
war für die Herrenklasse das Fundament ihrer Alleinherrschaft gesichert,
nur so der Friede und die Ruhe im Genuss ihrer Vorrechte auf
unabsehbare Zeitläufte gewährleistet.
Am frühen Morgen des Achtzehnten rückte ein weiteres Kontingent
der Urner, der Landsleute Zwyers, in Luzern ein, aber nicht Bauern,
sondern 120 «Vornehme als Freiwillige». Dieser winzige Akt ist
sinnbildlich für die in der Gesamtlage eingetretene Wendung zugunsten
der Herren. Am gleichen Morgen traten in Baden die Herren sämtlicher
dreizehn Orte der Eidgenossenschaft feierlich zu einer Tagsatzung
zusammen, die auf Betreiben der Luzerner Herren und der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 132 - arpa Themen Projekte
worden war, um den luzernischen Aufruhr abzuwürgen, weil
dieser bereits zum Keim und Auftrieb einer Bauernbewegung in der
ganzen Schweiz geworden war. Hier war die Herrenklasse aller dreizehn
Orte ganz unter sich. Kein einziger Bauer konnte vor dieser Versammlung
die Stimme erheben. Auch kein Ammann Trinkler stand
auf und sprach für die Bauern —hier wurde Peter Trinkler vielmehr
ausdrücklich als Hetzer und Schädling an der Eidgenossenschaft
öffentlich verfemt. Das war also ein «Gericht» der Feinde der Bauern.
Diese hatten allen Grund, seine Beschlüsse zu fürchten, und sie
fürchteten sie auch, seit dem 12. März, als die Einberufung dieser Tagsatzung
verkündet worden war. Darum hatten sie ja so leidenschaftlich
immer wieder auf beschleunigten Abschluss, so oder so, gedrängt.
Beides schien ihnen vorteilhafter: noch ohne den Druck der Tagsatzung
ihre Artikel unter Dach zu bringen, wie auch Krieg zu führen, bevor
die Tagsatzung das eidgenössische Aufgebot gegen sie erliess. Nun hatten
sie weder das Eine, noch das Andere erreicht. Wohl aber hatte Zwyer
sowohl das Eine, als auch das Andere erreicht, was ihm die Luzerner
Herren schon zu Beginn der «Vermittlung» der «Ehrengesandten»
als Ziel setzten: Zeitgewinn, bis der eidgenössische Apparat in Gang
kam, und bessere Kriegsrüstung... Jetzt am Achtzehnten, konnte
Zwyer den Bauernausschüssen in Ruswil mit beidem drohen: mit dem
erreichten Anschluss an die Tagsatzung und mit der bereits bedeutend
erhöhten Rüstung!
Und zwar brauchte Luzern — und brauchte Zwyer — jetzt zur
Not nicht einmal mehr das Kriegsaufgebot der Tagsatzung abzuwarten.
Nicht dass die Truppenzahl in der Stadt inzwischen zu einer besonders
bedrohlichen Macht angeschwollen wäre. Mehr als 14-1500,
allerdings gut Bewaffnete, mögen am Achtzehnten nicht in ihren Mauern
gewesen sein. Auch zeigten sich in ihren Reihen ab und zu bedenkliche
Zersetzungserscheinungen, wenn diese auch nur den bäuerlichen
Teil der Truppen anfielen: besonders die Unterwaldner aus der Nachbarschaft,
aber auch einzelne Schwyzer und Zuger Bauerntrupps
murrten mehr und mehr, als sie erkannten, im Dienste wessen sie
gegen wen gebraucht werden sollten. Nein, die grosse Rückenstärkung
kam vom mächtigsten Herrenstaat der Eidgenossenschaft, von Bern!
Schon auf den Notschrei der Luzerner Herren vom Vierzehnten
früh, den die Zürcher noch in der darauffolgenden Nacht nach Bern
spediert hatten, «traf der Rat (von Bern) sofort die nötigen Anstalten,
indem er aus den welschen Vogteien (d. h. aus dem Waadtland) Truppen
aufbot und selbst Genf um Hülfe mahnte». Der Alarm der Luzerner
Herren kam den Berner Herren sehr gelegen, denn ihre eigenen
Bauern muckten nun schon gewaltig auf, sodass die Berner Herren
unter dem guten Vorwand, Luzern beispringen zu müssen, von vornherein
auch die eigenen Bauern unter militärischen Druck setzen konnten.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 133 - arpa Themen Projekte
Ratsherren Schultheiss Anton von Graffenried und Fenner Vincenz
Wagner von den im Welschland erfolgten Truppenaufgeboten Kenntnis,
«mit der Bitte, einen Angriffsplan zu entwerfen». Gleichzeitig wurden
auch schon 150 junge Berner in die Schlösser Thun, Wimmis und
Burgdorf gelegt. Schon am Siebzehnten «rückten in Bern 800 Mann
aus Nidau, Büren, Erlach und Aarberg ein, denen am folgenden Tage
je 100 Mann von Biel und Neuenburg folgten. Zwei Tage später .trafen
wieder 300 Neuenburger und am 21. März die Leute von Neuenstadt
und Tessenberg in Bern ein, so dass der Rat von Bern ausser seinen
Bürgern 1600 Mann zur Verfügung hatte».
Damit aber nicht genug. Der Rat von Bern hatte, auf den Hülferuf
der Luzerner hin, am Sechzehnten auch schon eine kleine Sondertagsatzung
der Gesandten von Bern, Freiburg und Solothurn veranstaltet.
«Freiburg hatte vorläufig 1000 Mann aufgeboten und gedachte,
wenn nötig, noch 2000 Mann auszuheben. Für den ersten Auszug
waren 3 Feldstücklein (Kanonen) bereit. Solothurn hatte 600 Mann
und 2 Regimentsstücklein zum Auszuge gerüstet.» Alle drei zusammen
schrieben nun bereits am Siebzehnten an den Rat von Luzern: «Man
werde auf erfolgende Mahnung sofort mit einigen Tausend Mann zu
Pferde und zu Fuss zu Hülfe kommen, die Stadt solle doch mit diesen
der Vernunft beraubten Menschen keinen Vertrag abschliessen durch
welchen die Rechte der Regierungen geschmälert würden»! Nun soll
zwar, nach unserem modernen Luzerner Herrenchronisten, dieses
Schreiben «in Luzern erst am 20. März im Rate verlesen» worden
sein —das mag sein. Aber die Schultheissen haben es sicher sofort zur
Kenntnis genommen und totsicher in gestrecktem Galopp zu Zwyer
nach Ruswil reiten lassen! Und darum konnte es nicht früher «im Rate
verlesen» werden. Zwyer hat bestimmt bereits im Lauf des Achtzehnten
von dieser formidablen Rüstung der Berner Kunde bekommen.
Denn diese Kunde war ebenfalls bereits im Lauf des Achtzehnten
wie ein Blitz in die Massen der Bauern gefahren — wie ein Blitz, der
das ganze Gebäude ihres ohnehin bereits derart zersetzten Aufruhrs
vom First bis auf den Grund spaltete! Die Nachricht: «fremde Truppen
werden ins Gebiet von Luzern einfallen!», kam den «vermittelnden»
Herren derart zurecht, dass sie nicht besser hätte wirken können,
wenn sie bestellte Arbeit des Obersten Zwyer gewesen wäre. Zwar
wird von unserem luzernischen katholischen Herrenchronisten — getreu
seinen Vorgängern, denen allen es nicht sympathisch sein konnte,
die Rettung der katholischen Luzerner Aristokratie den so viel schneidigeren
evangelischen Berner Herren zu verdanken — die «plötzliche
Ausstreuung» dieser «durchaus unwahren Gerüchte» geflissentlich den
Bauern in die Schuhe geschoben; besonders soll ein einzelner Mann,
der Landessiegler von Entlebuch, der Urheber dieser «falschen» Gerüchte
gewesen sein. Das ist natürlich umso lächerlicher, als dieselben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 134 - arpa Themen Projekte
fieberhaft betriebenen und das ganze Bernerland, ja selbst den
Kanton Freiburg in Aufruhr versetzenden Rüstungen des Rates zu
Bern Kunde geben.
Dieselben Herrenchronisten sind es auch, die uns von der begeisternden
Wirkung anderer, mit diesen Rüstungen zusammenhängender
Ereignisse auf die Luzerner Bauern — nicht als von «Gerüchten», sondern
als von geschichtlich erhärteten Tatsachen berichten. So sagt
Herr von Liebenau: «Geradezu begeisternd wirkte die Kunde, dass in
Greyerz» (schon am Fünfzehnten) «und in der Gegend von Langenthal»
(am Siebzehnten) «die Leute sich weigern, gegen die Bauern zu
ziehen, dass im Bernerischen die Regierung aus Furcht vor dem Volke
nicht wage, die Besetzungen zu vermehren und dass im Gebiete von
Basel die Bauern sich weigern, Soldatengelder zu zahlen, ja dass in
Uri und Unterwalden die Regierungen den Leuten die Versicherung
haben geben müssen, dass man sie nicht gegen die Entlebucher gebrauchen
wolle.» Die begeisternde Wirkung all dieser historisch durchaus
richtigen Tatsachen auf die Bauern — eine Wirkung die, ebenfalls
historisch richtig, bereits als in den Tagen vom 15.-18. März wirksam
dargestellt wird — soll beweisen, dass es im Interesse der Bauern gelegen
habe, die «durchaus unwahren Gerüchte» von den Berner Rüstungen
zu verbreiten. Im Interesse der Bauern lagen nur die sie ermutigenden
Nachrichten von den Meutereien ihrer Klassengenossen
in den anderen Kantonen. Wie der waadtländische Geschichtsschreiber
L. Vulliemin — der väterliche Freund des jungen C. F. Meyer und der
beste Fortsetzer der Johannes von Müller'schen Schweizergeschichte —
dartut, waren diese Meutereien nicht ganz belanglos, wenn sie auch an
der Gesamtsituation nicht viel zu ändern vermochten. So sagt er: «Freiburg
konnte keine Hülfe leisten, weil die Greyerzer (am 15.) davon
sprachen, sich einige tausend Mann stark den Empörern anzuschliessen»!
«Die Waadtländer verweigerten (zwar) ihre Hülfe nicht, zeigten
aber (am 16.) einen grossen Widerwillen gegen ihre Brüder zu kämpfen,
die sich für ihre Freiheit erhoben»! Bei einer zu Langenthal veranstalteten
Musterung (am 17.) wurden die aus Bern abgeschickten Offiziere
«ungestüm» gefragt: «Gegen wen heisst man uns marschieren?» —
Gegen die Aufrührer von Luzern. «Niemals.» Und alsobald zerstreute
sich die gesamte Mannschaft. Fast in allen Dörfern gewannen die
«Harten» über die «Linden», die der Regierung treu gebliebenen, das
Uebergewicht.
Die Nachrichten von den Rüstungen selbst konnten unter den Luzerner
Bauern nur Angst und Panik erzeugen. Sie waren aber natürlich
genau so wahr und ganz gleichzeitig wirksam wie die Nachrichten von
den Wirkungen und Begleiterscheinungen dieser Rüstungen: von den
Meutereien bei den ausgehobenen Truppen. Tatsache ist nur, dass unter
den Bauern — angesichts einer derartig drohenden militärischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 135 - arpa Themen Projekte
und Solothurn, «sofort mit einigen Tausend Mann zu Pferde und
zu Fuss» ins Luzernische einzumarschieren bereit war — die Angstpanik
diese an sich richtigen Nachrichten von Mund zu Mund vergrösserte
und besonders in den unmittelbar bedrohten Grenzgebieten zu
wirklich falschen Gerüchten über Zeit und Ort des durchaus begründetermassen
befürchteten Einbruchs Anlass gab. Tatsache ist auch,
dass sich die Bauern begeistert an die Nachrichten von den Meutereien
unter den aufgebotenen Klassengenossen der andern Kantone
klammerten: das war der Strohhalm ihrer Hoffnung mitten im Sturm
ihrer Angst und Not.
Tatsächlich hat die Panik wegen des drohenden Ueberfalles der
Berner, den man sich als unmittelbar bevorstehend, ja als bereits ins
Werk gesetzt vorstellte, die gesamte Truppenmacht der Bauern in zwei
sich streitende Lager gespalten und dadurch im entscheidenden Moment
völlig paralysiert. Die einen wollten dabei bleiben, die Stadt Luzern
in der Zange zu behalten, bis die Verhandlungen in Ruswil zum
Abschluss gebracht seien; ja, erst jetzt tauchen Anzeichen dafür auf,
dass wenigstens ein Teil der «Belagerer» einen verzweifelten Sturm
auf die Stadt wagen wollte. Die Hauptmasse der Bauerntruppen aber
zog sich in Rothenburg zusammen gegen Norden, «damit die Landschaft
vor grossem Ueberfall bewahrt werde». Und es wurden nach
allen Seiten Boten ausgesandt, um gegen das vom Oberaargau her erwartete
fremde Kriegsvolk «auch noch die anderen Auszüge aufzubieten».
Man kann sich denken, welche augenblickliche Erleichterung diese
Auseinanderreissung der Bauernarmee für die Herren von Luzern bedeutete!
Dies umsomehr, als von dunkler Seite, über die die Geschichte
schweigt, ein ganz offensichtlich wenigstens teilweise erfolgreicher
Versuch gemacht wurde, durch die Parole «Die Religion ist in Gefahr!»
(weil die gefürchteten Berner ja Protestanten waren!) die Bauern von
allen ihren bisherigen sozialen und politischen Losungen, die sie gegen
Luzern ins Feld geführt hatten, abzulenken und sie auf dem Boden der
bedrohten gemeinsamen Religion mit einem Schlag und bedingungslos
wieder in die Arme, die Hürden und Fesseln ihrer «gnädigen Obern» und
christlichen Bedrücker zurückzuführen. Ohne eine solche religiöse Diversion,
die dann ebenfalls bereits am Achtzehnten, in innigstem Zusammenhang
mit der Panik vor dem drohenden Berner Ueberfall, ins Werk
gesetzt und geglückt sein muss, wäre Folgendes nämlich ganz undenkbar
gewesen: dass schon am nächsten Tag, sofort nach der Anhörung
des «Rechtlichen Spruches» auf dem Krienserfelde, das heisst: sofort
nach der ersten grossen Niederlage der Bauern, aus deren allerdings
nichts weniger mehr als repräsentativem Feldlager ein Schreiben beim
Luzerner Rat einging, dessen Inhalt erstens die Mitteilung war, dass
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 136 - arpa Themen Projekte
grossem Ueberfall bewahrt werde», zweitens aber die untertänige Bitte:
«die Obrigkeit möge zur Errettung des wahren, allein seligmachenden
Glaubens und der Gerechtigkeit willen die Unterthanen in Gnaden befohlen
haben und sie väterlich beschirmen und bewahren»! ... Es
müsste denn eine Kriegslist der Bauern gewesen sein, um ihre Truppen
auch über die Niederlage hinaus im Felde behalten zu können!
Doch nun müssen wir endlich zusehen, wie diese Niederlage zuende
geschmiedet wurde —wie unter dem Schutz der Drohung mit
dem Ueberfall von aussen unverzüglich der Ueberfall von innen vollzogen
wurde.
Oberst Zwyer und die andern «Ehrengesandten» in Ruswil hatten
am Achtzehnten einen «struben» Tag. Das «Rumpfparlament» der Bauern
war wieder mehr als vollzählig und auch wieder sehr stachlig geworden.
Denn von allen Seiten trieb die Landespanik wegen des befürchteten
Berner Ueberfalls gerade die aktivsten Bauern nach Ruswil,
um dort zum Rechten zu sehen, Druck auszuüben und Auskunft zu verlangen.
«Bereits hatten die Vermittler den Text der einzelnen Artikel
der Spruchbriefe festgesetzt und in konfidentiellen Briefen an die
Schultheissen und Stadtschreiber mitgeteilt. Einzelne dieser Briefe
waren von den Bauern aufgefangen worden.» Diese Briefe wurden natürlich
sofort den Ausgeschossenen in Ruswil gebracht. Da sie teils
italienisch oder französisch abgefasst waren, «trug diese welsche Korrespondenz
dazu bei, dass sich noch in letzter Stunde eine eigentümliche
Opposition gegen das Schiedsgericht geltend machte, indem dessen
Präsident, Oberst Zwyer, der lange in Italien gelebt hatte, in Rede
und Schrift sich gar vieler Fremdwörter bediente. Als Zwyer vom ,Instrumentum
pacis' (vom Rechtlichen Vertrag als ,Friedensinstrument')
redete, sagten die Bauern, wie Landvogt Kaspar Pfyffer bemerkt: sie
wollen das ,Eidgenössisch haben und nicht mit verkrümmten oder latinischen
Worten, welche weder Geistliche noch Weltliche verstehen
können'.»
Das weit Schlimmere aber war, dass das, was die Bauern aus diesen
abgefangenen Briefen herauszubekommen vermochten, zum grossen
Teil gar nicht dem entsprach, was zwischen ihnen und den «Vermittlern»
besprochen und abgemacht worden war. Sofort verbreitete
sich das sehr begründete Gefühl ganz allgemein, dass sie wieder einmal
über den Löffel halbiert, das heisst von hinten und vorne betrogen
werden sollten. Denn inzwischen hatten sie ja auch das vom Rat am
Sechzehnten in alle Welt verschickte «Manifest» gelesen, das ihnen so
schmählich in den Rücken fiel, sie der ganzen Welt als treulose, verbrecherische
Rotte denunzierte und den Willen der Herren, sie mit Gewalt
niederzuwerfen, so zynisch offen verkündete. Und gerade für diesen
Tag, den Achtzehnten, hatte der zuständige Oberherr der Kirche,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 137 - arpa Themen Projekte
«zur Abwendung des von ,bösen Engeln' (also Teufeln) angestifteten
Krieges»! Nimmt man noch die ungeheure Erregung über die Nachrichten
von Berns erdrückender Rüstung und sofortiger Einfallsbereitschaft
hinzu, die teils ebenfalls abgefangenen Briefen entstammten,
ferner die furchtbare Verwirrung, die die Diversionen — d. h. Verrätereien
—der Herren in allen Landesteilen angestiftet hatten, so
kann man sich nur über Eines wundern: dass nicht das ganze Land
unter dem Druck dieses explosiven Gemisches wie ein überladener Vulkan
in die Luft flog! Aber der Wind, der hier gesät wurde, ist nur echt
bauernmässig langsam zu einem neuen Sturm herangereift und erst
viel später losgebrochen...
Was dagegen jetzt, am Achtzehnten, aus dieser Erregung und Verwirrung
der Bauernkräfte heraus am Verhandlungsort Ruswil — und
auch sonstwo im Lande —geschah, ist eher bescheiden, ja winzig zu
nennen. «Schon am frühen Morgen liefen verschiedene Drohbriefe ein.
Dann kamen die Delegierten der Bauern und wollten die Vermittler
nötigen, ihnen sofort den Spruch zu eröffnen. Diese beharrten auf
dem» (von den Herren allein gefassten) «Beschlusse, der Spruch soll
bei Luzern in Gegenwart beider Parteien eröffnet werden, damit alles
in Gebühr, nach Billigkeit, unparteiischer und in rechter Form vor sich
gehe.» Was für eine Fratze des Volksbetrugs diese «Gebühr, Billigkeit,
Unparteilichkeit und rechte Form» war, geht schon daraus hervor,
dass Herr Zwyer zwar jedes Wort, jeden Buchstaben des nun zu errichtenden
«Rechtlichen Spruchs» mit der einen Partei, den anwesenden
Luzerner Ratsherren, besprach und mit den Oberen in Luzern fortlaufend
in «konfidentiellen Briefen» festlegte —dass er es jedoch nicht
für nötig hielt, der andern Partei, den Delegierten der Bauern, in diese
definitiven Festlegungen auch nur Einblick zu gewähren! Er hatte
allen Grund dazu, dies gar nicht erst zu riskieren; wie wir noch sehen
werden.
Ausserdem pressierte es nun dem Herrn Obersten Zwei': er war
als einer der Gesandten des Standes Uri an die Tagsatzung delegiert, die
schon an diesem selben Tage in Baden zusammengetreten war. Noch
rechtzeitig dahin zu kommen, um an ihren Beschlüssen über die Bauernsache
mitzuwirken, lag nicht nur im Interesse des «Standes» Uri,
sondern des Herrenstandes der ganzen Schweiz, für den der Oberst
Zwyer ohnehin, und gar erst in dieser Sache, eine Hauptperson war.
Also musste die Sache hier in Ruswil jetzt um jeden Preis, auch um
den eines glatten Betrugs, «erfolgreich» unter Dach gebracht werden.
Am besten war es zu diesem Zweck, man umging gerade die wundesten
Punkte jetzt den Bauern gegenüber mit Schweigen, als ob bei den
Herren aller Widerstand gegen sie aufgehört hätte — entschied diese
Punkte jedoch stillschweigend nach den Wünschen der Herren und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 138 - arpa Themen Projekte
ein. Durch geeignete Art des Ablesens, oder auch durch direktes Auslassen
gewisser brenzlicher Stellen, und durch zweckmässige Aufmachung
des Festlärms morgen im Kriegslager auf der Krienser Allmend
würde man es schon erreichen, dass die Mehrzahl der anwesenden Bauern
gar nicht begriff, was da vorging und dass auf diese Weise wenigstens
der Schein einer mehrheitlichen Annahme zustandekam. Das war
Alles, worauf es jetzt ankam — den Rest würde die Tagsatzung schon
besorgen. Und das war in der Tat das, was der Herr Oberst Zwyer sich
für heute und morgen noch vorsetzte, was er sich mit Recht auch zu
leisten getraute — und was er tatsächlich genau so durchgeführt hat.
Hätte er sich nämlich auf eine weitere Diskussion jener heikelsten
Punkte eingelassen — er wäre nie nach Baden gekommen... Denn dabei
ging es um die freiheitlichen Grundrechte der Bauern: die freie
Volkswahl bei den Aemterbesetzungen, das freie Versammlungsrecht —
und um die Null-und-Nichtig-Erklärung des Wolhuser Bundes! In
diesen Punkten aber war Herr Oberst Zwyer, trotz dem Einsatz von
zwei Dutzend «Ehrengesandten», in elf oder zwölf Tagen und Nächten
zähester und verschlagenster Verhandlungen gerade bei den entscheidenden
Aemtern Willisau und Entlebuch — aber auch bei der Mehrheit
der andern — bis dato nicht «um eines Nagels Breite» vorangekommen,
weder in Werthenstein, noch in Ruswil. Und hätten die Bauern
am Abend des Achtzehnten auch nur einen Blick darauf werfen
können, was Zwyer darüber nun endgültig in den «Rechtlichen
Spruch» hineinschrieb — der Vulkan wäre hier in Ruswil noch ganz
anders in die Luft gegangen als ehemals, beim Abschluss des «Gütlichen
Vergleichs», in Werthenstein! Das hat der spätere Verlauf des
zähen Kampfes klar und eindeutig erwiesen.
Schon ohne dass die Bauern darum wussten, was der Oberst
Zwyer nun in den Spruch hineinschrieb, ging es an diesem Abend turbulent
genug zu. Eben hatten Zwyer und seine Paladins ihre sieben Sachen
gepackt und wollten sich auf ihre Rösser schwingen, um nach Luzern
abzureisen und dort den Spruch ungestörter zuende zu formulieren —
da kam es zu einem heftigen Auflauf. Die Bauern umzingelten die Herren,
verlangten stürmisch, den Spruch zu sehen und zwangen sie zum
Abpacken und Dableiben, als diese die Herausgabe des Spruchs verweigerten.
«Da legte sich der Dekan von Ruswil ins Mittel und führte
dieselben in sein Haus, damit sie den Spruch vollenden können.» Der
Dekan von Ruswil ist niemand Anderes als der päpstliche Protonotar
Melchior Lüthard, die religiöse Säule des Wolhuser Bundes. Für ihn
war bei den Bauern noch Respekt genug da, um jede Gewalthandlung
ihm gegenüber zu verhindern, obwohl sie wussten, dass er sich von der
Luzerner Regierung schon seit dem «Gütlichen Entscheid» ebenfalls
als gelegentlichen «Vermittler» gebrauchen liess. Den Herren «Ehrengesandten»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 139 - arpa Themen Projekte
und «die Herrn Capuziner vast uff gliche wyss tractiert».
Aber auch im Pfarrhaus fand Zwyer nicht lange Ruhe. Es entstand
nämlich von anderer Seite ein neuer Auflauf, und der liess sich
bedeutend bedrohlicher an als der erste. Sein Urheber wird von unserem
modernen katholischen Herrenchronisten ohne weiteres als «ein betrunkener
Priester» bezeichnet, einfach weil einer der im Pfarrhof anwesenden
«Ehrengesandten», Nikolaus von Diessbach, später an seine
Regierung in Freiburg schrieb: «un prester charge de vin». Von dem damals
gewiss auch im Pfarrhof anwesenden Kaplan Froner von Ruswil
aber wird er lediglich als «der herrgottlose Pfaffe Schniepper» bezeichnet,
wobei die «Herrgottlosigkeit» vermutlich seine wirkliche oder vermeintliche
Parteinahme für die Bauern geisseln soll. Aber, ob nun auch
die angebliche «Betrunkenheit» politisch zu deuten oder real war: so
ziemlich sicher ist, dass der Priester Hans Schniepper, Pfarrer zu Hergiswil,
unter dem Druck der Berner-Panik, die das ganze Land wie ein
Fieber schüttelte, die Nerven verloren hatte. Möglicherweise hatte ihn
eben die Furcht vor der «Herrgottlosigkeit» der Berner beinahe um den
Verstand gebracht. Wenn er nicht gar selber einer jener schwarzen Raben
gewesen ist, die von dunkler Seite ausgesandt worden waren, um
die Religion als in Gefahr zu erklären!
Wie dem auch sei, gerade hier in Ruswil war es besonders gefährlich,
an das Pulverfass der Berner-Panik zu rühren. Galten doch die
Herren «Ehrengesandten» allgemein — und, wie wir gesehen haben,
nicht ganz mit Unrecht — als die, welche die eidgenössische Hilfe für
die Luzerner Herren, und damit auch die gefürchtete Berner Kriegsmacht,
herbeigerufen hatten. Und trafen doch Tag für Tag Briefe aus
Bern direkt an die Herren «Ehrengesandten» in Ruswil ein, von denen
die Bauern manche abgefangen hatten. Nun platzte dieser «herrgottlose
Pfaffe» mit der Huronen-Botschaft mitten in all das hinein: «fünfhundert
Welsche seien bei St. Urban (unweit Langenthal an der luzernischen
Grenze) angekommen und wollen ins Land fallen»! Und im Nu
schwoll diese Botschaft in demselben Munde zu dem Geschrei an:
«St. Urban sei von den Bernern» (bereits) «verbrannt worden und Willisau
stehe» (schon) «in Flammen»! Das einzig Richtige an der ganzen
Meldung war: «Rings herum läute man Sturm». Denn darüber haben
wir bestimmte Nachricht: dass in den Ortschaften Uffhusen, Luthern
und Hergiswil am 18. März die Sturmglocken geläutet wurden, weil
man glaubte, fremde Truppen hätten das Land bereits überfallen. Und
das werden nicht die einzigen Dorfglocken gewesen sein, die die Panik
an diesem Tag in Bewegung gesetzt hat. Ebenso wahr ist, dass nicht
allein der «herrgottlose Pfaff e Schniepper», sondern in der Tat die gesamte
Bevölkerung der unteren, an den bernischen Oberaargau grenzenden
Aemter durch die alarmierenden Gerüchte förmlich über den
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 140 - arpa Themen Projekte
und dem zu St. Urban stiftsgenössigen Pfaffnau, «wo damals nur
noch vier dem Kloster St. Urban und der Regierung ergebene Männer
gezählt wurden», sowie aus Dietwil, wo gesagt wurde: «bereits marschieren
Berner von Aarwangen aus auf Reiden und Wykon».
Kurz und gut, jetzt schien für die «Ehrengesandten » in Ruswil die
letzte Stunde geschlagen zu haben! Besonders die Willisauer, deren
Stadt schon in Flammen stehen sollte, gerieten unter Führung des Adlerwirts
Anton Farnbühler ausser Rand und Band. «Ein bewaffneter Haufe
umstellte den Pfarrhof und drohte, die Vermittler wegen Verräterei
niederzumetzeln. Uli und Jori Gilli, Müller in Stechenrain, wollten
Oberst Zwyer im Bett überfallen und ausplündern. Hans Wandeler,
genannt Fürabend, hielt dem Landvogt Moor und Weibel Wüest die
Fäuste unter die Nase und schalt die Vermittler Verräter. . . Anton
Farnbühler, der Grossweibel in Willisau werden wollte, schalt den Dekan
von Ruswil einen Lügner.» Nun war selbst die Ehrfurcht vor der
religiösen Säule des Wolhuser Bundes keine Schranke mehr. Und auch
der grosse Hans Krummenacher, der «stärkste Eidgenoss», war, exakt
wie in Werthenstein, wieder da und «zielte mit einer Pistole gegen
einen Gesandten»!
Es muss aber ein rasch verrauchter Zornlärm gewesen sein. Ein
kluger und unter diesen Umständen in der Tat sehr mutiger Gegenzug
einiger «Ehrengesandten » brachte ihn zum Schweigen. Der Schwyzer
Landammann Martin Belmont von Rickenbach, einer der ganz wenigen
bei den Bauern beliebten «Ehrengesandten», und Nikolaus von Diessbach,
der von Belmont sagt: er «genoss das Vertrauen der Bauern, mit
denen er oft gesprochen hatte», anerboten sich, mit Anton Farnbühler
zusammen sofort, vom Platz weg, auf Kundschaft in die Nacht hinaus
nach Willisau zu reiten, um selber festzustellen, was an den Panik-Meldungen
des Pfarrers von Hergiswil Richtiges oder Falsches sei.
«Wir wollten aber», so berichtete zwei Tage später der Freiburger Ratsherr
an seine Regierung, «zu Pferde sitzen, um die angeblichen Fremden
und Berner zum Rückzug zu bewegen. Die Bauern glaubten, wir
hätten nicht den Mut, dies zu tun. Wir ritten aber fort, um das Volk
zu beruhigen. Um 1 Uhr nachts kamen wir in Willisau an. Sofort stellten
alle Leute Lichter unter die Fenster; dann kamen sie und fragten,
ob sie wohl des Lebens sicher seien. Als wir ihnen beruhigende Zusicherungen
gaben, gingen sie zur Ruhe. Als wir uns am Morgen erheben
wollten, fanden wir eine Schildwache vor unserer Türe, die uns zurückhielt,
bald aber des Weges ziehen liess, auf dem wir unsere Deputierten
noch in Ruswil trafen, gerade im Momente, wo sie nach Luzern
reiten wollten.» Denn jetzt, durch diesen Hereinfall auf den blinden
Lärm beschämt, liessen die Bauern die Herren «Ehrengesandten» friedlich
ziehen. Und sie ritten ihnen nur zum geringsten Teile nach, «neben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 141 - arpa Themen Projekte
Gebiet von Kriens befindlichen Allmend, neben dem Gute Kaspar
Pfyffers».
Nun also wurde am 19. März, am St. Josephstag, die jämmerliche
Komödie auf der Krienser Allmend ins Werk gesetzt, die dem Volk
einen feierlichen Friedensschluss bei offen waltender Landsgemeinde
vortäuschen sollte. Es war ein Friede zwischen Schafen und Wölfen.
Nur ein stark reduziertes und dazu weitgehend zersetzes Bauernlager
bildete das verblüffte Zufallspublikum für die Theaterszene. Selbst
unser moderner Luzerner Herrenchronist berichtet, «dass von den
Truppen der zehn Aemter nur ein geringer Teil zur Anhörung des
Spruches gegen Luzern vorgerückt war». Keinerlei Sorge war dafür
getragen worden, dass auch nur die wichtigsten Aemter durch ihre
offiziellen Landesbehörden vertreten waren. Denn folgendermassen
sah, nach unserem modernen Herrenchronisten, die Liste der anwesenden
Bauernführer aus: «Von den Bauern erschienen zu Pferd:
Oberst Christian Schybi, Oberst Kaspar Steiner, Hans Damian Barth,
Seckelmeister Walthert, Hans Jakob Peyer von Willisau, Baschi
Meyer, Statthalter Gründer von Emmen, Anderhub von Rothenburg,
Müller Stürmli, Sebastian Steiner, Hans Jakob Murpf, der Jommerli,
Wirt zu Malters; zu Fuss: Hans Häller, der Bauer zu Däywil». Davon
dürfen einzig Schybi, Kaspar Steiner, Peyer und der Däywiler Bauer
als zur führenden Schicht gehörig gelten; und diese hatte ausserdem
in Kaspar Steiner ein höchst bedenkliches Loch. . . Dagegen war von
der Herrenpartei eine repräsentativ vollständige, höchst ansehnliche,
offizielle Vertretung feierlich zur Verlesung des «Rechtlichen Spruchs»
aufgeritten: «Zur Anhörung desselben erschienen die beiden Schultheissen
Dulliker und Fleckenstein, begleitet von vier Klein-Räten (dem
eigentlichen Regierungsausschuss), sechs Gross-Räten und sechs Delegierten
der Bürgerschaft, an die sich zahlreiche Bürger anschlossen.»
Dazu sämtliche «Ehrengesandten» der sechs katholischen Orte mit
ihren Standesweibeln, unter Führung des Obersten und Feldmarschalls
Sebastian Bilgerim Zwyer. Ein Fahnenwald und ein Trompeterchor —
als Posaunen des Gerichts — bildeten den Rahmen dieser Akteure.
Und nun eröffnete der vielgeplagte Oberst Zwyer endlich in höchster
Eile und mit den nötigen Betonungen und Dämpfungen den
«Rechtlichen Spruch der eidgenössischen Schiedrichter zwischen der
Stadt Luzern und ihren X Aemtern». Denn am Abend dieses selben
Tages noch, wenn irgend möglich, wollte Zwyer das Dokument seines
«Sieges» über die Bauern den Standesherren der in Baden tagenden
Tagsatzung persönlich überbringen. Und das war für damals noch ein
sehr weiter Weg.
Die Meinung der Herren wie der Bauern bei diesem «Rechtlichen
Spruch» war die, dass durch ihn nur über die im «Ersten gütlichen
Entscheid» in Werthenstein nicht entschiedenen Fragen, also gerade
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 142 - arpa Themen Projekte
und zum Aufbruch der Bauern ins Feld geführt hatten, Recht gesprochen
werden sollte. Zwyer muss es inzwischen aber gelungen sein, die
für die Luzerner Regierung allerunerträglichste von diesen Forderungen
der Bauern, die nach Mitregierung des Volkes durch Bewilligung
oder Verwerfung der diesem vor Erlass vorzulegenden Mandate (Gesetze),
vollständig aus der Diskussion auszuschalten. Denn davon ist
im «Rechtlichen Spruch» mit keinem Wort mehr die Rede, und auch
von Seiten der Bauern ist diese Forderung im Verlauf des späteren
Kampfes nur noch gelegentlich wieder erhoben worden. Schon das
war ein wirklicher Sieg Zwyers über die Bauern! Ein stillschweigender
zwar, aber ein grundsätzlicher, der für die Aufrechterhaltung des Anspruchs
auf Alleinherrschaft der Aristokratie grundlegend war. Gleichwohl
ist kaum anzunehmen, dass irgendwer von den hier versammelten
Bauernführern — ausser vielleicht gerade ihr problematischster,
Kaspar Steiner — sich dieses Mankos im verlesenen Spruch überhaupt
bewusst geworden ist.
Die Meinung der Luzerner Herren und der «Ehrengesandten» war
es ausserdem, dass all die vielen Einzelartikel über wirtschaftliche
und lokale Forderungen der Bauern — die darum im «Rechtlichen
Spruch» nicht figurieren — durch den «Gütlichen Vergleich» ausgeglichen
worden seien, obwohl dieser Vergleich vom Bund der
X Aemter niemals angenommen worden war. Mit diesem «Vergleich»
hatten ja die «Ehrengesandten» die Argumente zu ihren Diversionen
in den einzelnen Aemtern bestritten und bei dieser Gelegenheit
— bei den wenigen Aemtern, wo ihnen die Diversion gelang — sehr
reduzierte und wieder ganz von der «Gnade» der Regierung abhängig
gemachte Konzessionen gemacht. Schon diese so verstümmelten Konzessionen
aber schienen jetzt der Luzerner Regierung — und erst recht
ihren Standesgenossen der übrigen «souveränen » Regierungen der Eidgenossenschaft
—die Grenze des Erträglichen überschritten zu haben.
Gerade darum aber sollte wenigstens in den Hauptpunkten der noch
verbliebenen grundsätzlichen Forderungen der Bauern der Sieg der
Herren durch den «Rechtlichen Spruch» ein umso gesicherterer sein.
Diesen Sieg hat Zwyer allerdings durch die Formulierungen sowohl
des Eingangs wie des Ausgangs des Spruchbriefs, wie auch einzelner
Partieen der neun Artikel, so gut wie möglich in Watte zu
packen versucht. Es waren diejenigen Stellen, die man vor der Bauernversammlung
nur mit erhobener Stimme zu unterstreichen brauchte,
um der Zustimmung der Mehrheit gewiss zu sein. So, wenn im Eingang
ganz der Meinung der Bauern Ausdruck verliehen wird, dass sie
die «Ehrengesandten» zwar «gern darin mitteln» lassen, jedoch dabei
«offene Hand» behalten wollten. Oder wenn die «Vermittler» darin
versichern, «über der Aemter mehrteils gehabte Beschwerden und
Punkte bei Unsern G. L. A. Eidgenossen (d. h. von den Räten zu Luzern)
die gütliche Willfahr erhalten» zu haben. Wenn die meisten Beschwerdepunkte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 143 - arpa Themen Projekte
was man erwarten konnte, oder mehr als das!
Beim ersten Artikel hörte sich besonders wohlgefällig an, wie er
endet: dass «den sämmtlichen Aemtern ihre Amtsbücher, auch was sie
sonst für Sprüche, Verträge und briefliche Rechtsame, gute Bräuche
und Herkommen haben, bestätigt und bekräftigt sein sollen». Sie
hatten sie nur eben nicht, wenigstens die wichtigsten Briefe nicht! So
hatten die Entlebucher und die Willisauer keine Grundurkunden über
ihre Freiheiten mehr, weil sie ihnen von der Regierung entwendet worden
waren. So hatten die Rothenburger kein Amtsbuch mehr, weil es
ihnen, wie sie stets steif und fest behaupteten, von der Regierung
unterschlagen worden war. Jaja, jetzt zeigte es sich, wie schlau es von
der Regierung war, dass sie sich während all der Zeit so standhaft geweigert
hatte, diese Urkunden auszuliefern! Aber bei wirksamem Vortrage
machte sich dieser Passus sehr schön; er schien alle, immer so
heiss geforderten Wünsche betreffs des alten Herkommens, samt den
«Brief und Siegel»-Wünschen zu erfüllen. Und das vermochte leicht
den Anfang desselben Artikels zuzudecken, der lautete: «Dass der
Stadt Luzern alle habenden Briefe und Siegel, Rechte und Gerechtigkeiten,
— nunmehr seit 250 Jahren, — auch Hoheiten, Freiheiten und
Herrlichkeiten, ewige Besitzung ihrer Unterthanen, zu besten Kräften
erkannt» sein sollen! Denn das konnte man leicht als blosse, in
diesen Zeitläuften nur allzu gewohnte Einleitungsfloskel nehmen.
Im zweiten Artikel wird die Ohm- und Umgeld-Frage mit geschicktern
Dreh auf eine andere Ebene geschoben: alle Beschwerden
rührten nur daher, dass die verschiedenen Aemter eine verschieden
hohe Steuer bezahlten, «in etlichen Aemtern nur 4 gute Schilling, in
andern 5 oder 8 von einem Saum oder 100 Maass»; gerecht sei aber,
«dass im ganzen Land eine Gleichheit gemacht» werde, und so benutzte
man die Gelegenheit, die Steuer für alle zu erhöhen, indem fortan in
allen Aemtern «von jedem Saum, 100 Maass gemeint, 10 Luzerner
Schilling gegeben werden sollen»! «Dieses Recht sollen die Unterthanen
nicht widersprechen...» Von Erhebung des Ohmgeldes durch die
Aemter, von diesem in den Flitterwochen des Aufruhrs erhobenen Anspruch
auf ein Zipfelchen Steuerhoheit, ist natürlich mit keinem Wort
die Rede.
Der dritte Artikel verweigert, ohne es ausdrücklich zu sagen, die
Rückerstattung der Reisgelder (Militärsteuer), die von einigen Aemtern
zur Deckung der Kriegskosten für den Feldzug in den Thurgau anno
1647 erhoben worden waren, während die am Auszug beteiligten Aemter
mit dem Reisgeld verschont wurden. Auch dies geschieht mit einem
geschickten Dreh der «Gleichberechtigung»: da die Stadt jetzt «erklärt
hat, dass, wenn es inskünftig wieder zu einem Auszuge, so Gott wenden
wolle! kommen sollte, sie anderer Aemter Unterthanen in den Auszug
nehmen und ziehen, und selbigen mit dem Reisgeld auch verschonen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 144 - arpa Themen Projekte
Niklaus Leuenberger
Unveröffentlichtes Oelgemälde im Besitz von Frau Dr. Grand-Witz
in Basel, einer Nachkommin Leuenbergers.
Wohl die erste zeitgenössische Konstruktion nach dem Gefangenenbild
der Berner Herren.
Im Hintergrund: links ein brennendes Dorf, davor exerzierende
Kavallerie; rechte ein Galgen mit aufgenageltem Kopf.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 144 - arpa Themen Projekte
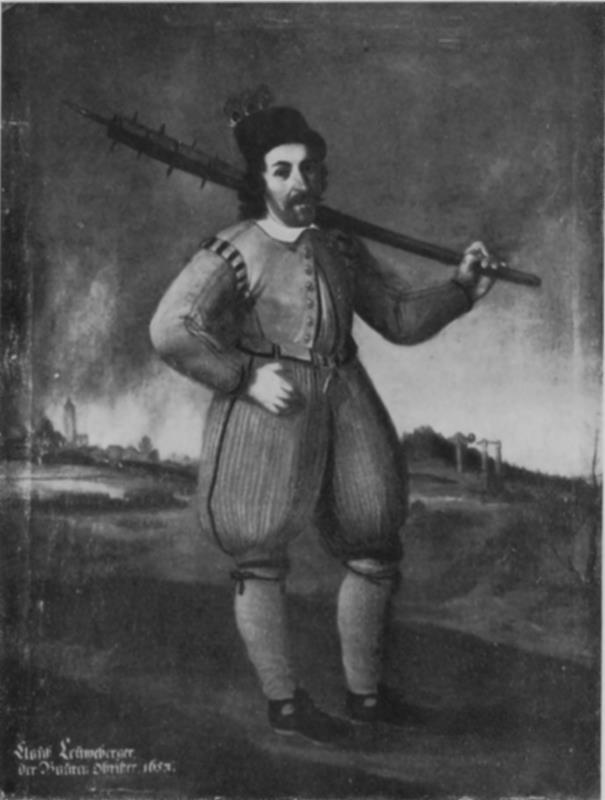
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 145 - arpa Themen Projekte
wolle, so lassen Wir es dabei bewenden». Das kostete die Luzerner
Herren keinen Schilling, ja stipulierte noch das «Recht» auf künftige
Ausplünderung der «anderen» Aemter für Kriegszwecke — gab aber
dem Volk den Eindruck von ausgleichender Gerechtigkeit. Dabei hätten
diese Aemter ihres guten Geldes zur Abwendung der bitteren Not
in ihren Dörfern dringender bedurft als der Hoffnung auf künftige Ausplünderung
der Nachbarämter! Darum ja auch haben die Entlebucher
in Werthenstein den Luzerner Herren gegenüber so sarkastisch triumphiert,
dass sie zwar das Reisgeld zusammengelegt, aber gottseidank
nicht nach Luzern abgeliefert hätten; jetzt konnten sie den Schatz für
ihren Krieg gegen die Ausplünderung durch die Herren brauchen...
Der Rest dieses Artikels ist ein Entgegenkommen gegenüber den Entlebuchern
bezüglich ihres Appellationsrechtes in Geldprozessen; man
soll nicht mehr für jede Bagatelle vor Gericht gezogen werden können,
nur noch für Beträge von 100 Gulden und mehr, wie es in alten Briefen
von 1491 und 1517 steht.
Erst mit Artikel Vier betreten wir politisch ganz heissen Boden:
das Recht der «Beherrschung und Besetzung der Aemter der Stadt und
Landschaft Willisau». Gegen diesen Artikel haben sich in der Folgezeit
die Willisauer stets mit Händen und Füssen gewehrt, immer treu sekundiert
von den Entlebuchern und überhaupt von den meisten Aemtern.
Niemals sei in Ruswil über diesen Punkt so verhandelt, geschweige
abgeschlossen worden. Jedes Recht der Aemterbesetzung
wird den Willisauern in diesem Artikel abgesprochen! Dabei hatten
die Luzerner Herren während der Ruswiler Verhandlungen einmal die
Wahl des Stadtschreibers, einmal die des Grossweibels und beider zusammen,
einmal gar die aller drei Häupter mit Einschluss des Schultheissen
zugesagt —jedoch, wie wir sahen, nur als Lockmittel, um diese
Hochburg des Aufruhrs zu spalten. Jetzt werden Stadtschreiber und
Grossweibel überhaupt nicht mehr erwähnt; der Schultheiss soll natürlich
ebenfalls vom Luzerner Rat erwählt werden, aber — als besondere
Gnade — aus den Bürgern von Willisau. Dass er dabei darauf
rechnen konnte, unter diesen die eine oder andere Kreatur seines Willens
zu finden, haben wir ebenfalls bereits gesehen. Ueberdies soll der
Landvogt, den die Willisauer um keinen Preis in ihrer Stadt dulden
wollten, grad extra in deren Mauern «Residenz und Wohnung»
haben.
So lautet denn dieser wichtigste Artikel — ausser dem siebenten
und neunten — wörtlich: «Die Beherrschung und Besetzung der
Aemter der Stadt und Grafschaft Willisau betreffend, dieweil eine
solche ein Stück von der oberkeitlichen Jurisdiktion ist und diese hiemit
einzig der Stadt Luzern zuständig erkennt ist» (eben dies war ja
bestritten! aber was am heissesten von den Bauern bestritten, ward
von Oberst Zwyer stets am selbstverständlichsten vorausgesetzt!), «soll
derowegen einer löbl. Stadt Luzern frei stehen, ihrem jeweil verordneten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 146 - arpa Themen Projekte
dass Unsere G. L. A. Eidgenossen das Schultheissenamt aus den Bürgern
von Willisau besetzen wollen; jedoch wenn sie, die Stadt Willisau,
mehrere Gnade (!) erhalten könnte, lassen Wir es bewenden und Uns
gefallen»!
Dieser Artikel, mit allem, was darin und dahinter steckt, ist das
ganz spezielle Werk des Obersten Zwyer, der sich stets — der «Vermittler»!
— mit aller Kraft gegen diejenigen Mitglieder des Luzerner
Rats gestemmt hatte, die Willisau entgegenkommen wollten, um diese
Stadt gewinnen und gegen die Bauern kehren zu können. Hierin führte
Zwyer nur den geschichtlichen Auftrag der Herrenklasse der ganzen
Schweiz durch, die bei der endgültigen Aufrichtung des Gebäudes ihrer
absoluten und autoritären Alleinherrschaft nicht die geringste Ritze
offen lassen durfte, durch welche der Spalt pilz der demokratischen
Revolution ins Innere des Gebäudes hätte dringen können. In dieser
Hinsicht sah der zeit- und welterfahrene Zwyer viel klarer als die in
jeder Hinsicht subalternen Luzerner Oberen. Er erkannte, dass der Gewinn
durch die Köderung Willisaus, auch wenn sie geglückt wäre, nur
ein zeitweiliger, der Schaden durch die Bewilligung grundsätzlicher
demokratischer Rechte aber ein dauernder und für das ganze aristokratische
System gefährlicher gewesen wäre. Er erzog damit Luzern
zur obersten Stufe der vorgerücktesten absolutistischen Regierungsform,
wie sie die Stadtstaaten der protestantischen Kantone Bern, Zürich
und Basel darstellten — er, Zwyer, der Vertreter des katholischen
und angeblich erzdemokratischen Landkantons Uri!...
Der fünfte Artikel ist ein blosser Anhang zum vierten und regelt
ein Kostendetail der prunkvollen und kostspieligen Aufritte des Landvogts
ein ganz klein wenig zugunsten der Willisauer.
Dagegen ist der sechste Artikel von grundsätzlicher Bedeutung. Er
lautet kurz und bündig (in der modernen Transskription unseres katholischen
Herrenchronisten): «Da die Grafschaft Rothenburg mit Hinsicht
auf den Spruchbrief von 1570 selbst bekennt, dass sie die Aemterbesetzung
nur als Gnade begehren könne, so wird sie an die Stadt
gewiesen.» Damit werden die Rothenburger, von «alten Brief und
Siegeln» an Händen und Füssen gebunden, an die Gnade ihrer «Gnädigen
Herrn und Obern» ausgeliefert. In diese Lage hat sie die höchst
zweideutige jesuitische «Diplomatie » Kaspar Steiners hineinmanövriert!
Die Artikel Sieben und Neun — sie gehören zusammen wie Vorder-
und Rückseite einer Medaille —befassen sich endlich mit dem
brenzlichsten Punkte: dem Wolhuser Bund. Artikel Sieben soll das
Gebäude des Bundes mit schwerstem Geschütz in Grund und Boden
schiessen; Artikel Neun die dadurch Verschütteten sich schuldig bekennen
und um Gnade und Errettung flehen lassen, worauf sie, zum
guten Ausgang des Ganzen, als vollendete Sklaven straflos wieder in
Gnaden angenommen werden sollen. Dadurch sollten besonders die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 147 - arpa Themen Projekte
Aber es ist ohne weiteres zu glauben, dass, wie diese von nun an standhaft
bis zum Ende versicherten, bei der Abfassung dieser beiden Artikel
niemals ein Entlebucher — noch irgend ein anderer Bauer —dabei
war, ja dass die Bauern allesamt die ganze Frage des Wolhuser Bundes
«nie den Schiedsrichtern zum Entscheide anheimgestellt» haben.
Selbst die Versicherung der Bauern insgesamt kehrt von nun ab immer
wieder: «die Artikel 7 und 9 des rechtlichen Spruches seien ihnen
auch nie vorgelesen worden», oder «beim Ablesen von den Zuhörern
gar nicht gehört worden»! Gerade diese Artikel also müssen es gewesen
sein, die von Oberst Zwyer in Ruswil dem «Vermittlungs»-Werk
stillschweigend untergeschoben und beim Ablesen auf der Krienser
Allmend ganz oder teilweise unterdrückt worden sind! Wir begreifen
sowohl die Bauern wie Herrn Oberst Zwyer, wenn wir die Artikel im
Originaltext lesen (nicht so sehr in der stark gekürzten modernen Zusammenfassung
unseres katholischen Luzerner Herrenchronisten, die
sich trotzdem den Schein des Wortlautes gibt):
Artikel 7 (bei Vock 8): «Demnach die X Aemter, zu Behauptung
ihrer unterschiedlichen Beschwerden und Forderungen, zu Wollhausen
einen Bund gemacht und leibliche Eide zusammengeschworen und
mit gewaffneter Hand und offenen Fähnleins darüber vor die Stadt
gezogen sind, solche unzulässliche Sachen aber in unserer Eidgenossenschaft
nicht Herkommens haben» (wenn das «in unserer Eidgenossenschaft
nicht Herkommens» hat — ja, wie ist denn die Eidgenossenschaft
überhaupt entstanden?... Aber, wie schon früher bemerkt:
es gab längst zwei Vaterländer in dieser «Eidgenossenschaft»!, «so haben
Wir solchen Bund und den gethanen Eid mit dieser Unserer rechtlichen
Erkenntnis aufgehoben, für null und nichtig erklärt, und dabei
erkennt, dass mehrgemeldete Unterthanen nicht dergleichen Bündniss
und Eid mehr errichten, nicht mehr zusammenlaufen, noch weniger
die Waffen also ergreifen, sondern, auf vorfallende Beschwerden, ein
oder das andere Amt» (nicht verbündet!) «sich bei seiner ordentlichen
Obrigkeit unterthänig anmelden, und, welche sich (liess falls übersehen
würden, als an ihrer Obrigkeit treulos gestraft werden sollen» (das
hiess nach damaligem Recht ohne weiteres enthauptet!).
Artikel 9 (bei Vock 10): «Demnach mehrermeldete X Aemter
hochbedauern (!), dass sie vorangezogene Verbindung und Eid, zwar
nicht in böser Meinung, sondern aus Einfalt, Unbedachtsamkeit und
vorgemeldeter nothdringender Angelegenheit, gethan» (dieser Passus,
wie auch ein späterer dieses Artikels, hat dem Obersten Zwyer schwere
Vorwürfe seitens der Tagsatzungsherrn, besonders aber der Berner,
eingebracht: als «diesen der Vernunft beraubten Menschen» gegenüber
weitaus zu «milde». Wir werden ja sehen, was die Bauern dazu
sagten!), «und daher Uns angelegentlich gebeten (!), bei ihren GH Herren
und Obern von Luzern in ihrem Namen unterthänig und gehorsam
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 148 - arpa Themen Projekte
Bitte, und Uns zu besonderen Ehren und Respekt, Unsere G. L. A. Eidgenossen
(d. h. die Herren von Luzern) um Gnad' und Auslöschung
dieses bekannten Fehlers (!!) gebeten, also dass Alles, was in diesem
Aufstand mit Rath und That, mit Worten und Werken, wie das Namen
haben mag, zwischen einer Obrigkeit und Bürgerschaft eines
Theils und den Unterthanen andern Theils verlaufen ist und sich zugetragen
hat, allerdings (in allen Dingen) aufgehoben, keinem an seinen
Ehren, guten Namen, Leib und Gut schädlich oder nachtheilig,
sondern dergestalten absein und dessen fürohin nicht gedacht, sondern
gehalten werden solle, als wenn es nie geschehen wäre» (für diesen
ganzen Passus gilt ebenfalls das oben in Klammern Gesagte),
«hierum aber heiter (klar) vorbehalten, welcher inskünftig von diesen
Sachen ungute Reden, Verweis und Schmachworte, ungebührliche
Worte brauchte, dass alsdann der Obrigkeit obliegen solle, die Fehlbaren
nach Verdienen abzustrafen, —und, demnach während diesem
Handel und Auflauf etlichen Leuten das Ihrige angegriffen und geplündert
worden, dass hierum fleissig solle nachgefragt werden, und,
wenn die Thäter erfahren würden, sollen sie unmaassgeblich (rücksichtslos)
angegriffen, und zur Ersetzung des gethanen Schadens angehalten
werden». (Man ersieht aus diesem Schriftstück nebenbei, dass
der Oberst Zwyer kein besserer Stilist war als der Schulmeister Johann
Jakob Müller, der den Wolhuser Bundesbrief abfasste — durchaus
im Gegenteil!)
In dem zwischen diesen beiden Artikeln eingeschobenen Artikel
Acht wird das Begehren der Aemter Entlebuch und Willisau um Ersetzung
der Kosten natürlich rund weg abgewiesen, sodann erklärt, man
hätte wohl umgekehrt «Ursache gehabt, ihnen diese Kosten aufzulegen»;
dann aber wird die gnädige Geste gemacht:. «Wir aber haben
doch, zu guter Versöhnung und von des Besten wegen, den Kosten
allerseits aufgehoben.»
Das ganze Schriftstück endigt mit der Ankündigung, dass dieser
«Rechtliche Spruch», in allen Aemtern verlesen werden soll, «und
nach solcher Abhörung soll jedes Amt seinem Landvogt zu Handen löblicher
Stadt Luzern wieder mit einem leiblichen Eide, wie bei jedem
Amte das Herkommen ist, schwören, und sich hin! füre, wie es getreuen,
ehrliebenden Unterthanen gebührt, gegen ihre natürliche, von Gott gesetzte
Obrigkeit betragen und verhalten». Das sollte das Siegel auf die
restlose Unterwerfung der Bauernklasse unter den Willen und die
Willkür der Herrenklasse sein.
Aber es kam Alles ganz anders.
Schon über den unmittelbaren Ausgang dieser so unrepräsentativen
Zufallsversammlung der Bauern muss unser moderner katholischer
Herrenchronist höchst merkwürdige Dinge berichten: «Nachdem
Oberst Zwyer den Spruch eröffnet hatte, stoben die Bauern in wilder
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 149 - arpa Themen Projekte
haben, wohl aber vielleicht die Angst und die Panik — trotz der
zugesagten «Straflosigkeit». Denn die Bauern kannten das Worthalten
ihrer Herren! «Auf die Anfrage Zwyers an die Delegierten, ob sie den
Spruch annehmen, dankten die Luzerner (!) den Gesandten für ihre
Bemühungen und gelobten, dem Spruche treu nachzukommen» —-das
versteht sich! «Von den Delegierten der Aemter anerkannten nur einige
den Spruch sofort»! Was mögen das für «Delegierte» gewesen sein? Es
war für diesmal die Spreu, die liegen blieb, während der Weizen davon
stob: es waren die paar Spione und Kapitulanten, die von den Herren
den zugesagten Lohn erwarteten! Die waren es denn auch natürlich,
die mit den Herren in die Stadt zogen, um deren Sieg mitzufeiern.
Denn, wie unser Herrenchronist weiter berichtet:
«Unter dem Donner der Geschütze und dem Klange der Glocken
wie unter Musikbegleitung kehrten die eidgenössischen Gesandten mit
den Räten von Luzern und einem Teile der Delegierten der Bauern in
die Stadt zurück, wo der Abschluss des Friedens festlich begangen
wurde. Da aber bald die Kunde einlangte, noch stehe die Hauptmacht
der Bauern an den Wagenbrücken der Emme und Reuss, welche in der
Nacht geschlagen worden waren, und denke nicht daran, das Feld zu
räumen, so wurden gleich wieder ernste Beratungen gepflogen. Aus
diesem Grunde wurde dem rechtlichen Spruche schon am 19. März
noch die weitere Bestimmung beigefügt, dass die Mannschaft der Untertanen
heute noch von ihren Standorten aufbrechen und heimziehen
soll, worauf am folgenden Tag die Stadt Luzern das fremde Volk entlassen
und damit der Ruhestand eintreten soll.» Diese wichtige Bestimmung
wurde ohne den Partner einfach «beigefügt»! Recht so —
da weiss man doch wenigstens, wie dieser Spruch auch sonst zustandekam!
Oder waren den Herren von Luzern und den «Ehrengesandten»
die «ehrlichen, ehrsamen, biderben» bezahlten Spione und Kapitulanten
als Partner gut genug?
Aber die «Hauptmacht» der Bauern, und mit ihr gewiss ihre
wirkliche Führerschaft, war ja bereits am Tag zuvor ins Rothenburgische
und noch weiter nördlich gezogen, weil sie das Opfer der unseligen
Berner-Panik geworden war und diesem gefürchtetsten Feind unverzüglich
entgegentreten wollte. Sonst hätten die Herren in Luzern
den Stephanstag ganz gewiss nicht als Freuden- und Friedenstag
feiern können! Mit dem zusammenbrechenden Gerücht aber fiel auch
die «Hauptmacht» der Bauern, ohnehin schlecht ernährt und geführt,
schliesslich von selbst auseinander. Dies umsomehr, als der Schuss in
den Rücken, der schmähliche Ueberfall von innen, den Zwyer mit seinem
«Rechtlichen Spruch» vollführte und gewann, vorläufig nur verwirrend
und lähmend auf Führer und Volk der Bauern zurückwirken
konnte...
Ein böses Zeichen für die Herren aber war, dass unter dem Druck
des Zorns und der Wut der Rothenburger über die erlebte Enttäuschung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 150 - arpa Themen Projekte
in Artikel 6 des Spruchbriefs — selbst Kasper Steiner, der bereits fast
der Vertraute der Herren geworden war, urplötzlich wieder rebellisch
wurde. Noch am Neunzehnten hielt er eine einstündige Ansprache an
das Volk, in der er «das Volk ermahnte, ihm beizustehen, dass das
Amt die Aemterbesetzung erhalte». Ihm beizustehen, der die Hauptschuld
daran trug, dass die Herren Zwyer und Konsorten glaubten,
das Amt Rothenburg so schmählich behandeln zu dürfen! Aber wie weit
Steiners «Diplomatie» mit den Herren bereits gegangen war, war dem
Volk noch nicht bekannt, und Steiner hatte sich bisher stets bemüht,
sie mit seiner «kriegerischen» Rolle als «Oberst» der Rothenburger zuzudecken.
Das gelang ihm auch wieder mit dieser Rede, in der er «in
frecher Weise behauptete» — wie unser moderner Herrenchronist
meldet —, «das Amtsbuch sei vor Jahren verloren gegangen und von
der Obrigkeit unterschlagen worden», was gewiss nicht grundlos die
Meinung sämtlicher Rothenburger seit dem grossen Aufruhr anno
1570 war. Das aber gefiel den Bauern sehr, und damit sass Kaspar
Steiner bei ihnen wieder im Sattel. Den Entlebuchern schrieb er kurz
darauf, sie möchten ihm für seine Forderung ebenfalls beistehen; er
berief sich dabei auf den verfemten Wolhuser Bund, der die Abschaffung
aller seit 100 Jahren eingeführten Neuerungen verlange, unter
welche also auch der Raub des freien Wahlrechts durch den Spruchbrief
von 1570 falle. Zum Schluss hatte er, der durch seine geheimen
Sonderverhandlungen mit den Herren den Wolhuser Eid bereits gebrochen
hatte, die Kühnheit, den Entlebuchern zu schreiben: «Man
schilt uns meineidige Lüt: ich mein, wir wollens nit sin»! Vermutlich
hat der ehrgeizige Kaspar Steiner, der nach der Nachrede der Herren
«Graf von Rothenburg werden wollte», nur die sehr begründete Befürchtung
gehegt, dass er das führende Amt in der Grafschaft Rothenburg
von den Herren, trotz der ihnen geleisteten Dienste, doch nicht
zum Lohn erhalten werde. Und als er die einmütige Empörung der
Bauern über den «Rechtlichen Spruch» erlebte, da schien ihm die
Spekulation auf den revolutionären Erwerb des führenden Postens
wieder aussichtsreicher. Trotzdem die Herren nun zwar auch jetzt
wohl wussten, wen sie an Kaspar Steiner hatten wenige Tage später
hat sich dies eindeutig erwiesen —, so war es doch für sie ein schlimmes
Zeichen für die herrschende Volksstimmung, dass Steiner es jetzt
für nötig hielt, seine Hoffnung wieder auf diese zu setzen.
In der Tat liefen schon am Abend des Neunzehnten und im Lauf
des Zwanzigsten derart alarmierende Nachrichten über den ungebrochenen
Trotz und die unversöhnliche Wut der Bauern beim Rat von
Luzern ein, dass dieser wieder einmal unter einer Panik zusammensackte.
Tatsächlich traute der Luzerner Rat seinem bereits gefeierten
Siegfrieden vom St. Josephstag so wenig, dass er am Zwanzigsten schon
wieder ein geradezu verzweifeltes Hülfsgesuch an die vier Urkantone,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 151 - arpa Themen Projekte
ausgeschlagen, dass wir kein übriges Mittel haben noch wissen,
als dass wir uns auf die Extremität versehen»!
Bis zum Vierundzwanzigsten scheinen sich die Herren in Luzern
allerdings wieder ein wenig beruhigt zu haben. Obschon sie gerade
jetzt mehr Ursache gehabt hätten, vor neuen, viel härter angreifenden
und viel weiter ausgreifenden Plänen zu zittern, zu denen die Bauern
sich inzwischen erstaunlich rasch wieder aufgerafft hatten, wenige
Tage nach dem Betäubungsschlag der Niederlage, die ihnen der Verrat
Zwyers beigebracht hatte. Immerhin enthält ein Brief, den der alte
Fuchs, der dreiundachtzigjährige Schultheiss Ritter Heinrich von
Fleckenstein, am Vierundzwanzigsten an seinen Vertrauten, den Abt
Dominik von Muri schrieb, neben einer halben Beruhigung auch eine
gewisse, vom Misstrauen eingegebene Witterung der kommenden Dinge.
Er schreibt: «Der Friede mit den Bauern ist zwar mager ausgefallen:
aber lieber ein magerer Friede, als ein fetter Krieg. Die Kriegsvölker
sind nach Hause gezogen. Wir müssen nun sorgen und den Bauern
nicht zu viel vertrauen; denn alle sind über den gleichen Leisten geschlagen.
Sie haben auch in den Ländern durch ihre lügnerischen Vorgaben
viele Anhänger gewonnen.)> «In den Ländern», das heisst: in
den umliegenden Kantonen!
Inzwischen aber gingen höchst merkwürdige und beunruhigende
Schreiben der Bauern —nicht beim Rate von Luzern, den ignorierten
sie jetzt vollständig, aber — bei sämtlichen «Ehrengesandten» und
ihren Regierungen, den Räten der «Länder», ein. Schon am Einundzwanzigsten
und Zweiundzwanzigsten nämlich waren die Ausgeschossenen
der vier Aemter Entlebuch, Willisau, Rothenburg und Ruswil
offen wieder in Ruswil versammelt — allen Drohungen zum Trotz,
dass sie dadurch «ir Lyb und Laben 1000 feltig verwürkt hettend».
Und sie schrieben von dort den Herren «Ehrengesandten» der sechs
katholischen Orte, «wie an diese Orte selbst», hochoffiziell ihre wirkliche
und wahre Meinung über den «Rechtlichen Spruch»: dass nämlich
dieser Akt «ein gefälschtes Machwerk» darstelle, «das keineswegs
das Ergebnis der Verhandlungen richtig reproduziere». Es seien in diesem
Spruch «empfindliche Wörter gesetzt worden, die wir nicht hinnehmen
können. So heisst es darin: wir hätten Euch inständig, unterthänig
und hoch gebeten, für uns bei der Obrigkeit um Gnade und
Verzeihung zu bitten, wir hätten selbst bekannt, dass wir mit dem
Bund zu Wolhusen einen grossen Fehler begangen hätten. Das können
wir nicht eingestehen; wir verlangen deshalb von den Gesandten klaren
Bericht, wer solches gethan habe»! «Weder bei den gütlichen noch
bei den rechtlichen Verhandlungen sei bestimmt worden, dass die 10
Aemter vom Eidschwure abstehen sollen»! «Den Artikel über Entkräftigung
des Bundes können sie also nicht annehmen. Sie verlangen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 152 - arpa Themen Projekte
angeführt werden, damit nicht aller Unglimpf auf den Bauern läge,
da sonst der Spruch ihnen und ihren Nachkommen zu Ärgern und Unheil
gereichen würde»! Und von dem so nach ihrem Willen umzugestaltenden
Spruchbrief verlangten sie, dass ihm noch ein weiterer Artikel
eingefügt werden solle: «Dieser gütliche und rechtliche Spruch soll
ewig und unwiderruflich, steif und stät gehalten werden.»
Da endlich vernehmen wir wieder die ernste Stimme der hohen
Rechtlichkeit Hans Emmeneggers! Da auch den von einer gewissen
Feierlichkeit der Verantwortung getragenen geschichtlichen Sinn Johann
Jakob Müllers. Denn nun waren sie beide wieder die Seele der
Erneuerung des angefochtenen Bundes.
Freilich: die Niederlage hatten sie beide mit zu verantworten.
Doch das lag nur an den Grenzen ihrer Fähigkeit, Krieg zu führen.
Dafür verstanden sie sich besser auf das Bünde-Errichten. So zogen
sie aus ihrer Verantwortung tapfer den Schluss: ein viel grösserer, viel
stärkerer, die ganze Bauernklasse der Schweiz umfassender Bund muss
errichtet werden!
Das war ja von allem Anfang an, seit er für die Sache der Bauern
gewonnen war, der grosse Traum des Schulmeisters gewesen, wenn er
ihn vielleicht auch von Hans Emmenegger und vielleicht gar von
Käspi Unternährer übernommen hatte. Vielleicht hatte man bisher nur
zu wenig auf den Rat Johann Jakob Müllers gehört, der ja auch zu
raschem Zugreifen angefeuert hatte, als es noch Zeit war, und die Stadt
Luzern schon am achten März stürmen lassen wollte. Jetzt erst, nach
der traurigen Erfahrung mit den Diversanten und Kapitulanten, wurde
die Zeit reif für seine und Hans Emmeneggers weitausschauenden
Pläne.
So sandten sie ihre Sendlinge nun nicht nur in alle luzernischen
Aemter, sondern auch «in die Länder», das heisst: in alle Kantone
ringsum, aus, um dort überall «Brüder» für ihren Bund zu erwecken
und zu sammeln. Sie verbreiteten dabei zahlreiche Abschriften ihrer
«schonungslosen Kritik» des «gefälschten Machwerks» des Obersten
Zwyer; das war der richtige, konkrete Ausgangspunkt. Sie hatten damit
grossen Erfolg und brachten auf diesem Wege in wenigen Tagen
die Mehrheit der Bauern in Nidwalden und im Kanton Zug auf ihre
Seite, sodass sogar die Räte beider Kantone sich weigerten, die Tagsatzung
zu beschicken. Daran hatte um den Vierundzwanzigsten der
eifrige Sendbote Stephan Lötscher, besonders in Nidwalden, grossen
Anteil; ja, am Sechsundzwanzigsten wurde Johann Jakob Müller so'
gar als offizieller Gesandter des Landes Entlebuch an den Rat von
Unterwalden delegiert und von diesem empfangen, «um namens der
10 Aemter gegen die ehrverletzlichen Reden zu protestieren, die wider
sie (die Entlebucher) geführt worden». «Mit ähnlichen Gesuchen gingen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 153 - arpa Themen Projekte
die Entlebucher —wir lassen das Wort dem modernen Luzerner
Herrenchronisten —«eigens an die verschiedenen eidgenössischen und
benachbarten Orte ihre Botschafter, um die Revolution und den Wolhuser
Bund so unschuldig wie möglich hinzustellen und die Regierung
von Luzern des Treubruches zu beschuldigen». «Die Emissäre der
Bauern benutzten damals auch die Gelegenheit, im ganzen Lande die
Vermittler der Bestechung anzuklagen, die nur durch Miet und Gaben
des Rates von Luzern dazu gekommen seien, nach Willkür zu urteilen.»
So sagt unser moderner katholischer Luzerner Herrenchronist —
ohne diese Vorwürfe zu widerlegen! Solche Sendboten, fast immer
Entlebucher, gingen auch in die Kantone Zürich, Solothurn und Basel,
vor allem aber, und das war für den künftigen Bund entscheidend, in
den Kanton Bern, ins Emmental, in den Oberaargau und in die Grafschaft
Lenzburg.
Denn nun waren auch die Berner Bauern endlich geschlossen aufgestanden
und hielten vom Dreizehnten ab in Langnau und am Vierundzwanzigsten
in Trachselwald ihre ersten, nicht bloss regional emmentalischen,
sondern fast ebenso alle Hauptteile des Landes umfassenden
Landsgemeinden ab, wie sie die Wolhuser Versammlung gewesen
war, wenn auch diese Landsgemeinden für die Berner noch
nicht das eigentliche «Richtfest des Aufruhrs» bedeuteten. Diese erregende
Nachricht war bereits am Fünfundzwanzigsten bis nach Altdorf
in Uri gedrungen, wo an diesem Tage der Oberst Zwyer ein Rechtfertigungsschreiben
auf jenen Angriff der vier Aemter verfasste, in dem
sie ihm sein «gefälschtes Machwerk» zerpflückt hatten. Um seine Reputation
zu retten, gab er nun dem bernischen Aufstand die Schuld am
Misserfolg seines «Machwerkes» bei den Luzerner Bauern! Nachdem
nämlich der grossmächtige Feldmarschall «die Frage über die Gültigkeit
des Wolhuser Bundes» diktatorisch als «ganz unwidersprechlich
zu Recht gesetzt worden» erklärt hat, um dann sogleich «in Bezug auf
die Abbitte» der Bauern revozieren zu müssen, diese sei allerdings «so
inständig nie begehrt worden», schliesst er den Brief mit dem Saltomortale:
«Wäre der bernische Aufstand nicht erfolgt, so hätten die
4 Aemter diesen Prätext nicht gebraucht»!
So zweifelhaft dies nun auch in Ansehung der Daten sein mag,
so ersehen wir doch aus dieser Verwendung der neuen Tatsache, welch
tiefen Eindruck dieselbe in der ganzen Schweiz auslöste. Denn in ihr
zeichnete sich zum erstenmal die Möglichkeit einer die ganze Eidgenossenschaft
umfassenden Bauernbewegung klar und unmissverständlich
ab.
Die Baumeister des neuen, werdenden Bauernbundes über die
«Länder»-Grenzen hinweg waren wieder in allererster Linie die Entlebucher.
Die meisten und überall am wärmsten begrüssten Sendboten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 154 - arpa Themen Projekte
und initiativ denkenden Bauern waren es wiederum die unbeugsamen
Bürger von Willisau, die die stärkste Säule auch des neuen, umfassenderen
Bundes aufrichteten. Die Willisauer waren sofort nach der Verkündung
des «Rechtlichen Spruchs», der ihnen jedes Recht zur freien
Aemterbesetzung absprach, trotzig darüber hinweggeschritten, hatten
ihre Aemter neu mit Männern ihrer Wahl besetzt und die «obrigkeitstreuen»
Herren zum Teufel gejagt. Ja, sie erhoben am Sechsundzwanzigsten
sogar erneut die «hochverräterische» Forderung, dass die Mandate
(Gesetze) der Luzerner Regierung, bevor sie gültig werden können,
«an die Gemeinden zur Approbation durch das Volk» gehen sollen!
Sie waren es auch, die Anfang April die Entlebucher zu einer
neuen Einberufung der Ausschüsse aller zehn Aemter nach Willisau
veranlassten. Ebenso wurde Willisau zur eigentlichen Wiege des neuen
Bundes, indem die Bürger von Willisau, angefeuert von Hans Diener
aus Nebikon, bereits Anfang April den Anschluss der solothurnischen
Stadt Olten an den Bund eifrig betrieben und ihn dann, noch vor Mitte
April, zusammen mit zwei Entlebuchern, in einer feierlichen Versammlung
auf dem Rathaus zu Olten auch wirklich erreichten. Ausserdem
veranstalteten sie all die Zeit über im ganzen Land herum Schützenfeste,
um den Geist des neuen Bundes auszubreiten.
Gewiss hatte die grosse Masse der Luzerner Bauern zunächst eine
ohnmächtige Wut und Scham von der Niederlage nachhause gebracht;
Wut und Scham darüber, dass man die Katze, die man doch im Sack
gehabt, so sinnlos hatte laufen lassen müssen. Als ihnen jedoch nun
die Sendboten des Hans Emmenegger und des Schulmeisters Johann
Jakob Müller, aber auch die Schützenfeste der Willisauer, die Augen
öffneten und ihren Blick über die Grenzen in die «anderen Länder»
richteten, da hielt die Masse der Bauern wie die der Willisauer Bürger
treu zu den Erdauern des neuen Bundes. Da brach sich die ganze,
dumpfe Wut des betrogenen Volkes in wenigen Wochen Bahn zu einer
ganz neuen Hoffnung und zu einer noch viel entschlosseneren und viel
weiter ausgreifenden Tätigkeit.
Dass eine solche jetzt aber überhaupt möglich war, das beruhte —
ausser der dafür grundlegenden allgemeinen Bauernnot in der ganzen
Eidgenossenschaft — auf zwei Ereignissen, die inzwischen eingetreten
waren.
Das eine war das «Gemeine Mandat», das die Tagsatzung in Baden
am Zweiundzwanzigsten gegen die Bauern erlassen hatte, «worin sie»
— wie ein Berner Geschichtschreiber des Bauernkrieges sagt — «die
aufständischen Bauern in rücksichtslosen Worten als Unruhestifter
und schlimme Aufwiegler darstellte». Ja, wie sogar unser moderner
Luzerner Herrenchronist den Sinn dieses Mandats wiedergibt: «Hier
wurde das Gebaren der 10 luzernischen Aemter als der Eidespflicht,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 155 - arpa Themen Projekte
Fehler und Mutwillen, entsprungen aus unwahren Vorgaben etlicher
weniger verdorbener, in Nöten und Schulden steckender Personen.
Zusammenrottungen wurden mit Strafe an Leib und Leben bedroht.
Alle Schmachreden gegen Regierungen sollten angezeigt werden.» Und
mehr als das: darin wurden «die Untertanen... zur Verhaftung und
Auslieferung der Rebellen ermahnt»! «Endlich wurden die Defensionalsanstalten
festgesetzt, für den Fall, dass wieder ein Ort von seinen
Untertanen angefochten würde, abgesehen von der Frage, wer
Recht oder Unrecht habe. Hierbei wurde die Formation von drei grossen
Armeen in Hitzkirch, Lenzburg und Brugg in Aussicht genommen.»
Da müssen wir dem Berner Geschichtschreiber recht gehen, wenn er
aus diesem Mandat und aus diesen «Defensionalanstalten» die Schlussfolgerung
zieht: «Ausdrücklich stellten also hier die Kantone den
Grundsatz der brutalen Gewalt auf.»
Mehr als alles Andere hat dieses wirklich, im heutigen Wortsinn,
«gemeine» Mandat und haben die Beschlüsse des eidgenössischen Herrenklubs
in Baden der allgemeinen Not der Bauern das Signal zum allmeinen
Zusammenschluss und zum gemeinsamen Aufstand gegeben.
Denn auf Gewalt gibt es nur eine Antwort: Gewalt, — wenn man nicht
Sklave sein will. Und das wollte kein Schweizer Bauer sein. Wir müssen
also diesem eidgenössischen Zwischenspiel, dessen wahrhaft «aufrührerisches»
Werk erst allmählich in die Massen drang, zu gegebener
Zeit die nötige Aufmerksamkeit zuwenden.
Die unmittelbar in den Gang der Dinge eingreifende Tätigkeit dieser
Tagsatzung galt jedoch nicht dem Luzerner Aufstand — der fürs
erste durch Herrn Oberst Zwyer «geschlichtet» war —, sondern dem
Berner Aufstand, der mit schärfstem Druck bereits in der Wiege erstickt
werden sollte.
Ohne diesen Aufstand, der, wie wir wissen, schon lange in der Wiege
lag; ohne die ungewöhnlich zähe Arbeit der Berner Bauern, der Emmentaler
und der Oberaargauer, die ein Hand-in-Hand-Arbeiten mit
den Luzerner Bauern, besonders und von Anfang an mit den Entlebuchern
war, wäre in der Gesamtbewegung der Bauern nichts weitergegangen.
Ohne sie wäre auch die Luzerner Bewegung in sich zusammengestürzt
und erstickt; so gewiss es andererseits ist, dass die Hartnäckigkeit
der Entlebucher auch an der Wiege des Berner Aufstandes
gestanden hatte.
Dem Werden und Wachsen des Berner Bauernaufstands haben
wir uns also nun zuzuwenden, wenn wir begreifen wollen, wie der
grosse Zusammenschluss aller aktiven Kräfte der ganzen Bauernklasse
der Schweiz zustandekam — zum letzten «souveränen» Akt ihrer
Selbstbehauptung als unabhängig handelnde Klasse in der Geschichte.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 157 - arpa Themen Projekte
|
Der Sumiswalder und Huttwiler Bund
(«Volksbund» gegen «Herrenbund»)
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 159 - arpa Themen Projekte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 159 - arpa Themen Projekte
VIII.
Wiege und Stachel des Berner Bauernzorns
Das obere Emmental, dort wo es sich von Langnau aus in zwei
Armen gegen das Entlebuch hinstreckt, ist die Wiege des Berner Aufstandes.
Der kürzere dieser beiden Arme führt am Ilfis, an dem aus
dem Luzernischen kommenden Hauptzufluss der Berner Emme, aufwärts
über Wiggen in bequemern und darum auch leicht zu überwachendem
Uebergang direkt nach Escholzmatt und weiter nach Schüpfheim.
Der längere Arm ins Entlebuch wird durch das obere Tal der
Grossen oder Berner Emme gebildet, von dem zwei nicht ganz so leicht
zu überwachende Pässe ins Entlebuchische abzweigen. Zwar das Tal
der Berner Emme selbst führt zwischen den beiden mächtigen Felsmassiven
des Hohgant und der Schrattenfluh durch ein hochalpines
Bergtor direkt auf den Rücken der Brienzer Rothornkette und von
dort geht's hinab ins Herz des Berner Oberlandes. Aber schon in
Schangnau zweigt ein guter Passübergang ab ins obere, entlebuchische
Ilfistal nach dem nahen Marbach, und da wohnte der Entlebucher
Landeshauptmann Niklaus Glanzmann, der viel Verwandtschaft im
Emmental hatte und an der Verschwörung des Thomasabends führend
dabei war; von da geht's über Wiggen direkt nach Escholzmatt, wo
der Landessiegler Binder hauste, der am Thomasabend ebenfalls führend
und auch beim Bittgang mit Hans Emmenegger nach Luzern dabei
war; auch Christen Schybi wirtete und wirkte ja in Wissemmen
bei Escholzmatt. Weiter oben im Tal der Berner Emme, genau im Tor
zwischen Hohgant und Schrattenfluh, zweigt auf dem Kemmeriboden
ein höherer Passübergang durch hochalpine Wildnis ab ins Quelltal
der Kleinen oder Luzerner Emme, und dieses führt direkt ins Herz des
Entlebuch, nach Schüpfheim, wo der Landespannermeister Hans Emmenegger
und der Schulmeister Johann Jakob Müller, der «Ratsschreiber»
des Wolhuserbundes, daheim waren und wo auch ihre heisspornigen
Paladins, Käspi der Tell, Hans Krummenacher, der «stärkste
Eidgenoss», sowie Stephan Lötscher hausten. Besonders diese letzteren
drei waren zwischen dem Entlebuch und dem Emmental fast ständig
unterwegs; für sie war es über den Kemmeriboden, wie über Marbach
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 160 - arpa Themen Projekte
Niklaus Leuenberger
Unveröffentlichter, handkolorierter Originalstich in der Berner
Stadtbibliothek.
Zeitgenössische Konstruktion nach dem Gefangenenbild der Berner
Herren, bezw. wohl direkt nach dem Grand-Witz'schen Gemälde
auf die Platte graviert (hier spiegelverkehrt, weil Plattenabzug).
Im Hintergrund: links ein Dorf, davor der Balgen, sowie exerzierende
Truppen rechts ein Zeltlager und Truppen.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 161 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 162 - arpa Themen Projekte
dem kleinen Nest Colombier allein in zwei Jahren ihrer dreizehn! 1632
wurde in Genf ein Pfarrer, Niklaus Antoine von Divonne, «ein sanfter,
schwermütiger Mann, wegen erwiesener absonderlicher Beschäftigung
mit der Philosophie (!) und fluchwürdigen Ansichten über die Gottheit
Christi auf Befehl der Herren und Obern von Genf... als warnendes
Beispiel verbrannt». «Ueberall reichten sich Geistlichkeit» (immer ist
hier die protestantische gemeint) «und Obere die Hand, um der Forschgier
der Geister Schranken zu setzen, wenn sie etwa ihre Fesseln abschütteln
wollten.» In Bern stand schon seit 1621 ewige Verbannung
auf der blossen Verbreitung der Lehren Descartes', des berühmtesten
Philosophen der Zeit! Sonst «wachte Zürich mehr über die Lehre,
Bern mehr über die Sitte». Bern erliess «eine Verordnung nach der andern»,
eine heuchlerischer als die andere, jede unter Androhung horrender
Leibes- und Vermögensstrafen, «wider die Trunkenheit, Müssiggang,
Aufwand und die Teufelskünste», aber nur «beim kleinen Volke»
—denn Saufen, Schwelgen und Prassen, aber auch das Spiel mit abergläubischen
(z. B. astrologischen) Zaubereien, das alles war das Privileg
der Herren. «Die Hexenprozesse», sagt der alte Domdekan Vock,
«dauerten fort, und noch immer mussten viele Schlachtopfer dieses
Wahns den Scheiterhaufen besteigen oder unter dem Schwerte fallen.»
In Zürich z. B. sind noch im Jahr 1701 acht Personen wegen angeblicher
Hexerei verbrannt worden. Zu den allerschlimmsten Henkersantreibern
während des Bauernkriegs gehörte die Geistlichkeit Basels
unter der Führung des «beliebten» Antistes Theodor Zwinger, die in einer
von Bibelsprüchen triefenden Hetzschrift an den Rat die Köpfe der
Bauernführer verlangte —und erhielt! (Denn es war ja natürlich bestellte
Arbeit!)
Unter diesen Umständen wurde die protestantische Kirche zu einem
noch fügsameren und gefährlicheren Instrument der absoluten Landesherren
als die katholische; sie diente zur Unterdrückung jeder Freiheit
des Volkes, nicht nur derjenigen in Kultur und Wissenschaft, sondern
auch und besonders der politischen. Denn jeder absolute Landesherr
in protestantischen Ländern verfügte auch absolut über die protestantische
Kirche auf seinem Territorium. Da gab es keine übergeordnete,
universale Instanz, die regulierend hätte eingreifen und an die
sich irgend jemand, ob Hirt oder Herde, hätte wenden können. Und
darum ist ganz besonders von protestantischen Juristen die Lehre
vom Gottesgnadentum der Obrigkeit, in engstem Anschluss an Luthers
reaktionäre Wendung zum Landesfürstentum, ausgebildet worden,
nach dem Grundsatz: cuius regio, eins religio —, zu deutsch: wer regiert,
der befiehlt auch, was ich zu glauben habe.
Mit dieser Erkenntnis haben wir das grundlegende Verständnis für
die Rolle gewonnen, die gerade die protestantischen Geistlichen im Dienste
der «von Gott eingesetzten gnädigen Herrn und Obern» im Bauernkrieg
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 163 - arpa Themen Projekte
waren die wirklichen «Hunde des Herrn»: die fanatischsten und schamlosesten
Spitzel und Spione, die rechtsverdreherischsten Volksfeinde, ja
hetzerischsten Henkersantreiber ihrer «gnädigen Obern»! Dafür werden
wir im Lauf des bernischen und baslerischen Bauernkriegs wahrhaft
erschreckenden Beweisen menschenfressenden «Christentums» begegnen,
wesensgleich denen der Zürcher Prädikanten schon im Wädenswiler
Aufstand. Ein bemerkenswerter Unterschied zu dem bedeutend
volksverbundeneren Verhalten von immerhin beträchtlichen Teilen
der Luzerner Geistlichkeit, über die die Luzerner Obern eben nicht
allein Herrn und Meister waren. Es ist, als hätte sich diese wirklich
gewisser urchristlicher Weisheiten erinnert. Zur Rechtfertigung ihrer
Parteinahme für die Bauern soll sie z. B., wie Vulliemin anführt, den
Kirchenvater Tertullian zitiert haben, der gesagt hat: «Wie die einer
Auflage unterworfenen Felder weniger Wert haben, so verlieren auch
die Menschen an ihrem Wert, an deren Köpfen die Pflicht einer Abgabe
haftet. . haftet...»
Doch kehren wir zu unsern Berner Bauern zurück.
Es war also nach dem neuen Kalender in der ersten Januarwoche
1653, als die ersten Berner Bauernführer in Uli Gallis Haus in Eggiwil
verschwörerisch zusammentraten. Das ändert natürlich nichts daran,
dass für die Männer, die hier heimlich zusammenkamen, diese Tage
«zwischen Weihnachten und Neujahr» lagen und also ganz die gleichen
Tage stillen, frommen Festabglanzes waren wie der Thomastag
für die Entlebucher zehn Tage früher. Nur war die Frömmigkeit der
Emmentaler keine katholische, sondern eine protestantische, vielmehr
sogar eine stark sektiererisch-wiedertäuferische. Denn vor dem Druck
der verhassten «Hunde des Herrn», der Prädikanten —als welche nur
Berner Stadtbürger eingesetzt werden durften —, wichen viele Bauern
mit ihrem Frömmigkeitsbedürfnis heimlich in mancherlei Sekten
aus, gerade weil diese für rebellisch galten und von den Kirchenobern
mit dem Schwert des Staates und mit den Scheiterhaufen der Hexenprozesse
verfolgt wurden.
Umso erstaunlicher ist es, wie leicht die katholischen Entlebucher
sich mit den grossteils wiedertäuferisch gesinnten Emmentalern zusammenfanden!
Denn für die katholische Kirche war jede leiseste Berührung
mit der Täuferei nicht nur Pest und Aussatz, die man mit Feuer
und Schwert ausrotten musste, sondern Todsünde, von der es keine
Erlösung mehr gab. Nichts könnte darum besser beweisen, dass nicht
die allzu oft nur menschenmörderischen Chimären der Religionen,
sondern die realen Dinge des menschlichen Lebens es sind, die Menschen
und Völker untereinander zu Brüdern machen. Und das heisst
in allererster Linie: die Klassenzugehörigkeit.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 164 - arpa Themen Projekte
Und «Brüder» nannten sich in der Tat die Bauern, die um die
Jahreswende Zweiundfünfzig auf Dreiundfünfzig in Uli Gallis Haus
zusammenkamen. Unter demselben «greulichen Kometen mit dem gestutzten
Bart», von dem Hans Emmenegger in seiner ersten Rede
beim Heiligen Kreuz ob Hasle vielbedeutend gesagt hat, dass er «eine
Flamme habe wie ein Schwert», dass er «in drei Stunden durchs Entlebuch
ins Trubertal hinüber wandere» und dass er auch «von den
Bernern sehr wohl gesehen worden sei». Und wie Schüpfheim bei der
ersten Verschwörer-Versammlung in Käspi Unternährers Haus, so lag
auch Eggiwil unter einer tiefen Schneedecke, als die tapferen Männer
von allen Seiten und aus allen Schächen, wer weiss wie weit her, im
Schutze der Dunkelheit in die Dorfstrasse von Eggiwil einbogen, um
in Uli Gallis Haus zu verschwinden.
Ihre Namen sind uns nur in einigen Fällen, durch den Zufall späterer
Verhöre, überliefert. Dass Entlebucher dabei waren, können wir
Hundert gegen Eins wetten. Durch die Verhöre sind uns aber, da sie
nur Bern betreffen, lediglich einige Berner, vor allein Emmentaler,
als Teilnehmer dieser in grösster Heimlichkeit veranstalteten «illegalen»
Versammlung bekannt. So der vertraute Hauptbote Uli Gallis,
Hans Blaser aus dem «Heidbühl» im Gerichtsbezirk Trub. Er war, im
Gegensatz zu dem hablichen Uli, ein armer Kleinbauer, der eine Frau,
zwei eigene Kinder und ein Stiefkind durchzubringen hatte; bei der
Konfiskation seines Hab und Gutes zeigte sich später, dass «nach
Abzug des Frauenguts und der Schulden nichts mehr vorhanden war».
Ihn hatte Uli Galli im ganzen Land herumgeschickt, um zu dieser
Versammlung aufzubieten. Natürlich kamen dafür nur wirklich Vertraute
in Frage. Vor allem solche, die Uli Galli bereits aus dem früheren
Aufstand, dem sogenannten «Thuner Handel» von 1641, in dem er
selber führend war, kannte und die sich auch seither gut bewährt
hatten.
Ein solcher war vor allem Daniel Küpfer, der Ammann von Pfaffenbach
in der Kirchhöri Langnau, ein zäher und tapferer Kämpfer.
Der war ehemals ein sehr hablicher und weit herum angesehener
Schmied in Höchstetten und im Thuner Handel ein populärer Führer
des ganzen Konolfinger Amtes. «Ausser der Schmiede, die er nur
lebensweise innehatte, besass er verschiedene Stücke Erdreich auf der
Erlen, im Mühlebach, ein Stück Reben zu Oberhofen bei Bowil und
Bergrechtsame für 2 Kühe am Rämisgummen. In den Jahren 1622 bis
1643 liess Daniel Küpfer in Höchstetten 11 Kinder taufen.» 1646 übergab
er die Schmiede seinem Sohn Daniel und zog nach Pfaffenbach,
wo er «ein Gütlein» erwarb. Er war später Hauptmann in der vor Bern
gerückten Bauernarmee Leuenbergers und gehörte, als der organisatorisch
begabteste, gescheiteste und energischste Kopf neben Uli Galli,
dem engeren Kriegsrat an. Er war darum auch einer der ersten, der von
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 165 - arpa Themen Projekte
derjenige Leuenbergers, gevierteilt, «ein Teil auf dem Hochgericht (in
Bern), die übrigen drei Viertel in Signau, Ranflüh und Huttwil aufgehängt».
Sicher also ein wichtiger Mann! Ein fast ebenso wichtiger alter
Kämpfer und bewährter Teilnehmer am Thuner Handel war Hans
Rüeggsegger, der Weibel von Röthenbach bei Diessbach. Auch er war
später Kriegsrat Leuenbergers und mit der Bauernarmee vor Bern gezogen,
und auch er wurde dafür in Bern enthauptet «und sein Haupt
an das Hochgericht genagelt». Wir werden kaum fehlgehen. wenn wir
ausser diesen beiden alten Vertrauten Ulis aus dem Thuner Handel,
beides habliche Bauern wie er selber, noch manche andere solche alten
Mitkämpfer als Teilnehmer an der ersten Verschwörung in Eggiwil
annehmen.
Dann aber waren auch viele neue Kämpfer dabei. So als einer
der «rässesten» Hans Bürki aus dem «Winkel» bei Langnau, ein jung
verheirateter Bauer mit zwei Kindern, der mit dem Vater zusammen
ein schönes Bauerngut schuldenfrei bewirtschaftete. «Feuer und
Flamme für die Sache der Bauern, bedrohte er die, welche diese nicht
bei ihren Rechten und Freiheiten lassen wollten, mit dem Tode.» Auch
er gehörte, trotz seiner Jugend, dem engeren Kriegsrat an. Er war es
auch, der den Schultheiss Dachselhofer im Feldlager vor Bern mit «rouwen
ungebürlichen » Worten bei seinem früheren Versprechen behaftete:
«Berner Batzen werdind Berner Batzen verblyben»! Und wenn er
auch dafür nicht geköpft wurde, so wurde doch an ihm eine für die
damalige Berner Geistlichkeit besonders bezeichnende Schandtat verübt.
Als man nach der Niederschlagung des Aufruhrs im ganzen Land
auf die zahllosen flüchtigen Bauernführer eine wilde Hatz veranstaltete,
spannte man natürlich auch die Geistlichkeit dafür ein, wofür
diese extra bezahlt wurde! So auch im Fall Hans Bürki. «Er
wurde» — wie der neueste Erforscher der Rechtsfolgen des Bauernkriegs,
Rösli, nachweist — «durch den Prädikanten Anthoni Kraft
(damals Pfarrer in Langnau) am 17. Oktober 1653 ins Schloss Trachselwald
gelockt, unter dem Vorgehen, der Vogt werde ihn auf sein eidliches
Versprechen der Treue und des Gehorsams wieder frei lassen.»
Hans Bürki aber wurde ganz im Gegenteil sofort in Ketten gelegt und
ins Gefängnis nach Bern geschafft! Dafür steckte später der «Bote des
Herren» Anthoni Kraft schöne Silberlinge ein. Denn Rösli gibt folgenden
Originalauszug darüber aus der «Rechnung des Landvogts Samuel
Tribolet über die Jahre 1653-1654» wieder: «Herrn Anthoni Kraft, jetz
Prädicanten zu Lützelflüe, umb dass er Hans Bürki den Ertz Rebellen
wie ihn Ihr Gn. in underschidlichen missiven titulierend zur Verhaftung
ins Schloss mit guten Worten gelocket, vermog oberkeitlicher
provision vom November 1659» (die Rechnung wurde erst anno 1660
abgelegt) «40 Kr., thund an Pf., 133 Pfund, 6 Schilling, 8 Pfennige»!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 166 - arpa Themen Projekte
Sonst sind uns durch den Zufall der Verhöre nur ein paar unwichtigere
Männer als solche überliefert, die an Uli Gallis Verschwörung
in Eggiwil teilnahmen: so ein Peter Baumgartner aus dem «Hälig»
bei Trub; ein Hans Kreyenbühl aus der «Schmitten» in Trub, den die
Trüber Gemeinde später zu ihrem Hauptmann im Kriege wählte; ein
Michel Langenegger aus der «Ey» im Amt Trachselwald; sowie
schliesslich ein Peter Tanner aus dem «Bach» bei Trub, der später als
Ausgeschossener seiner Gemeinde an die grosse Landsgemeinde in
Sumiswald geschickt wurde.
Es muss uns auffallen, dass wir, ganz im Gegensatz zu den ersten
Verschwörern im Entlebuch, bei denen im Emmental nicht einen einzigen
Mann namhaft machen können, der im «öffentlichen Leben»
des Berner Volkes irgendeine in die Augen springende Rolle spielte,
Uli Galli mit eingeschlossen. Denn auch bei diesem können wir seine
Wichtigkeit nur aus seiner früheren Rolle als Rebell im Thuner Handel,
aus seinen Taten im grossen jetzigen Bauernkrieg, besonders eben
als Urheber der Bewegung im Emmental, sowie aus der nachmaligen
Bestrafung erschliessen. Denn auch er wurde natürlich durch die Berner
Herren vom Leben zum Tode befördert, diesmal zur Abwechslung
durch den Strang, was als besonders schimpflich galt. Denn er war
landesbekannt als «einer der extremsten Revolutionäre», schon seit
dem Thuner Handel, und seine Rolle in diesem wurde ihm im Todesurteil
ausdrücklich als Belastungsmoment angekreidet. Auch er war
Hauptmann im Bauernheer vor Bern und gehörte dem engeren
Kriegsrat Leuenbergers an. Eine besondere moralische Belastung für
ihn war, dass er bis zu seinem zehnten Jahr (!) mit einer alten Frau
zu «der töüfferischen Sekt gangen» sei; «syn Eheweib aber sye annoch
mit diser Sekt behaftet»!
Der Unterschied zwischen der Rolle der ersten Entlebucher und
derjenigen der ersten Emmentaler Verschwörer im Leben ihres Volkes
hat wichtige geschichtliche Gründe, die wir kennen müssen, wenn wir
den langen und schweren Aufmarsch der Berner Bauern, aber auch
seine schliessliche Wucht, verstehen wollen. Auch die Rolle Uli Gallis
als Führer in der ersten Bauernerhebung, im «Thuner Handel» von
1641, muss uns vertraut sein, wenn wir seine Urheberrolle in der
Berner Bewegung des grossen Bauernkriegs begreifen wollen. Denn
ausdrücklich wird von der «revolutionären Versammlung» in seinem
Haus berichtet — es ist das Einzige, was wir über deren Inhalt wissen
—: «An dieser stellte er den Antrag, von der Obrigkeit die Bestätigung
des ,Thunerbriefes' zu verlangen.»
Im Bernischen gab es längst keinen volksgewählten Landesvorstand
und keine behördlich Ausgeschossenen mehr wie noch im
Entlebuch; keinen Landespannermeister, Landeshauptmann oder Landessiegler
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 167 - arpa Themen Projekte
wenn auch wesentlich nur noch dekorative — Ueberrest einer Volksfreiheit,
die daher stammte, dass die Stadt Luzern vor zweieinhalb
Jahrhunderten nur die Schirmrechte über das Land Entlebuch gekauft
hatte. Dessen erinnerten sich die Entlebucher, wie wir sahen,
gerade jetzt wieder, als es den Luzerner Herren erst darum ging. in
Nachahmung anderer aristokratischer Staaten die totalitäre landesherrliche
Macht an sich zu reissen und darum auch den letzten Rest
der Volksfreiheiten abzuwürgen.
Im Staate Bern dagegen war man damit schon viel weiter. Schon
«seit der Erwerbung der landgräflichen Rechte» —und das war schon
seit mehr als dreihundert Jahren — «befand sich die Stadt Bern gegenüber
ihren Angehörigen auf dem Land in der Stellung eines Landesfürsten»,
dem man einen «Huldigungseid» zu schwören hatte (was
allerdings die Luzerner Herren längst nachzuäffen gelernt halten, was
jedoch in Bern rechtsgeschichtlich eine ganz andere Bedeutung hatte).
So schreibt Hans Bögli, ein neuerer Berner Geschichtsschreiber des
Bauernskriegs. Zwar waren auch im Bernischen in einzelnen Landschaften
«regionale Statutarrechte» aus der volksfreien Frühzeit erhalten
geblieben, deren Anerkennung durch die Stadt Bern sich diese
Landschaften von Zeit zu Zeit immer wieder ertrotzten. Ausser einigen
Städten, wie Thun, Laupen, Murten, Aarau, Lenzburg und anderen,
besassen besonders die Landschaften Oberhasli und Saanen noch so
weitgehende Freiheiten, dass sie von den Entlebuchern sogar darum
benieden wurden. Ferner war noch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts
eine Art direkter Demokratie, das System der sogenannten
«Volksanfragen», am Leben geblieben: über Grundfragen des Staatslebens,
wie neue Steuern, Bündnisse und Krieg, musste das Volk befragt
werden. Dieses System blühte besonders während und nach dem
Burgunderkrieg; aber es musste schon 1513, während der Mailänder
Feldzüge, von den Bernern durch einen Aufstand wieder ertrotzt werden.
So konnte denn auch das geschichtliche Ereignis der Reformation
im Kanton Bern durch Volksanfrage eingeführt werden.
Die Kehrseite davon aber ist, dass auch so un-, ja antidemokratische
Dinge wie die Eroberung und Unterwerfung des Waadtlandes im
Jahre 1536 durch das urdemokratische Recht der Volksanfrage ausdrücklich
genehmigt wurde! Damit hat dieses sich allerdings das
Grab selber gegraben. Denn erst durch die Folgen dieser schmählichen
Eroberungstat, durch den ungeheuren neuen Bodenbesitz, den die
stadtbernischen Herren geschlechter dabei an sich rissen, sowie durch
die ungeheuerliche private Aussaugung des reichen Landes seitens weniger
Familien, wurden diese zu der übermächtigen Feudalmacht, gegen
die auf die Dauer keine Volkserhebung mehr durchdrang. Noch 1565
hatte das Volk das Bündnis mit Frankreich verworfen, das den Herren
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 168 - arpa Themen Projekte
Beziehungen zwischen Bern und Savoyen wenigstens dem Scheine
nach noch mitsprechen. Schon zu Beginn des dreissigjährigen Kriegs
dagegen erlosch auch der letzte Schimmer des Anfragerechts des Bernervolkes.
Denn seit man in Frankreich die «Reichsstände» — so etwas wie
ein Parlament, wenn auch ein überaus exklusiv aristokratisches —
nicht mehr einberief, seit 1614, war das höchste Bestreben der Berner
Herren, den «selbstherrlichen Geist des französischen Königtums» bis
ins letzte Titelchen nachzuahmen. Der Stadtstaat Bern wurde zum
allesüberragenden Pionier des Absolutismus in der Schweiz. Das einzige
Organ, das fortan das Volk mit der Regierung «verband», war
der Landvogt, sein Blutsauger. War die «von Gott eingesetzte» Obrigkeit
der einzige Landes-, Gerichts- und Grundherr, so war der Landvogt
seine Rute für das Landvolk, die oberste richterliche und Polizeibehörde
in den Bezirken; aber auch sein Eintreiber für die Steuern,
sein Einnehmer und Verpächter der «öffentlichen» Einkünfte aus
dem Lande.
Die Haupteinkünfte der Berner Obrigkeit waren zahlreiche
Lehensherrlichkeiten — Reste der Leibeigenschaft —, wie Bodenzinse,
Ehrschätze (Abgaben bei Handänderungen), Abzugs- und Zuzugsgelder
etc.; ferner Zehnten von Getreide und Wein und, ganz wie in Luzern,
das Ohmgeld und das Salz- und Pulvermonopol. Nirgends aber
ist die private Bereicherung der Landvögte kraft ihrer «öffentlichen»
Funktion ein derart offizielles Privileg gewesen wie in Bern. Gerichts-
und Schreibgebühren aller Art, Konfiskationen und Bussen gehörten
zum grössten Teil zum persönlichen Einkommen der Landvögte. Klar,
dass jeder Landvogt ausschliesslich aus einer der allein «regierungsfähigen»
Familien stammen musste. Auf sechs Jahre wurde er von
den Herren «gewählt», und das hiess jedesmal: deine Chance, reich
oder noch reicher zu werden ist gekommen — da, greif zu! Enrichissez-vous,
Messieurs! Und daher entspann sich ein wilder Schacher
um diese Amtsbesetzungen: sie wurden von vornherein um hohe
Summen gekauft, und diese «Kosten» mussten erst einmal aus den
Bauern wieder herausgeschunden werden, ganz abgesehen davon, dass
dann erst das Reicherwerden beginnen konnte. «Es ist begreiflich»,
sagt unser neuerer Berner Geschichtschreiber des Bauernkriegs, «dass
sie bei ihren grossen Befugnissen häufig die Amtsgewalt missbrauchten
und Anlass zu bitteren Klagen gaben»! Mehr als begreiflich —geradezu
naturnotwendig, wenn nicht sogar sittlich gerechtfertigt! Denn
ihre obersten Oberen, die Berner Ratsherren des Kleinen Rats, der
eigentlichen Regierung, waren fast alle in ihrer Karriere auch einmal
Landvögte gewesen — wenn sie nicht von vornherein, etwa wie
manche Erlache, Diesbache, Bonstetten, Wattenwile etc., noch höher
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 169 - arpa Themen Projekte
als Regierung mit gutem Beispiel voran: wenn sie mit den «ordentlichen»
—d. h. einfach mit den bisher verordneten — Einkünften nicht
auskamen, dann wurden ohne weiteres neue Steuern und Monopole
ausgeschrieben! Natürlich ohne Volksanfrage. Es gab ja bis ins nachfolgende
Jahrhundert (1711) überhaupt keine Verwaltungsgerichtsbarkeit,
und darum auch nicht das geringste Beschwerderecht. Sich
beschweren hiess ohne weiteres sich strafbar machen. Wer wollte das
riskieren?
Trotz alledem war das Rechtsbewusstsein des Bernervolkes von
altersher ein ganz besonderes, ja ausserordentlich lebendiges. Es kam
dem der Entlebucher mindestens gleich. Jeder Erlass, jede Verordnung
wurde dort wie hier an diesem althergebrachten Rechtsgefühl
unverzüglich gemessen. «Neuerungen», die in diesen Zeitläuften des
immer unheimlicher wachsenden Absolutismus für die Bauernklasse
in der Tat nur immer weitere Einschränkungen der Volksfreiheiten,
Ja der nackten Existenzmöglichkeiten, bringen konnten, waren den
Berner Bauern ebenso verhasst wie den Luzerner Bauern.
Und so bedurfte es bereits im Jahre 1641 nur der Ankündigung
einer neuen Steuererhebung. «um den Ausbruch einer allgemeinen
Protestation zu veranlassen, die als Vorläufer der zwölf Jahre nachher
ausbrechenden grossen Volkserhebung angesehen werden muss».
Es war ein Kontributionsmandat des Berner Rates an alle Landvögte
zur Erhebung einer Vermögens- (also Kopf-) Steuer zum Zweck des
Unterhalts einer zum erstenmal geplanten stehenden Truppe! Mithin:
eine richtige Sklavensteuer. Diese Steuer sollte fortan jedes Jahr bis
zum 1. Mai vom Volke erlegt werden, und dabei «wies man die
Prädikanten (Pfarrer) an, jeweilen öffentlich auf den Kanzeln die
Zeit des Bezugs zu verkündigen mit einer Mahnung zur Pflicht». Das
ist ein weiteres bescheidenes Beispiel dafür. wofür den Berner Herren
die Religion und ihre Verkünder gut genug waren.
Der Widerstand der Berner Bauern war turbulent und allgemein.
Er zeigte der ganzen Schweiz. dass die Berner nicht nur in der Reaktion,
sondern auch in der Revolution vorangehen können. Denn das
war wirklich der erste Volksaufstand gegen den Absolutismus französischen
Musters in der Schweiz, fünf Jahre vor dem Wädenswiler Aufstand.
Das haben besonders die Entlebucher den Bernern nie vergessen.
Sie hatten ihnen schon damals sofort Hilfe und bewaffneten
Zuzug zugesagt.
In der Tat war der Aufstand der Berner schon damals eine
grosse Sache. Ihr Widerstand ging in erster Linie gegen die stehenden
Truppen selbst; denn das fühlte ein jeder, dass diese Söldner ein Attribut
des Absolutismus, eine Bürgerkriegstruppe zur Niederhaltung des
eigenen Volkes war, das sie dazu noch selbst bezahlen sollte. Sodann
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 170 - arpa Themen Projekte
Volksbefragung eingeführt wurde und reklamierte die Wiederherstellung
dieses uralten Rechtes. Die übrigen Grunde richteten sich gegen
die Unbefristetheit der Steuer, sowie gegen die Art ihrer Erhebung,
indem dabei Selbsteinschätzung des Steuerbetrags und also des Vermögens
vorgeschrieben war; dies nämlich empfanden die Bauern als
kreditvernichtend für viele der Ihrigen, die eigentlich nichts mehr
zu versteuern hatten, oder aber, wenn sie ihren Kredit retten wollten.
sich zu hoch einschätzen mussten.
Aber auch damals waren es nicht nur die Bauern, sondern auch
die kleineren Städte, die rebellierten. Aarau und Zofingen waren die
ersten, die Widerstand leisteten; ihnen folgten Lausanne und Romainmotier;
nur Vevey nahm die Steuer an. Als zwei Lenzburger, in Fesseln
gelegt, nach Bern in Gefangenschaft abgeführt wurden, drohten
Stadt und Land Lenzburg, sie mit Gewalt zu befreien; sie mussten
entlassen werden. In Thun wurde heftig rebelliert, als dort Niklaus
Zimmermann, der Bruder des ebenfalls rebellischen Weibels von
Steffisburg, in die Verliesse des Schlosses geworfen wurde. «Zehn mit
schwerem Geld gedungener Männer» bedurfte der Schultheiss Bachmann
von Thun, und dazu noch eines Ueberfalls bei nachtschlafender
Zeit, um den Berner Herren diesen Gefallen zu erweisen. Aber
nicht die Thuner Bürger, sondern die Oberländer und Emmentaler
Bauern waren es, die zu vielen hundert Mann sich bewaffnet vors
Schloss legten und nicht wichen, bis in einem allgemeinen Trubel
Zimmermann sich befreien und über die Schlossmauern entweichen
konnte.
Am heftigsten rebellierten auch diesmal die Emmentaler und die
Oberaargauer Bauern. Nur die Prädikanten zahlten hier die Steuer.
Es fand auch damals schon eine grosse Volksversammlung in Langnau
statt, auf der beschlossen wurde, bei der Verweigerung der Bezahlung
der Steuer auszuharren. Eine ganze Reihe von Sumiswaldern wurde
wegen Widersetzlichkeit gegen den damaligen Landvogt von Trachselwald
Samuel Frisching —demselben, dem wir im jetzigen, grossen
Bauernkrieg bereits als Ratsherr und Spitzel der Berner Regierung begegnet
sind — nach Bern in Gefangenschaft abgeführt. Diese «hitzköpfigen
Sumiswalder» hatten dem Landvogt «mit Steinwürfen etliche
Fensterscheiben zertrümmert». Aber auch sie mussten unter dem
Druck des Aufmarschs der Emmentaler Bauern vor Thun bald entlassen
werden, wenn sie später auch gebüsst wurden.
Was uns nun an der damaligen Rebellion der Emmentaler ganz
besonders interessiert, das ist die bestimmte Nachricht, dass unser Uli
Galli von Eggiwil schon damals ein Hauptführer der Bauern war, der'
an der Spitze der Bewaffneten aus den Gemeinden Steffisburg, Diessbach,
Röthenbach, Kiesen, Höchststetten, Langnau, Signau, Eggiwil,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 171 - arpa Themen Projekte
Schloss gedroht, «wenn binnen zwei Stunden der Gefangene nicht frei
gegeben werde, die Stadt zu versengen und das Kind im Mutterleibe
nicht zu verschonen», angeblich! Aber unser neuerer Berner Geschichtsschreiber
des Bauernkriegs, Hans Bögli, gibt treuherzig zu,
dass diese «wütenden Drohungen» vor Thun «ebenso sehr von Innigkeit
des verletzten Rechtsgefühls, als von augenblicklichem Mangel an Selbstbeherrschung»
zeugen. Jedenfalls aber bekamen die Bauern auf diese
Weise den gewalttätig gefangen gesetzten Niklaus Zimmermann frei.
Inzwischen hatten die Berner Herren eiligst einige Truppen zusammengezogen
und die «Zusätzler» (zusätzliche Besatzungsmannschaften)
auf die Schlösser Thun, Wimmis, Burgdorf etc. befohlen.
Im Simmental und im Frutigtal allerdings meuterten die Zusätzler;
aber auch die Städte Brugg, Aarau und Zofingen weigerten sich, ihre
Zusätzler ins Schloss Zofingen zu liefern. Zu schweigen von den Emmentalern,
die keinen Mann nach Burgdorf oder Trachselwald lieferten,
denen es vielmehr sogar gelang, die ordentlichen Besatzungen
dieser Schlösser zum Meutern zu bringen, besonders nachdem in
Burgdorf ein Mann erschossen worden war. Bern hatte aber ausserdem
die verbündeten evangelischen Orte Zürich, Schaffhausen, Biel,
Neuenstadt, Neuenburg, Genf und einen Teil des Wallis zum Truppen-Zuzug
aufgeboten.
Ebenso kamen schleunigst auch damals eidgenössische «Vermittler»
herbeigeeilt, um den Berner Herren zu helfen, ihre Untertanen
wieder zum Gehorsam zurückzuführen. Und das gelang ihnen unter
dem Druck des grossen Truppenaufgebotes schliesslich doch. Immerhin
musste Bern auf die Einführung der neuen Steuer und damit der
stehenden Truppen wohl oder übel verzichten und den Bauern im
«Vermittlerbrief» eine Reihe von Zusagen machen! Denn bereits drohten
auch damals schon die Emmentaler und Oberaargauer, sich mit
den Entlebucher und Solothurner Bauern zu verbünden. Das also war
der erste geschichtliche Keim des späteren grossen Bauernbundes! Und
schon kauften die Emmentaler und Oberaargauer im Solothurnischen
grössere Mengen Pulver ein...
Vor der Ausdehnung des Aufruhrs auf allgemeinschweizerischen
Boden aber hatten die übrigen eidgenössischen Stände damals noch
einen solchen Schrecken, dass sie auf das wütende Bern drückten, bis
es die Steuer fallen liess. Auf die Frage der Bauern, in den Verhandlungen
in Thun, «ob sie denn nicht mehr freie Eidgenossen seien und
ob sie sich wie Unterthanen von Königen müssen behandeln lassen» —
hatten nicht nur die Berner Ratsherren, sondern natürlich auch ihre
Klassengenossen, die Herren «Ehrengesandten», keine bessere Antwort
als den sehr kräftigen Hinweis auf «die landesherrlichen Recht«
der Stadt»!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 172 - arpa Themen Projekte
Darum mussten denn auch 150 ausgeschossene Bauern, meistens
Emmentaler, nach vollzogener Verhandlung in Thun in der dortigen
Kirche vor den Berner Herren und den eidgenössischen Vermittlern
kniefällig Abbitte leisten! Das taten sie, wie man sich leicht denken
kann, nur zähneknirschend. Zehn von ihnen, die Hauptführer, mussten
sogar nach Bern und dort am Pfingstsonntag 1641 den Fussfall
vor Rät' und Bürgern wiederholen. «Den Aufständischen wurden —
darauf hin —die Kosten und Strafen erlassen, gegen einen neuen Huldigungseid.»
Der Führer und Sprecher der zum Fussfall in Bern gezwungenen
zehn Bauern führer aber war — unser Uli Galli! Welchen Racheschwur
er damals insgeheim, wie auch zahllose andere Bauern,
leistete, können wir uns leicht denken. Dagegen «die Ehrengesandten
der evangelischen Stände wurden von der Stadt belohnt, jeder mit
10 Dublonen, der Schreiber mit sechs Dublonen und jeder der elf Reiter
mit einer Dublone! Unter diesen «Ehrengesandten» waren schon
dazumal Salomon Hirzel, damals Bürgermeister von Zürich, und Johann
Rudolf Wettstein, damals Oberstzunftmeister von Basel. Sie
werden uns auch im jetzigen grossen Bauernkrieg bedeutsam begegnen.
«So war die gefährliche Entzweiung der Obrigkeit mit ihrem
Volke für einstweilen beigelegt.» «Die Beschwerden des Volkes waren
aber trotz der gütlichen Beilegung des Zwistes nicht gehoben; sie blieben
und vermehrten sich noch bedeutend infolge der ungünstigen
Zeitverhältnisse.» Wir wollen dem bernischen Geschichtschreiber des
Bauernkriegs, der dies sagt, Hans Bögli, auch weiter folgen in seinem
ausnahmsweise anständigen Versuch, der Sache der Bauern gerecht
zu werden; dazu nämlich befähigte ihn seine bäuerliche Abkunft,
trotz seiner hochbürgerlichen Bildung. Er führt weiter aus: «Im Verlaufe
derselben zeigt sich, ganz dem Zeitalter des erstarkenden Despotismus
gemäss, mehr als früher bei ähnlichen Anlässen das Bestreben
der Regierung, nötigenfalls den Willen der Untertanen mit Gewalt,
mit fremden Truppen zu unterdrücken; Das liess für lange Zeit
einen Stachel in den Herzen der Landleute zurück.» Dieser Geschichtschreiber
versucht allerdings irrtümlicherweise auch, eine demokratischere
Auslegung des Stanser Verkommnisses zu retten, auf Grund dessen
die Herren sich gegenseitig Truppenhilfe leisteten, indem er
schreibt: «Es wäre eine verkehrte Auffassung, zu glauben, jenes Vorkommnis
habe den Ständen die Verpflichtung zu gegenseitiger
Hilfe gegen Aufhebungen auferlegt, ohne einen Unterschied zwischen
Recht und Unrecht zu machen.» Zwölf Jahre nach dem
Thuner Handel war aber gerade dies die Auffassung der Tagsatzung,
wie wir an deren Mandat vom 22. März 1653 bereits erkannt haben.
Was das Verhalten des Volkes im Thuner Handel betrifft, stellt
sich Bögli in sympathischer Weise in Gegensatz zu einem älteren, Anton
von Tillier, der vor hundert Jahren eine «Geschichte des eidgenössischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 173 - arpa Themen Projekte
zusehen, wer uns unsere Geschichte schreibt. Tillier war der Angehörige
eines der «regierungsfähigen» Berner Geschlechter, vielmehr einer
jener welschen Kapitulantenfamilien, die ihre Karriere in der Hochburg
der Unterdrückung ihres eigenen welschen Volkes machten; so
war ein Tillier bereits während des grossen Bauernkriegs 1653 Welschseckelmeister
des Rates zu Bern. Bögli schreibt gegen Tillier:
«Wer daher, wie Tillier, glaubt, es seien bloss Selbstsucht und Hang
zur Verdächtigung Schuld daran gewesen, dass man den wohlwollenden
Sinn der Oberen nicht anerkannt habe, der irrt gewaltig. Dieser
Vorwurf ist eigentlich selbst eine arge Verdächtigung eines ganzen
Volkes»! Denn wir haben ja gesehen, «dass die Weigerung zu bezahlen,
in grossen Bezirken ohne Ausnahme eine allgemeine war». Darum
erstaunt es uns auch nicht, dass Bögli. als weisser Rabe unter den
bürgerlichen Geschichtschreibern, zum Schluss mit Sympathie das
Verhalten der Bauern in diesem Thuner Handel in die Worte zusammenfasst:
«Widerstand gegen Verletzung des Herkommens, Protestation
wider Gewalttätigkeiten und selbstherrliches Gebaren der städtischen
Obrigkeit, eine dunkle Erinnerung an frühere freiere Zeiten,
den Gedanken der Zusammengehörigkeit, selbst mit der katholischen
Bevölkerung von Luzern und Solothurn.»
Das verhilft uns denn auch zu der Erkenntnis, dass in diesem
Wetterleuchten des Aufstands der Berner Bauern vom Jahre 1641
alle wesentlichen Elemente der Spannung zwischen Volk und Regierung
bereits vorhanden waren, die sich dann im grossen Gewitter des
Bauernkriegs von 1653 entladen haben. Oder, wie Bögli schreibt: «Das
Feuer glomm unter der Asche fort, um schon nach zwölf Jahren in
hellen Flammen wieder auszubrechen.»
Jetzt wissen wir auch, wer der Uli Galli war, in dessen Haus in
Eggiwil der Berner Aufruhr um die Jahreswende 1652-53 aus der
Wiege gehoben wurde. Und wir erkennen, dass es nicht von ungefähr
war, dass es gerade da geschah. Die Entlebucher brauchten bei ihrer
am Thomasabend sofort beschlossenen Werbung um die Bundesgenossenschaft
der Berner Bauern nur bei dem unvergessenen Thuner
Handel anzuknüpfen. Und auch dafür hatten sie ein treues Gedächtnis,
dass in Uli Gallis Person das ganze Wissen und die ungebrochene
Ueberlieferung des ersten überhaupt stattgehabten Bauernaufstandes
gegen den Absolutismus der «gnädigen Herrn und Obern» verkörpert
war. Darum auch beginnt der Aufruhr im Bernischen ganz folgerichtig
und stilgerecht mit der Verlesung des in wesentlichen Punkten von
den Berner Herren nie eingehaltenen «Thunerbriefes» in Uli Gallis
Haus. Das war die gegebene geschichtliche Anknüpfung... Das war
der richtige Stachel zum gerechten bernischen Bauernzorn!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 174 - arpa Themen Projekte
IX.
Der Berner Marsch:
«Alli Manne stande-n-y,
|
Uli Galli von Eggiwil also war es, der den Stachel des Thunerhandels,
welcher dem Berner Bauer noch unverheilt im Fleische sass,
tiefer und tiefer hineintrieb, bis er zu dem Ansporn wurde, der das
grosse Rad des Aufruhrs auf der Sonnenuntergangsseite des Napf in
Schwung brachte.
Jetzt aber war das eine andere Sache als im Thunerhandel: keine
blosse Aufwallung des Volkszorns, die ebenso rasch wieder in sich
zusammensank, durfte es werden, vielmehr eine dauerhafte Sache, die
dem Uebel an die Wurzel stiess und diese womöglich für immer aushob.
Ein Bund der Bauern sollte es werden, der, wie der der Entlebucher
im Luzernbiet, so auch hier im Bernbiet, an der Wiedergeburt
der ursprünglichen Eidgenossenschaft der Bauern gegen die Uebermächtigung
seitens der Herren werken sollte. Dazu bedurfte es nicht
eines Putsches, sondern einer festen und zuverlässigen Organisation,
die die gesamte Bauernsame wie ein eisernes Rückgrat durchwuchs.
Und dieses musste aus der täglichen Not der Bauern geschmiedet
werden, die auch hier eine allgemeine, allen Schichten der Bauernsame
gemeinsame war.
Denn seit dem Thunerhandel waren die Beschwerden auch bei
den Berner Bauern —fast haargenau die gleichen wie bei den Luzerner
Bauern —, ins Ungemessene gewachsen. Ja, Zündstoff lag vielleicht
im Emmental noch mehr herum als im Entlebuch. Wenn dennoch
der Aufmarsch der Berner Bauern im ersten Vierteljahr des
Jahres Dreiundfünfzig, gemessen an dem der zehn luzernischen Aemter,
als sehr schleppend und fast gemächlich erscheint, so hat das seinen
Grund, wie wir sahen, wesentlich in dem viel weiter fortgeschrittenen
Absolutismus des bernischen Regierungssystems. Den Emmentalern
fehlten die Volksorgane, durch die sie sich in einer imponierenden,
dem ganzen Volk vernehmlichen Weise hätten aussprechen
können, wie die Entlebucher. Jedes Organ des politischen Volkswillens
musste erst wieder aus dem Nichts aufgebaut werden, und das
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 175 - arpa Themen Projekte
das heisst durch mühsame illegale Kleinarbeit geschehen. Das ist
denn auch der Hauptgrund, warum aus dieser ersten Epoche des Berner
Bauernkriegs, welcher zweifellos eine fieberhafte innere Tätigkeit
entsprach, so viel weniger in die Geschichte gedrungen ist, als aus der
entsprechenden Epoche des Luzerner Aufruhrs.
Der allgemeinste auslösende Faktor war auch im Berner Land der
plötzliche Abruf der Handmünzen, vor allein die Abwertung des Berner
Batzens auf die Hälfte seines bisherigen Wertes im Dezember des
Jahres Zweiundfünfzig. Auch hier nämlich wurde diese Inflation von
den Berner Herren so gelenkt, dass sie selbst zwar Zeit hatten, ihren
Besitz an Handmünzen ans Landvolk abzustossen, während diesem
nur drei Tage Zeit gelassen wurde, seine Batzen zum alten Werte einzulösen.
Das bedeutete bei den damaligen Verkehrsverhältnissen und
bei der grossen Ausdehnung und mannigfaltigen Gebirgsgliederung
des Kantons eine glatte Depossedierung und Ausplünderung weitester
Volkskreise. Und dies auch hier im Augenblick einer furchtbar einschneidenden
Wirtschaftskrise, die durch die auf einen Bruchteil von
früher gesunkenen Boden- und Produktenpreise das Landvolk mit
voller Wucht traf und den allgemeinen Geldmangel auch bei den reicheren
Bauern zu einer wirklichen Geldnot steigerte. Gerade die Art
der Durchführung der Münzmandate, seit dem Januar noch dazu geschützt
durch die Tagsatzung, zerstörte daher mit einem Schlage auch
den letzten Rest des Volksvertrauens in die Regierung sowohl wie in
die Tagsatzung.
So hören wir denn vom bernischen Herrenchronisten Tillier: «Bereits
Anfangs Jänners hatte sich in der Landschaft Saanen ein so bedenklicher
Widerstand gegen die Münzverordnung gezeigt, dass der Rat
sich» — unter dem Datum des 7. Januars alten Stils mithin des 17. nach
dem neuen Kalender —«genötigt sah, ein eindringliches Ermahnungsschreiben
an dieselbe zu erlassen.» Ja, bereits hatte sich «ein Ausschuss
von Simmentalern» ganz auf eigene Faust «heimlich nach Solothurn
begeben, um von der dortigen Regierung die Beibehaltung des bisherigen
Münzwertes» (der auch im Bernischen sehr verbreiteten Solothurner
Batzen) «zu erhalten». Also über den Kopf der eigenen Regierung
hinweg, der man mit Recht nicht das geringste Entgegenkommen zutraute
—eine Eigenmächtigkeit, die den Berner Aristokraten die Haare
zu Berge trieb und in ihren Augen purer Landesverrat war...
Doch wir wollen uns bei den einzelnen Etappen in der Wirkung
und Entwicklung der Münzkalamität nicht weiter aufhalten. Sie wird,
trotz ihrer zweifellos auslösenden Wirkung, wie im Luzernischen so
auch im Bernischen sehr bald überschattet durch die nun sturzflutartig
hervorbrechenden Klagen über die andere, viel weiter zurückreichende
Landplage: die Landvogtplage. Sie war ja das typische Attribut
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 176 - arpa Themen Projekte
Niklaus Leuenberger
Unveröffentlichtes Originalaquarell (Pendant zu Abbildung 7) im
Kupferstichkabinett des Basler Kunstmuseums.
Zeitgenössische Konstruktion nach dem Gefangenenbild der Berner
Herren (siehe Abbildung 8) vermutlich durch Vermittlung des
Oelgemäldes im Besitz von Frau Dr. Grand-Witz (siehe Abbildung
9) oder des handkolorierten Stichs der Berner Stadtbibliothek
(siehe Abbildung 10). Vermutlich vom gleichen Künstler
wie Abbildung 7.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 176 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 177 - arpa Themen Projekte
der im «Freistaat» Bern seit nun zwei Menschenaltern voll ins Kraut
geschossenen absolutistischen Regierungsform des aristokratischen
Gottesgnadentums.
Um es auch in diesem Punkte kurz zu machen, zitieren wir am
besten eine gut zusammenfassende Darstellung des neueren Geschichtschreibers
des bernischen Bauernkriegs Hans Bögli. Er schreibt: «Die
Hauptklagepunkte der Bauern betrafen das Gebaren der Landvögte.
Schon früher hatte die Obrigkeit sich gezwungen gesehen, solche Beamte
zu strafen. Diese Herren erlaubten sich oft ungemein grosse
Ausschreitungen, harte Leibesstrafen und besonders willkürliche Bussen.
Man klagte sogar über Fallstricke, welche reichen Bauern gelegt
wurden, damit die Amtleute sie um hohe Summen bestrafen und sich
damit bereichern könnten. Dazu kam die Schwierigkeit, sich gegen die
Landvögte Recht zu verschaffen. Am meisten angeschuldigt wurde
der barsche Samuel Frisching, Landvogt zu Trachselwald von 1637-1643.
Dieser war übrigens, wie leider mancher andere Eidgenosse in
der damaligen Zeit, ein Verräter am Vaterlande. Er bezog als bestochener
Spion Frankreichs grosse Summen aus Paris. Von einem so habgierigen
und gewissenlosen Manne liess sich allerdings wenig Gutes
für seine Untergebenen erwarten.» Weder seine landesbekannten Bauernschindereien
als Landvogt, noch sein einträglicher Landesverrat
hatten ihn aber verhindert, inzwischen zum «Venner», das heisst zum
Pannerherrn des Staates Bern aufzusteigen —durchaus im Gegenteil!
«Auch sein zweiter Nachfolger» —fährt Bögli fort — «Samuel Tribolet
(1649-1655) trat hinsichtlich der Verwaltung in seine Fussstapfen,
sodass die Emmentaler aus der Landvogtei Trachselwald in
dieser Beziehung am meisten zu klagen hatten.» «An dem Beispiele des
Samuel Tribolet, das nicht als das einzige dieser Art dastand, erkennen
wir, wie tief gewurzelt damals die Korruption in der Verwaltung des
Landes war.» Er trieb es so bunt, dass es selbst den Berner Obern zu
viel wurde. «Er erhielt wiederholt die Mahnung, einzelne unrechtmässig
bezogene Gelder wieder zu erstatten.» Aber obwohl dies bereits im
Januar Dreiundfünfzig landesnotorisch war, wurde er während des ganzen
Bauernkriegs nicht im Amte eingestellt. Erst zu Beginn des folgenden
Jahrs beschloss der Berner Rat, «dass dieser Landvogt in Anbetracht
der vielen unrechtmässig erhobenen Bussen, der Aussaugung der Untertanen
und der Nichtverrechnung vieler Bussen für den Staat seines
Amtes und Ehrensitzes unter den Zweihundert (des Berner Grossen
Rates) verlustig und des Landes verwiesen sein solle... Allein die Exekution
des Urteils war eine überaus lässige.» Und so finden wir diesen,
der fortgesetzten Unterschlagung dem Staat gegenüber überwiesenen
Leuteschinder, dank der Fürsprache seines mächtigen Schwiegervaters,
des Schultheissen Anton von Graffenried, schon anderthalb Jahre
später wieder im Grossen Rat zu Bern und weitere sieben Jahre später
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 178 - arpa Themen Projekte
Baden und nachmals zu Avenches wieder! Denn wie Bögli richtig bemerkt:
«An eine radikale Beseitigung dieses Uebelstandes liess sich
seit der Niederwerfung des Aufstandes nicht mehr denken.)> Ueber
Tribolet haben die Bauern schon bei seinen Lebzeiten Spottlieder gedichtet.
Eines über seine Verwaltung der Grafschaft Baden hebt an:
«Tribolet, du toller Gast,
Aller Bauern Ueberlast!
Ohne Ruhm und Lob du bist,
Tribolet, du böser Christ!»
Das Raffen und Wüten dieses Landvogts hat sich dem Volke derart
abschreckend eingeprägt, dass sein Andenken noch heute in dem
allgemein gebräuchlichen bernischen Verbum «tribulieren» für «plagen»
weiterlebt, ja als dasjenige einer wahren Gottesgeissel nach dem
Muster eines Attila lebendig ist. Denn noch im Jahre 1931 schrieb Joseph
Rösli in seiner Dissertation darüber: «Wenn das Gewitter am
Himmel dräut, Blitze zucken, Donner krachen und Hagelschlossen die
Früchte des Landes zermalmen, gibt es Emmentaler, die schwören,
den Landvogt Tribolet zu sehen, dessen Seele keine Ruhe findet, auf
schwarzem Rosse durch die Wolken reitend»
Ein kleines Detail aus dieser bitteren Tribolet-Komödie möge uns
erneut an die schändliche Rolle der Berner Geistlichkeit erinnern. Als
das Untier Tribolet endlich gestellt und vor dem Berner Rat unter
nicht weniger als 73 Klagepunkten angeklagt war, da waren es sämtliche
neun Prädikanten seiner Landvogtei, welche in speichelleckerischen
Bittschriften an den Rat das Lob dieses Helden sangen, die Klagen gegen
ihn nur dem «Hasse böser Buben» zuschrieben und mit frommem Augenaufschlag
seine Freisprechung verlangten! Ja, diese «Gottesboten»
gehen so weit, sich dafür nicht nur auf die »Gebote des Christentums»,
sondern auch auf die «Verdienste» Tribolets bei der Niederschlagung
des Aufruhrs zu berufen und die Obrigkeit inständig zu bitten, «sich
die vortrefflichen Gaben Tribolets noch ferner nutzbar zu machen»!
Sie wussten warum: hatte ihnen doch dieser hohe Herr —wie in dem
bereits nachgewiesenen Fall Anthoni Kraft, des Prädikanten von Langnau
— so manchen schönen Nebenverdienst für ihre Spitzel-, ja Lockspitzelarbeit
an den Bauern zugehalten...
Die Pfaffen waren hierzulande der verlängerte Schatten des Landvogts,
der bis in die hintersten Schächen und Krachen reichte, wo nur
ein Kirchlein stand. Sie berichteten ihm in fortlaufenden Korrespondenzen
über jede «verdächtige» Bewegung des Landvolks. Darum galt
es für unsere tapferen Bauernverschwörer, sich ganz besonders vor
diesen Raben in Acht zu nehmen. Und sie taten es auch. Nur so ist es
beispielsweise zu erklären, dass der Pfarrer Nüsperli von Schangnau,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 179 - arpa Themen Projekte
nichts zu ahnen schien von der eifrigen Verschwörertätigkeit
in seiner allernächsten Umgebung. Er schrieb nämlich am Einunddreissigsten
dem Landvogt Tribolet zwar wohl einen langen und genauen
Bericht über die revolutionären Vorgänge im Entlebuch, in dem
er ihm die schreckenerregende Knüttelwallfahrt zum Heiligen Kreuz
denunzierte; aber über die Emmentaler gibt er ihm die beruhigende
«Versicherung, die Untertanen klagen zwar auch über das Münzmandat
bitter, haben aber ihren Abscheu über das Gebaren der Entlebucher
offen bekannt und erwarten, die Schuldigen werden der Strafe
nicht entgehen»! So gut wussten die Bauern sich vor ihrem Seelenhirten
zu tarnen...
Um zu zeigen, wie nicht nur punkto Münzkalamität —und natürlich
auch in der Landvogtplage —, sondern auch in allen anderen wirtschaftlichen
Fragen eine bis zur Identität gleiche ökonomische Lage im
Bernischen wie im Luzernischen herrschte, tun wir am besten, auch über
diese Fragen eine kurz zusammenfassende Stelle unseres bernischen
Geschichtschreibers des Bauernkriegs hierher zu setzen. Bögli schreibt:
«Allgemeine Klagen wurden laut über die Beschränkung des Handels
(des Freikaufs), das Salz- und Pulvermonopol, über die Administration,
die Kosten der Schuldenboten, die Taxen und Taggelder der Landvögte,
Landschreiber, Richter und Fürsprecher, über das sogenannte
Trattengeld (von traité), eine Abgabe auf jedes Pferd und jedes Stück
Vieh, das über die Grenze ausgeführt wurde. Letztere Abgabe fiel
natürlich den Bauern zur Last und erregte deshalb grossen Unwillen.
Man nannte das Trattengeld auch spottweise Ratten- oder Krottengeld»;
dazu kommt auch im Bernbiet «die Beschränkung von Handel
und Gewerbe» auf dem Land durch die Zunftprivilegien der Stadtbürger,
sowie ganz dasselbe Ohm- oder Umgeld wie im Luzernbiet. Und
dies alles auch im Bernischen auf dem düsteren Hintergrund einer allgemeinen
Verschuldung und Entwertung der Bauerngüter und Bauernprodukte
seit dem westfälischen Frieden. Nur ein Beispiel für den katastrophalen
Preissturz: «das Getreide, welches vorher zu 40 Batzen
per Viertel verkauft worden war, galt jetzt nur noch 11 Batzen»! Und
auch hier im Bernischen wurde wie im Luzernischen —wie auch in
Zürich und Basel — von der Obrigkeit die Schuld an all diesen Dingen
in heuchlerischen «Sittenmandaten» der «Wohllebigkeit» und «Verschwendungssucht»
der Bauern zugeschoben; nur hier noch gehässiger
als im Luzernischen, weil man dort mit dem Herrentum noch nicht
ganz zu der Blüte der Berner gelangt war und weil diese letzteren eben
hundertprozentig über ihre «sittenstrengen » Prädikanten verfügten...
Diese allesbeherrschenden Realitäten des menschlichen Lebens,
die unter allen politischen und religiösen Grenzen hindurchgingen, stifteten
die von allem Anfang an überaus innige Gemeinschaft und «brüderliche»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 180 - arpa Themen Projekte
Bauern und den protestantischen Berner Bauern. Sie drückte sich besonders
auch in der fortgesetzten persönlichen Anwesenheit und Teilnahme
der Einen an den Zusammenkünften der Andern aus.
Der bernischen Teilnehmer an der grossen Landsgemeinde in Wolhusen
am 26. Februar haben wir bereits gedacht, und wir wissen, wie
eifrig und begeistert sie Abschriften des Wolhuser Bundesbriefes über
die Berge in die Heimat brachten. Diesem Ereignis waren aber zweifellos
schon ungezählte Botengänge hin und her über die Grenze vorhergegangen.
Wir wissen auch bereits, wie eifrig die Berner Herren ihre
Bauern auf all diesen Wegen zu überwachen und in den Wirtshäusern
zu bespitzeln trachteten; wie sie die Jahrmarkte im Emmental nach
den gefürchteten «Entlebucher Boten» absuchten; z. B. zu Ende Februar
den Jahrmarkt zu Langnau «unter dem Vorwand von Privatgeschäften»,
ausgerechnet durch den Ratsherrn und Venner Samuel Frisching,
worüber selbst der gute alte Domdekan Vock in seiner Geschichte
des Bauernkriegs den Seufzer ausstösst: «warum gerade
dieser Abgeordnete geschickt ward, ist unbegreiflich»! Wir wissen
auch, dass der moderne luzernische Herrenchronist Theodor von Liebenau
das «übermütige Auftreten der Entlebucher» auf der Schüpfheimer
Landsgemeinde vom 16. Februar, an der sie den Luzerner Ratsherren
das «neue Tellenlied» als Nachtständchen sangen, «ohne Zweifel»
auf die Nachricht schiebt, «das ganze Emmen- und Simmental und
selbst das Berner Oberland bis nach Thun hinauf sei bereit, sich den
Entlebuchern anzuschliessen». Wir wissen auch, dass eine der Extraforderungen,
die der Schulmeister Johann Jakob Müller den Luzerner
Herren noch kurz nach der Abfuhr derselben auf derselben Landsgemeinde
überreichte, zugunsten der Berner Bauern gemacht war, da sie
lautete: «die Verleihung von Alpen an Berner soll taxenfrei gestattet
werden». Und wir wissen ferner, dass der Rat von Luzern schon am
19. Februar den Ratsherrn und Landvogt Ludwig Meyer an den Rat
zu Bern abordnete, um zu bewirken, «dass den Entlebuchern weder
Waffen, Munition, noch Lebensmittel zugeführt werden dürfen» — wozu
die Berner Bauern also notorisch bereit gewesen sind und was sie
auch tatsächlich taten. Haben doch auch schon am 24. oder 25. Februar,
auf das grosse und gefährliche Vorhaben des Wolhuser Bundesschwures
vom 26. hin, die «bernischen Stettlin» dem Willisauer «Stettlin» zugesagt,
«sie wollen ihnen mit Leib, Gut und Blut beistehen», und haben
ihnen zur Bekräftigung dessen «ein paar Fässchen Pulver geschickt».
Und schrieb nicht umgekehrt der eifrige Schulmeister und neuerwählte
«Ratsschreiber» Müller schon am Tag nach vollzogenem
Schwüre den Emmentalern dieselbe Hilfe zu, noch weit über diese hinaus
alle Leidensgenossen umfassend: «Da auch anderwärts neue Zölle,
Auflagen, Steuern etc, aufgebracht worden seien, anerbieten sie allen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 181 - arpa Themen Projekte
und ihre Beschwerden abschaffen helfen.» Und so waren zu
Beginn des Märzen die Fäden hinüber und herüber schon so weit gespannt,
dass die Freiburger «Ehrengesandten» in Luzern bereits am
Sechsten fürchteten, «der Aufstand möchte sich durch die Berner Bauern
auch nach ihrem Kanton verpflanzen»!
Erst am Märzanfang beginnt unsere genauere Kunde über den
inneren Aufmarsch der Berner Bauern, obwohl dieser schon lange gedauert
haben muss, wenn er bereits derartig weitgespannte Befürchtungen
zu erregen vermochte. Schon der Ratsherr-Spitzel Samuel Frisching
hatte in Langnau bemerkt und sofort nach Bern gemeldet, «dass
die Emmentaler Artikel aufsetzen». Am 3. März kam auf das Schloss
in Trachselwald die Kunde «von verdächtigen Leuten, von Knütteln,
die zu Langnau gefunden wurden, und vom Salzankauf im Entlebuch...»
Am 6. März —als die Luzerner Bauern sich eben, nach dem
turbulenten Tag zu Willisau, auf die Verhandlungen mit den «Ehrengesandten»
in Werthenstein rüsteten —fand die erste grössere Volksversammlung
der Berner Bauern in Huttwil statt: «ohne wüssen und willen
der oberkeit gemeindet», haben hier «bei hundert Emmentaler bauern
die erste zusammenkunfft gehalten». Und dies zwar gerade in denselben
Stunden, als am gleichen Ort der Ratsspitzel Samuel Frisching
«die Vorgesetzten mehrerer Gemeinden» um sich versammelt hatte, über
die er nach Bern berichtete, dass sie «ihn aller Treue gegen die Oberkeit
versicherten». Im selben Bericht nämlich muss er mit sauersüsser
Miene die «unerfreuliche Nachricht» melden, «dass, während er zu
Hutwyl sich befand, die missvergnügten Bauern eine heimliche Zusammenkunft
eben daselbst hielten, und sich über die Eingabe ihrer
Klagepunkte an die Regierung besprachen». Oder, wie der Landvogt
Bernhard Mey zu Wangen unterm 8. März genauer nach Bern meldet:
«dass vorgestern zu Huttwyl wegen des Trattengeldes und des freien
Kaufs bei 100 Emmentaler Bauern zusammengetreten seien und gedroht
haben, den Landsturm ergehen zu lassen, wenn diejenigen Leute,
welche zu Wolhusen gewesen, arretiert werden sollten»! In diesen Worten
wird wohl ein Zipfelchen über dem wahren Auftrag gelüftet, mit
dem die Berner Herren ihren Spürhund Frisching in diese Lande geschickt
hatten. Stammte doch die Mehrzahl der uns bekannten Berner
Teilnehmer an der Wolhuser Landsgemeinde aus Huttwil und seiner
näheren oder weiteren Umgebung, wie Gondiswil, Rohrbach, Wangen,
Aarwangen und Trachselwald.
Derselbe Landvogt Mey zu Wangen weiss aber im gleichen Brief
an die Berner Herren auch schon zu melden, dass am gleichen Tag,
da er schrieb, am Achten, auch in Langnau eine Zusammenkunft stattfinde,
«um Zeit und Ort einer grösseren Landsgemeinde festzusetzen».
Zu gleicher Zeit fanden ebensolche Beratungen in Schangnau und in
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 182 - arpa Themen Projekte
«grössere Landsgemeinde» aller Emmentaler, unter Zuziehung von
Ausschüssen aus dem Oberaargau und dem Oberland, zusammentreten.
«Im Oberaargau hielten die Rohrbacher besonders des Trattengeldes
und des Freikaufs wegen, fest an dem Entschluss, in Langnau sich
vertreten zu lassen; ebenso überredeten sie die Ursenbacher dazu.»
«Im Oberland wurden durch emmentalische Botschafter nun auch
Brienz und Hasli, das bisher der Obrigkeit als treu bezeichnet worden
war, zur Teilnahme eingeladen.»
Noch am Tage der Eröffnung dieser «grösseren Landsgemeinde»
wurde weit im Land herum zu ihr aufgeboten, ein Zeichen dafür, dass
es nicht nur auf eine grössere, sondern auch auf eine längere Landsgemeinde
abgesehen war, auf eine fortlaufende «Bauerntagsatzung».
So meldet am Dreizehnten der Landvogt von Fraubrunnen nach Bern,
«dass die Leute von Koppigen, Limpach, Utzenstorf etc. von einem
gewissen Stauffer aus dem Eggiwil» (das war sicherlich ein Bote des
Uli Galli!) «eingeladen wurden, auf morgen (den Vierzehnten) einen
Deputierten nach Langnau zu schicken». Und am Vierzehnten meldet
der Landvogt Niklaus Willading zu Aarwangen, «dass gestern Nachmittags
um vier Uhr Balthasar Jäggi von Busswil von den Melchnauern
und Gondiswilern nach Langnau abgeordnet worden sei». Dieser
Jäggi ist später, nach der Niederwerfung des Aufstands. unter Hinterlassung
einer Frau und fünf Kindern geflüchtet und nie wieder heimgekehrt;
statt seiner Enthauptung wurde sein Name durch Ratsbeschluss
«auf Blechtafeln an den Galgen verrufen und sein Vermögen
konfisziert»; sicherlich also kein unwichtiger Mann in der Bauernbewegung.
Ueberaus bezeichnend für die freudige Erregung, die das
Landvolk überall ergriff, wo für die Langnauer Landsgemeinde aufgeboten
wurde, ist der Bericht, den Landvogt Willading in demselben
Brief vom Vierzehnten über die ihm besonders widersetzliche Gemeinde
Melchnau im Amt Aarwangen gibt: «Melchnauw will es bis in
Tobt mitt den Emmenthaleren halten; es gehet erger weder niemahlen;
man hebt die Masque auff und sagt, dass es nun recht wider die Obrigkeiten
gemeint wäre, das jauchzen und fröwen hatt also überhand
genommen, das nicht zu beschreiben were»! Kurzum: «Langnau war
überhaupt in jenen Tagen der Ort, wohin die Ausgeschossenen aus
den verschiedenen Teilen des Kantons sich begaben, um mit den Emmentalern
gemeinsame Schritte zu beraten.»
Sehr bezeichnend für die Zusammensetzung dieser Bauerntagsatzung
sowohl wie für die Motive ihrer Besucher ist, was der Berner Hat
seiner Gesandtschaft an der Herrentagsatzung in Baden am 18. März
darüber schreibt: es hätten dort vor allem Leute «aus den Aemtern,
die etliche Jahre zuvor im Thuner Unwesen interessiert» gewesen seien,
ihre «Klageartikel» zusammengetragen. Diese Bauerntagsatzung war
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 183 - arpa Themen Projekte
zu ihr hatte sich seine Verlesung des «Thunerbriefes» zu Beginn
der Verschwörung in seinem Haus in Eggiwil schliesslich ausgewachsen.
Die Landsgemeinde zu Langnau am 13. März und in den folgenden
Tagen ist in der Tat zum ersten grossen geschichtlichen Ereignis
im Berner Bauernkrieg geworden. Sie hat auch im voraus schon, allein
durch die Kunde von ihrer Einberufung, ihren Schatten auf den Verlauf
der Ereignisse im Luzernischen geworfen. Denn auf diese Kunde
hin, die die Luzerner Bauern in Jubel versetzte und sie bei den Verhandlungen
mit den eidgenössischen «Ehrengesandten» in Werthenstein
zum äussersten Widerstand anspornte, war es geschehen, dass
einer der dort «vermittelnden» Freiburger «Ehrengesandten», der
Seckelmeister von Montenach, seine Regierung schon am 12. März um
die Veranstaltung einer Konferenz zwischen den Ständen Bern, Freiburg
und Solothurn ersuchte, «die darauf Bedacht nehmen sollte, die
Bauern zu einer Diversion zu bestimmen», da diese in ihrem Jubel vorwegnehmend
schon damals, wie von Montenach schrieb, «auf ein
Hülfsheer von 6-7000 Mann aus dem Kanton Bern rechneten». Und
diese «Diversion» ist denn auch prompt gestartet worden, wie wir gesehen
haben: besser konnte man die Erwartung der Luzerner Bauern
auf den Zuzug der Berner Bauern nicht konterkarieren, als durch
die unverzüglich und umfassend ins Werk gesetzte Rüstung der Berner
Herren! Deren Drohung genügte ja, um unter den Luzerner Bauern
die Berner Einmarsch-Panik zu entfesseln, die ihre Armee von Luzern
abzog und im entscheidenden Augenblick auseinanderriss.
Die Langnauer Landsgemeinde hatte aber durch ihren Verlauf
vor allem auch eine grundlegende innerbernische Bedeutung: sie war
das erste Signal zum offenen Kampf für die Herren wie für die Bauern.
Für die Herren in diesem Stadium vielleicht noch mehr als für die
Bauern, deren Massen erst infolge dieser offenen Landsgemeinde über
die bisher geheimen Absichten ihrer Führer aufgeklärt und für ihre
Ziele mobilisiert werden konnten. Denn die Berner Herren hatten aus
den Luzerner Vorgängen gelernt: sie verachteten die «schwächliche»
und «schwankende» Haltung ihrer Ratsherren-Genossen in Luzern
und wollten diesen eine Lektion erteilen, wie man mit solchem Bauernpack
abfährt, statt mit ihm zu parlamentieren.
Zwar hatte der Rat, auf die Berichte der Landvögte hin, schon am
11. März den Beschluss gefasst, eine ganz erstaunlich ansehnliche
«förmliche Gesandtschaft» nach Langnau abzuordnen. Vom Kleinen
Rat, der eigentlichen Regierung, erschienen daher schon zur Eröffnung
der Landsgemeinde am Dreizehnten der Schultheiss Dachselhofer in
Person —der Führer der sogenannten «Friedenspartei» im Rate, die
nur auf ganz kurze Zeit die Oberhand gewonnen hatte —, der Ratsherr
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 184 - arpa Themen Projekte
Samuel Frisching, der frühere Landvogt und jetzige Landesverräter im
Dienste Frankreichs. Vom Grossen Rat waren ihnen beigeordnet: der
frühere Landvogt von Signau Marquard Zehender, der «Hofmeister»
Imhof und der Alt-Landvogt und Oberst Morlot. Sie hatten den Auftrag,
die Bauern gleich zu Beginn «zur Gebühr anzehalten», ja, wenn
möglich, soweit zum Gehorsam zurückzuführen, dass man sie zum Zuzug
für die Luzerner Herren aufbieten konnte.
Diese Zumutung, nebst der blossen Anwesenheit des verhassten Frisching
genügte jedoch, um die Bauern erst recht rebellisch zu machen.
Erstens «einigte man sich dahin, der Regierung keine Hülfe zu einem
Feldzug gegen das Entlebuch zu leisten» — das heisst: man meuterte
offen! Man drohte sogar, «eher für die Entlebucher als gegen sie ausziehen
zu wollen»! Zweitens versprach man zwar, was man ohnehin
vorhatte, «die Wünsche schriftlich an den Rat einzureichen»; aber,
wie der Rat zu Bern an den zu Zürich darüber schrieb: «habind aber
bynebends ussdruckenlich verluthen lassen, dass sie bis zum Usstrag der
Sach Verwaltung, Gricht und Rechtens (der Regierung) nit weiter gestatten
wellind»! Diese selbstherrliche Unterbrechung des behördlichen
Gerichts- und Geschäftsgangs seitens einer an und für sich illegalen
Bauernversammlung war ein revolutionärer Akt reinsten Wassers.
Ausserdem aber haben die Emmentaler den Berner Herren auf
der Langnauer Landsgemeinde auf die genau gleiche drastische Weise
wie die Entlebucher mit den «Gyslifressern» anschaulich gemacht,
welchen «Respekt» die Obrigkeit im Lande noch genoss. Denn Schuldboten
gab es auch im Bernerland. Der Lockspitzel-Prädikant Anthoni
Kraft, der als Pfarrer zu Langnau Augenzeuge war, trug folgenden ergötzlichen
Bericht darüber in den Langnauer Eherodel ein: «Dann de
Bauern ganz rasend gewesen, also dass sie in Beysein bemeidter Herren
die Betten gezäumet, denen sie mit Gwalt ein Wyd ins Maul gelegt,
und sie also hiemit gewalttetiger Wys gezwungen, von ihrem Gwärb
fürthin abzustahn. Desgleichen habend sy auch alle diejenigen mit einer
Wyden, oder mit Beträuwung, die Ohren abzuhauen oder ze schlitzen,
gezwungen, sich uff ihrer Seiten wider die Oberkeit ze halten, und es
in ihrem bösen Vorhaben mit ihnen ze haben.» Auch in Steffisburg
kam es übrigens bereits zu solchen «Exzessen, indem man sich an zwei
Schuldenboten vergriff». Was aber die Berner Herren in Langnau vielleicht
noch mehr mit «grosser Hitz und Entrüstung wider die Bauern»
erfüllte, als der Anblick ihrer «gewidleten» Handlanger, das war die
überaus zahlreiche Anwesenheit auch von Luzerner Bauern bei dieser
ersten offen rebellischen Berner Landsgemeinde. Denn der alte bernische
Herrenchronist Tillier berichtet ausdrücklich: «Die Versammlung
war sehr zahlreich, sowohl von Bauern aus dem Kanton Bern, als
von Luzernern (besucht). Berner und Luzerner verbanden sich unter
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 185 - arpa Themen Projekte
den Berner Herren höchst augenfällig das Scheitern aller
ihrer bisher unternommenen Versuche, diejenigen, die gleiche Not
einte, durch Polizeimassnahmen zu trennen. Unter diesen Umständen
ist es nur zu verständlich, dass die Herren —wie unser edler Anthoni
Kraft in den Eherodel schrieb — «Nut ausgerichtet, sondern mit Verachtung
widerumb heimreissen müssen».
Bereits am Vierzehnten früh kehrte die Ratsabordnung völlig unverrichteter
Dinge nach Bern zurück, «wo sie Nachmittags dem Rate
ihren unerfreulichen Bericht abstatteten». Nun siegte natürlich die
Kriegspartei im Rat auf der ganzen Linie, und spätestens von da an
war der Berner Rat zur gewaltsamen Niederwerfung des Aufstandes
entschlossen. Er meldete am Fünfzehnten an den Rat des Vororts
Zürich: «leider frisst das Uebel der Ansteckung immer weiter umb sich,
dass etliche unsserer (an Luzern) angrentzenden Unterthanen des Böszen
Gifftes in sich aufnemmen und tust es sich bis in unsser beidersyts
G. L. E. der Stadt Fryburg und Solothurn Landt erstrecken».
Dies war aber bereits eine bloss nachträgliche Rechtfertigung dem
Vorort gegenüber, um die von der Kriegspartei schon weit herum in
Gang gesetzten Mobilisierungsrnassnahrnen zu begründen. Der alte
Berner Herrenchronist Tillier meidet z. B.: «Die beiden Obersten der
waadtländischen Regimenter aber, Wilhelm von Diesbach und der
Altlandvogt Morlot, mussten sich sofort auf ihre Sammelplätze begeben
und den Aufbruch ihrer Truppen in Gang bringen, wozu auch die
waadtländischen Amtleute (Landvögte) die notwendigen Weisungen
erhielten.» Das geschah bereits am Fünfzehnten, also gleichzeitig
mit dem Schreiben an den Vorort. Von dessen Obrigkeit nämlich besorgte
man mit Recht einen hemmenden Einspruch, weil der Rat zu
Zürich nicht ohne Grund fürchtete, durch allzu forsches militärisches
Auftreten könnten seine eigenen Untertanen zum Aufruhr angereizt
werden. So meldet der Zürcher Geschichtschreiber des Anteils dieses
Standes am Bauernkrieg, Gustav Jakob Peter: «Die Emmentaler und
die übrigen zum Abfall von der Regierung entschlossenen Bauern
hofften schon zur Zeit der Landsgemeinde von Langnau nicht nur auf
den Anschluss der gesamten bernischen Bauernschaft, sondern auch
dass die Zürcher Bauern gemeinsame Sache mit ihnen machten, namentlich
die Wädenswiler und Knonauer.» Nicht zufällig Leute gerade
aus diesen Aemtern: denn 1646 waren vier Wädenswiler und drei
Knonauer hingerichtet worden.
Was der Zürcher Rat für seine Untertanen befürchtete, das trat
für die Berner Untertanen als Folge der Truppen aufgebote prompt ein.
Peter schreibt: «Dass gerade in diesen Tagen die im Welschland aufgebotenen
Truppen, zwei Regimenter Waadtländer, vorläufig in die
Gegend von Payerne vormarschierten und vom 17. März an Verbündete
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 186 - arpa Themen Projekte
Münstertal und Truppen aus Erlach, Nidau, Büren und Aarberg in
Bern einrückten, trug wesentlich dazu bei, die Erregung der Berner
Bauern in gefährlichem Mass zu steigern.» Nach demselben Autor verfügte
der Berner Rat in der Stadt selbst bereits am 17. März, «abgesehen
von der bewaffneten Bürgerschaft, über ungefähr 1300 Mann
in der Stadt», «usser denen auch im Anzug gewessenen beiden weltschen
Regimenteren und den 300 Man von Genff»! Grund genug, um
nicht nur die Erregung der Berner Bauern, sondern auch die Berner
Einmarsch-Panik der Luzerner Bauern, wie wir sie bereits kennen gelernt
haben, als sehr begründet zu erkennen. Selbst der alte Herrenchronist
Tillier muss bekennen: «Uebrigens brachten diese kriegerischen
Aufgebote die bisher bloss im Stillen herumschleichende Gährung
an's Licht, und beförderten den Ausbruch.»
«Wie hoch das Misstrauen der Berner Bauernschaft gegen ihre Regierung»,
schreibt Peter weiter, «namentlich auch wegen der Heranziehung
der Truppen aus den westlichen Kantonsteilen bereits gestiegen
war, geht aus dem Schreiben der Emmentaler Bauern an die Grafschaft
Lenzburg hervor.» Es ist dies ein erstes «souveränes» Aktenstück
der Berner Bauern, das noch am 19. März von der (mithin immer
noch, wenn auch wohl mit wechselndem oder reduziertem Bestand,
tagenden!) «Bauerntagsatzung» zu Langnau erlassen worden ist. Darin
heisst es: «wir wüssend nit, wie die Gnedigen Herren ess mit unss
meinend; wüssend aber, dass vii volkh (Kriegsvolk) in der Stadt; habind
unss gester gmahnt, müessend ins Entlebuch ussziehen, Luzern
ze entschütten, welches wir nit haben wellen thuen. Wir begerend zu
wüssen, ob ir in solchem Handel der grechtigkeit nach mit unsz ze
sein hegen.» Und die Berner Bauern schliessen mit den hochgemuten
Worten: «Wir sind der Hoffnung, es werde unser Vorhaben dem ganzen
Lande erbaulich sein. Damit seid Gott befohlen!»
Tatsächlich haben die Lenzburger Bauern ihre Solidarität mit den
Berner Bauern schon zwei Tage nach Erhalt dieses Schreibens in
höchst dramatischer Weise bekundet. Zu den Nachrichten von den
starken Berner Rüstungen kamen inzwischen nämlich auch solche
von den noch viel umfassenderen eidgenössischen, die die nahe in Baden
tagende Tagsatzung beschloss. Zudem war den Lenzburgern bereits
am 11. März vom Berner Rat einer der draufgängerischsten Berner
Junker, der Oberstleutnant May von Rued, als Kommandant aufs
Schloss gesetzt worden, der sofort die Faust gegen die Bauern zeigte
und Drohungen gegen sie ausstiess. Er setzte die Schlösser Lenzburg
und Wildegg auch sofort in kriegsmässigen Zustand und warb am
17. März 120 Mann eigens dazu an. «Die Regierung hätte im Sinne,
hiess es, die Ungehorsamen mit fremdem Kriegsvolk zu überziehen
und blutig zu strafen», berichtet Hans Nabholz, der Geschichtschreiber
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 187 - arpa Themen Projekte
—die, wie wir sahen, ihrer Substanz nach wahrhaftig sehr
begründet waren! «führten nun auch in der Grafschaft Lenzburg
zum Ausbruch des offenen Aufruhrs. Am 21. März verbreitete sich
plötzlich das Gerücht, welsche Truppen ziehen von Bern gegen Zofingen.
In verschiedenen Dörfern wurde sofort Sturm geläutet, Boten zu
Pferd und zu Fuss erschienen in der Grafschaft Lenzburg und forderten
die Bauern auf, bewaffnet nach Zofingen zu ziehen, um die heranziehenden
Truppen am weiteren Vordringen zu hindern. Wirklich war
in kurzer Zeit die ganze Grafschaft in Waffen...»
Zu einer solchen Kette von kriegerischen Ereignissen und Paniken
also hat letzten Endes schon die blosse Kunde vom Zusammentreten
der Langnauer Landsgemeinde, geschweige die Abfuhr, die
diese den Berner Herren erteilte, geführt. Wobei wir die zahlreichen
örtlich weit ausgedehnten Dienstverweigerungen und Meutereien, die
unmittelbar an diejenige der Emmentaler zu Langnau anschlossen,
übergangen haben, da wir die beiden wichtigsten, die zu Langenthal
und im Greyerzerland, bereits im ersten Buch herausgestellt haben; denn
dort musste die begeisternde Wirkung, die die Nachrichten über diese
Meutereien im Luzerner Bauernheer ausgelöst haben, uns darauf führen.
Wir erkennen diese Meutereien jetzt klar als Früchte der mutigen Haltung
der Langnauer Lands gemeinde, deren Losungen wie von einem
Lauffeuer durchs ganze Land und über seine Grenzen hinaus getragen
wurden... Diese Landsgemeinde ist mithin für die geschichtliche
Entfaltung des Bauernkriegs insgemein von sehr viel grösserer Bedeutung,
als sie ihr von allen neueren Chronisten des Bauernkriegs,
gerade auch vom Berner Bögli, zugeschrieben wird.
Dafür finden wir bei diesem den einzigen genaueren Nachweis
für die Beschlüsse der Langnauer Landsgemeinde auf ökonomischem
und gewissermassen innerpolitischem Gebiet, mithin über diejenigen
Fragen, die die ureigentlichen Interessen der Bauern ausmachten.
«Zwanzig Klagepunkte» zwar sollen die Berner Bauern nach Tillier
in Langnau aufgesetzt haben; aber er fasst sie in einen Satz zusammen.
Dafür finden wir bei Bögli immerhin zehn Artikel gesondert aufgeführt.
Es ist wiederum bezeichnend für die Rolle der Berner Geistlichkeit,
dass wir diese zehn Punkte dem Spitzelbericht eines Prädikanten,
des Christoffel Müller — oder Christoforus Molitor, wie er sich
hochtrabend nannte — zu Höchstetten, an den Berner Rat verdanken.
Wo nur mögen die wirklich aufgesetzten und eingereichten Artikel der
Bauern selbst hingekommen sein?
Die uns durch den Spitzelbericht erhaltenen zehn Bauernforderungen
lauten nach Bögli folgendermassen: «1. Dass man die Bauern
bei ihren alten Freiheiten und Gerechtigkeiten schützen und dieselben
handhaben solle. 2. Freier Kauf in Allem. 3. Dass sie mit dem Salpetergraben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 188 - arpa Themen Projekte
dürfe Pulver kaufen. 4. Dass die Bernbatzen wieder ihren alten Werth
haben oder der Schaden ihnen in den Reisgeldern ersetzt werde, da
man ihnen bei Erlegung des Reisgeldes versprochen, Batzen werden
Batzen bleiben, so lange Bern bestehe (!). 5. Was man an Zinsen nicht
baar entrichten könne, dafür soll man Getreide zur Bezahlung bieten
dürfen. 6. Dass in jedem Gericht nicht mehr als ein Bot sei, der Bürgschaft
stelle. 7. Dass die Lehengüter nach dem Absterben des Lehenmannes
unter die Erben vertheilt werden dürfen mit Stellung eines
Währschaftsträgers, damit desto minder Geld auf die Güter entlehnt
werde. 8. Dass bei Ausleihung des Geldes in Bar geliehen werde. 9. Dass
die Amtleute, derweil sie noch auf ihren Aemtern seien, die Bussen
einziehen. 10. Dass ihnen erlaubt werde, im Fall der Noth Landsgemeinden
zu halten.»
Wir wollen uns bei den wirtschaftlichen Punkten nicht weiter
aufhalten; sie beweisen aber auf der ganzen Linie den vollkommenen
Parallelismus der Forderungen bei den Berner und Luzerner Bauern.
Der politisch wichtigste Artikel ist der letzte: das Verlangen nach freien
Landsgemeinden. Denn das war sogar mehr als die Rückforderung des
alten «Volksanfrage»-Rechtes — das war der erste Schritt zur Autonomie!
Denn freie Landsgemeinden konnten ohne weiteres die ganze
«absolute» Gesetzgebung der Obrigkeit in Frage stellen. Von dieser
Forderung zu derjenigen der Entlebucher, Willisauer, Rothenburger
und Hochdorfer, dass die Gesetze der Obrigkeit nur Gültigkeit erlangen
sollen durch Vorlegung an die Landsgemeinden und nach erfolgter
Zustimmung seitens dieser, ist es nur ein Schritt.
Während die Langnauer Landsgemeinde noch tagte, und zweifellos
durch deren ins ganze Bernerland ausgesandte Sendlinge veranlasst,
traten am Siebzehnten im benachbarten Konolfingen zum erstenmal
auch die Ausgeschossenen der vier Land gerichte Konolfingen, Seftingen,
Sternenberg und Zollikofen zusammen. Auch sie erteilten einer
Berner Ratsdeputation, die, wie zur Provokation der Bauern, wiederum
den verhassten Frisching mitbrachte, die verdiente Abfuhr. Es war am
selben Tag, als zu Bern die Kriegräte der Berner, Freiburger und Solothurner
Herren zusammensassen und das unverschämte Hetzschreiben
an den Luzerner Rat erliessen, «die Stadt solle doch mit diesen der
Vernunft beraubten Menschen keinen Vertrag abschliessen, durch welchen
die Rechte der Regierungen geschmälert würden»! Eine Gesinnung,
die es vollkommen ausschliesst, dass die gleichzeitig nach Konolfingen
delegierte Ratsdeputation auch nur die geringsten ernstzunehmenden
Friedensabsichten hegen konnte. Am Neunzehnten wurde vom
Berner Rat dann auch der brutalste aller Berner Junker, der schon
durch seine «Taten» im dreissigjährigen Krieg im Dienst der Schweden
berüchtigte Generalmajor Sigmund von Erlach, zum Oberbefehlshaber
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 189 - arpa Themen Projekte
zum Proviantmeister ernannt.
«Obwohl nunmehr», sagt Bögli, «der luzernische Aufstand sich
vorläufig gelegt hatte, wurden dennoch die» (angeblich zum Zuzug für
die Luzerner Herren aufgebotenen) «Truppen unter den Waffen gelassen.
Denn die Unzufriedenheit des Landes steigerte sich.» «Am 18.
März berichteten die Hauptleute zu Aarwangen, dass die Langenthaler
sich der Aushebung widersetzt hätten, die Weibel von Herzogenbuchsee
und Madiswil übel traktiert worden seien und Briefe von den Bauern
aufgefangen würden.» Auch der Weibe! von Ursenbach wurde
«misshandelt». Im Amt Aarwangen wurde die Aufregung immer grösser.
«Die Roggwiler und Langenthaler waren im Begriff, allgemein die
Waffen zu ergreifen, und die Aarwanger drohten, die Brücke abzureissen.
Der Landvogt Niklaus Willading zu Aarwangen schrieb am
21. März nach Bern, dass das Schloss von Aufrührerischen belagert sei,
die das Reisgeld verlangten. Nach dessen Bericht waren es vor allem
wieder Melchnauer.» «Sy sind Sinnes», schreibt Willading, «disen Abend
den Sturm ergehen zelassen, Gott wolle uns beistehen... Es hilfft da
weder remonstrieren noch anders, sy sind so tholl als das unvernünftige
Viehs.» Und eine Einzelheit dieses Schreibens enthüllt auch hier
die innige Verbindung der Berner mit der Luzerner Bewegung: «Es ist
bey unseren Belägereren ein Lutzerner angelanget, wellicher allhier im
Wirtshauss ihnen öffentlich zu den Melchnaweren geredt, dass namlich,
wann sy sich nur erleütteren werden oder einen Sturmstreich
thättend; ihnen straks 5000 Mann (d. h. Luzerner Bauern) in Bereitschafft
sollten stehen undt in Ewer Gn. Gebiet anziehen.» Das war am
gleichen Tag, an dem die ganze Grafschaft Lenzburg zu den Waffen
griff. Auch in Aarburg und! im ganzen unteren Aargau, sowie im Amt
Bipp war Alles in hellem Aufruhr. Auch das Amt Steffisburg kam in
Bewegung und hielt eine Landsgemeinde ab, die Beschwerdeartikel
aufsetzte.
«So war», sagt Kasser, der Geschichtschreiber des Amts Aarwangen,
«überall der Bann gebrochen, welcher die Untertanen sonst davon
abhielt, sich dem Repräsentanten der Regierung offen zu widersetzen.»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 190 - arpa Themen Projekte
X.
«Je mehr man taget, je mehr es nachtet...»
Eidgenössisches Zwischenspiel:
Erstes Stück
Noch fehlte dem Zusammenspiel der katholischen Luzerner Bauern
einerseits und der protestantischen Berner Bauern andererseits die
eidgenössische Plattform, auf der die entfesselten revolutionären Kräfte
zu einem Ganzen zusammenwachsen und zur Landesgeschichte werden
konnten. In den fünf Sitzungstagen der Tagsatzung der XIII alten Orte
vom achtzehnten bis und mit zweiundzwanzigsten März 1653 ist es der
Herrenklasse der Schweiz mit vereinten Kräften gelungen, diese Plattform
für eine gemeineidgenössische Volkserhebung zu schaffen.
Zwar hat sich in unmittelbarer Auswirkung der Beschlüsse dieser
Tagsatzung —und dies innert wenigen Tagen —die Bauernklasse von
nur zwei weiteren Kantonen zum bewaffneten Aufruhr erhoben und ist
offen an die Seite der Luzerner und der Berner Bauern getreten: die
katholischen Solothurner Bauern und die protestantischen Basler Bauern.
Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass die gesamte übrige
Bauernsame der Schweiz durch die mittelbaren Folgen dieser Tagsatzung
erst überhaupt zum —naturgemäss langsamen —Aufwachen
aus einem Jahrhundert der Entrechtung, Entmachtung und Einschläferung
gebracht wurde und dass sie nach Verlauf von zwei Monaten
im Begriffe war, sich wieder zum Bewusstsein ihrer geschichtlichen
Aufgabe als Gründerklasse der Eidgenossenschaft zu erheben: als der
Blitz der militärischen Niederlage nicht nur die Bauern der vier
Pionierkantone niederwarf, sondern die Bauernklasse der ganzen
Schweiz für immer aus dem Rang einer geschichtemachenden Klasse
hinauswarf.
So werden wir uns in der Folge darauf beschränken müssen, denjenigen
unmittelbaren Auswirkungen des eidgenössischen Zwischennachzuspüren,
die noch zu geschichtlichen Taten der schweizerischen
Bauernklasse als solcher zu führen vermochten. Dazu aber ist
es unerlässlich, das Zwischenspiel selbst vorzuführen, wenn auch
keineswegs in seinem äusseren Verlauf, vielmehr nur in seiner Substanz:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 191 - arpa Themen Projekte
seiner Beschlüsse.
Was den Verlauf dieser Herren-Tagsatzung —auf der sich keine
einzige Stimme für die Bauern erhob — betrifft, so ist nur die Tatsache
bemerkenswert, dass eigentlich zwei Tagsatzungen ständig neben-
und durcheinander liefen: die offizielle, auf der beide Konfessionen mit
demselben, wenn auch nicht gleich hoch entwickelten, Herreninteresse
gleichberechtigt zusammenwirkten, und eine inoffizielle, auf der, unter
beständig wachsendem Druck des mächtig rüstenden Herrenstaates
Bern, die evangelischen Stände Bern, Zürich und Basel eine geschichtliche
Vormachtstellung der gesamtschweizerischen Aristokratie, natürlich
unter ihrer Führung, herauszubilden suchten. Was die Katholiken
besonders der Landsgemeinde-Kantone, mit Ausnahme der wenigen
schon vollaristokratisch entwickelten Potentaten à la Zwyer, naturgemäss
mit scheelen Augen ansahen; sodass hierin eine, wenn auch
einstweilen durch die gemeinsamen Herreninteressen überdeckte, Wurzel
des drei Jahre später ausbrechenden Religionskriegs erblickt werden
muss.
Schon vor Beginn der Tagsatzung hatten sich die Gesandten der
evangelischen Stände Rendez-vous in Baden gegeben und ein gemeinsames
Vorgehen in die Wege geleitet. Aber auch von Rat zu Rat direkt
verhandelten besonders Bern und Zürich höchst intensiv während der
Tagung. Am 19. März schrieb der Berner Rat an den von Zürich: die bernischen
Untertanen hätten «bei unss aus Anlass der bereits feindtlich
wider ihre Oberkeit der Stadt Luzern aufgestandnen unguten Rotten
auch angefangen, an den Pässen Verbaue anzelegen und etliche veste
Häuser zu bedrohen und ganz gefehrlich hin und her zu tendieren und
sich den Lucernischen gantz gleich zu stellen». Er lasse daher jetzt
noch mehr Truppen in all den früher genannten Orten aufbieten. «Da
wir», so schliesst der Mahnbrief Berns an Zürich, «nächst Gott unsern
Religionsgenossen (!) zu Zürich am meisten vertrauen, so ersuchen und
ermahnen und bitten wir euch, dass ihr, kraft der Bünde, eure Hilfe
alsbald zu wirklichem Anzug und zu kreftiger Zusammenstossung' mit
der uns von Gott bescherten Macht auf- und anmahnen wollet»!
Am 20. März, «um Mitternacht», antwortete der Zürcher Rat: er
habe zwar «etliche Kompagnien zusammengezogen, die sich auf fernere
Anmahnung von den Ehrengesandten der sämtlichen evangelischen (!)
Orte, so sich in Baden befindend und denen man die fernere Deliberation
einfelltig überlassen zu stündlichem Auffbruch» bereit hielten.
Jedoch ersuche der Zürcher Rat die Berner Regierung, «über die gwalt
die Geduld sanfmütig zu halten, und dem gwalt die Güte vorzeziehen»!
Der Zürcher Rat hatte eben die aufreizende Wirkung der Rüstungen
der Berner Herren auf deren Untertanen bereits bemerkt und hatte,
gerade um als Vorort der Eidgenossenschaft sich den Herreninteressen
auf eidgenössischem Boden umso ungeschwächter widmen zu können,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 192 - arpa Themen Projekte
Sebastian Bilgerim Zwyer
Urner Oberst und Landammann,
kaiserlicher Feldmarschall-Lieutenant und erster Agent des
Kaisers in der Eidgenossenschaft,
General der innerschweizerischen Truppen in der von der
Tagsatzung gegen die Bauern aufgebotenen eidgenössischen
Herren-Armee,
"Vermittler' zwischen den Luzerner Herren und den Luzerner
Bauern in Werthenstein und Ruswil.
Nach einem zeitgenössischen Originalstich von Johann Schwyzer
in der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek in Zürich.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 192 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 193 - arpa Themen Projekte
fortwährend das allergrösste Interesse daran, bei seinen eigenen Untertanen
nicht durch forschen Auszug dieselbe Wirkung hervorzurufen.
In der Angst vor den Folgen eines brutalen Losschlagens der Berner
Herren befahl darum der Zürcher Rat den in Baden auf der Tagsatzung
weilenden Zürcher Gesandten, mit den andern evangelischen (!)
Orten zusammen eine «eilfertige gemeinsame Absendung nach Bern»
ins Werk zu setzen. Diese Gesandtschaft solle — sagt dieselbe Regierung,
die sieben Jahre früher sieben «Rädelsführer» aus dem Wädenswiler
Aufstand grausam hatte hinrichten lassen — «auf jeden Fall dafür
eintreten, dass die (Berner) Regierung die Rädelsführer nicht am
Leben strafe, sondern, wenn möglich, eine allgemeine Amnestie erteile».
Man kann sich leicht denken, wie die Berner Herren mit den Zähnen
knirschten, als ihnen die Zürcher «Religionsgenossen» bei der Ausübung
des von diesen auf ihrem Gebiet selbst beanspruchten Herrenrechtes
in den Arm fielen... Dies umso mehr, als die andern evangelischen
Gesandten in Baden dem Zürcher Rat «einhellig» zustimmten.
Trotz alledem aber versprachen die in Baden anwesenden Zürcher
Gesandten, der Bürgermeister Johann Heinrich Waser und der Seckelmeister
und Reichsvogt Johann Konrad Werdmüller, den dort anwesenden
Berner Gesandten, dem Schultheiss und Führer der bernischen
Kriegspartei Anton von Graffenried und dem Venner Vincenz Wagner
—in einigem Widerspruch zu der Instruktion des Zürcher Rates —,
«für die Entsendung eines starken Korps ,mit genugsamen und besten
Offizieren' zum Schutze Berns einzutreten». Denn sowohl Waser wie
Werdmüller waren ausgesprochene aristokratische Scharfmacher; nur
dass besonders Waser sich dabei gern die «Friedensstifter»-Rolle als
Tarnung verband. «Da aber die Befürchtung laut wurde, es möchte auch
unter den Zürcher Bauern gären», wie G. J. Peter berichtet, und zwar
angeblich nur «wegen des Salzes und da die Entlebucher ir Gifft schon
weit herum spargiert», einigte man sich auf einen Vorschlag an die
Räte der evangelischen (!) Orte, sie möchten «gewordene Völker zusammenbringen»,
und zwar durch «gemeinsame Werbung von 5000
Mann, die man stündlich auf mahnen könnte», für den Fall, dass «auf
die einheimischen Landleute wenig Verlass wäre, damit die Bewegung
in der ,Extremität' mit Waffengewalt unterdrückt werden könnte»! Das
wirft ein krasses Licht auf die fromme Entrüstung der Herren über
die angeblich «lügnerischen» oder «verleumderischen» Behauptungen
der Bauern, man wolle sie mit «fremden Truppen» überziehen...
«Sicher ist», sagt Peter, «dass einzelne Regierungen fremde Söldner
teils anwerben wollten, teils wirklich anwarben; Luzern allerdings
wandte sich um Unterstützung an den Statthalter von Mailand.» Denn
Luzern traute als erzkatholischer Stand diesem Kriegstreiben der evangelischen
Stände unter sich, obwohl es ursprünglich zu seinen Gunsten
in Szene gesetzt worden war, in keiner Weise.
Dennoch ist der Geist der Herren-Tagsatzung in Baden überhaupt,
nicht nur der der evangelischen Sondertagsatzung, ein Geist der rücksichtlosen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 194 - arpa Themen Projekte
allen Kantonen, ob katholisch oder evangelisch, ob Landsgemeindekanton
oder Stadtkanton; ein Geist, der der Aufrechterhaltung und Erweiterung
der Klassenprivilegien einer winzigen aristokratischen Minderheit
das Recht und das elementarste Lebensinteresse der erdrückenden
Mehrheit des eigenen Volkes bedenkenlos bis zum Landesverrat
opferte. Derselbe Geist ist es, der die kriegerischen Badener Beschlüsse
und das verleumderische Badener Mandat gegen die Bauern hervorbrachte,
die nun Ströme Oels ins Feuer gossen.
Zuerst wurde das «Defensional» beraten und beschlossen. «Man
setzte vor allem aus fest», sagt Peter, «dass, falls wieder ein Ort bedrängt
werde, die übrigen Hilfe leisten sollten, ohne zu untersuchen,
wer Recht oder Unrecht habe.» Oder, wie man sich damals im Original
ausdrückte: «ohne Difficultierung und Auf-die-Bahn-Bringung, wer
Recht oder Unrecht habe». Drei grosse Herren-Armeen, richtige Bürgerkriegs-Heere,
wurden durch dieses «Defensional» aufgestellt, und
zwar jetzt durchaus in erster Linie zum Zweck der Niederschlagung
des Berner Bauernaufstandes, aber zugleich als Präventivmassnahme
gegen eine mögliche allgemein-schweizerische Volkserhebung. Die erste
Armee, unter einem Zürcher Oberkommandanten — vorgesehen und
später ernannt wurde der Seckelmeister Johann Konrad Werdmüller
—mit der «Gegend von Lenzburg Alsa Rendez-vous-Platz», sollte etwa
6000 Mann umfassen: 1500 Mann zu Fuss und 200 Reiter, sowie Artillerie,
von Zürich; 400 von Glarus; 700 von beiden Appenzell; 200 aus
der Stadt St. Gallen; 2000 Bündner, «1000 in Pündtens eigenen kosten
und 1000 geworben in kosten Berns»; «Schaffhausen sollte sich mit
350 Mann nach Brugg legen; die Stadt Basel mit dem Zuzug von Mülhausen,
im ganzen 500 Mann zu Fuss und 50 Reiter, nach Olten werfen»;
diese Kontingente hatten also die wichtigsten Uebergänge an der
untern Aare zu besetzen. Die zweite Armee, unter einem Berner Oberkommandanten,
bestand aus sämtlichen Streitkräften Bern Freiburgs
und Solothurns, sowie ihrer Verbündeten in der Westschweiz; kurz, es
war die bereits mobilisierte und in Bern konzentrierte Armee unter dem
Oberbefehl des Generals Sigmund von Erlach; sie umfasste, mit allen
uns bereits bekannten, sowie mit den jetzt eben neu aufgebotenen
Truppenteilen, mindestens 5000, vielleicht aber ebenfalls an die 6000
Mann. Die dritte Armee, die «Baden an der Limmat und die beiden
Reuss-Städtchen Mellin gen und Bremgarten zu besetzen» hatte, war die
kleinste; sie umfasste keine 1000 Mann: je 100 Mann aus den IV alten
Orten, 200 aus den «ennetbirgischen Vogteien», dann den Zuzug des
Abtes von St. Gallen, «eine genügende Anzahl», und ihr Oberbefehl war
Uri, das heisst natürlich dem General Zwyer von Evibach, vorbehalten.
Der Zürcher Bürgermeister Johann Heinrich Waser —und mit
ihm sämtliche «Abgeordneten der protestantischen Orte» .— zeigten
sich, wie Peter schreibt, in einem Bericht vom 22. März früh «äusserst
erfreut» über den «guten Willen», den «die katholischen Orte unter
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 195 - arpa Themen Projekte
für das Zustandekommen eines gemeinsamen Feldzugs an den Tag
legten»! Wasers Sekretär in Baden, der Zürcher Ratssubstitut Andreas
Schmid, schrieb am 21. an den Zürcher Rat: «Gleich wie nun Gott aus
Bösem Gutes erwählen kann, also scheint es, dass auch bei diesem bösen
Anlass die wegen der Religion zwiespältigen eidgenössischen Parteien
vielleicht in gute Freundschaft und Vertraulichkeit geraten möchten.
Gott gebe es mit Gnaden»! Wie er den Herren «mit Gnaden» die militärische
Uebermacht gab...
Wir glauben, den Grund dieser Freude des ganz besonders klassenstolzen
Zürcher Bürgermeisters klar zu erkennen: das «Vaterland»
seiner Klasse, die Einheit der durch alle XIII Orte der Eidgenossenschaft
ohne Ansehen ihrer Religion durchgehenden Aristokratenschicht,
schien zum erstenmal geschichtlich dauerhafte Gestalt annehmen zu
wollen. Das und nichts anderes war auch das «echt vaterländische
Denken» des Generals, österreichischen Feldmarschalls und ersten
Agenten des Kaisers in der Schweiz, des katholischen Landsgemeinde«
«Demokraten» Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach, das diesen auch
zum «innigen Freund» des —ebenfalls in Baden anwesenden —Basler
Bürgermeisters, des herrschsüchtigen und mindestens im selben Grade
wie Waser glaubensstolz protestantischen Emporkömmlings Johann
Rudolf Wettstein machte. Dass der «gemeinsame Feldzug», über dessen
Zustandekommen sich alle diese Herren so ungemein freuten, gegen
das Vaterland des Schweizer Bauern, gegen den letzten Ueberrest seines
ureigentlichen Werkes, gegen die echte, alte, ur-demokratische Eidgenossenschaft
ging —das war allen diesen Herren Nebensache! Ja, mehr
noch: die endgültige Niederwerfung dieser Eidgenossenschaft war
ihr wahres geschichtliches Ziel, und musste es sein, wenn sie das Vaterland
ihrer Klasse wollten!
Freilich, auch schon damals in Baden hatte die scheinbare Verwirklichung
des Traumes der Herren Waser, Wettstein und Zwyer
einen argen Schönheitsfehler: die katholischen Orte Schwyz, Unterwalden
und Freiburg nahmen den geschichtlichen Akt, in dem dieser
Traum verkörpert war, das «Defensionale», nicht an, wenn sie es auch
andererseits nicht ablehnten; ihre Gesandten erklärten, «in das Defensionalwerk
nicht einwilligen» zu können, weil sie von ihren Oberen
«keinen Befehl» dazu erhalten hätten; sie nahmen den Beschluss nur
ad referendum. Vom katholischen Zug war überhaupt kein Vertreter
auf die Tagsatzung delegiert worden. Sowohl das Verhalten Zugs wie
dasjenige der vorerwähnten drei Stände wurde schon damals wie auch
heute noch durch das Misstrauen und die Eifersucht dieser katholischen
Stände auf die — eben infolge der kriegerischen Anstalten —
wachsende Uebermacht der evangelischen Orte motiviert. Das hat, wie
wir bereits erkannten, bestimmt mitgewirkt; denn das entsprach der
zurückgebliebeneren Stufe der Herren dieser Stände in der Entwicklung
zum Absolutismus, und auf dieser Stufe fiel das aus den Reformationskämpfen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 196 - arpa Themen Projekte
aber von jeher sehr reale politische und wirtschaftliche Interessen versteckten)
noch stärker ins Gewicht.
Jedoch ist wohl zweifellos bei drei von diesen vier katholischen
Ständen, und zwar bei den Bauernkantonen Schwyz, Unterwalden und
Zug, das wahre Motiv ihrer Zurückhaltung gegenüber den Unterdrückungsplänen
des Defensionale der Rest der urschweizerischen
Bauerndemokratie, der in ihnen selbst noch inkorporiert war, und infolgedessen
('in gewisses Mass von Sympathie für die aufständischen
Bauern, die eben für die Wiederherstellung dieser schweizerischen Urdemokratie
sich erhoben hatten! Und zwar handelte es sich in den Urkantonen
—mit Ausnahme von Uri, wo der grossmächtige Herr Zwyer
mit seinem Anhang vollkommen dominierte — um ein solches Mass
von Sympathie, dass es hinreichte, um auch in massgebenden Kreisen
der Standesführung noch zum Ausdruck zu kommen. Dies ist völlig gewiss
im Fall Zug, wo wir den Beweis in Peter Trinklers Verhalten und
in der Abkanzelung desselben durch die Tagsatzung besitzen. Aber auch
Schwyzer und Unterwaldner Truppen hatten bereits beim Zuzug für
die Luzerner Herren, wie wir sahen, zum Teil gemurrt und sogar gemeutert,
und das verschlimmerte sich bei dem späteren Generalauszug
gegen die Bauern in einem für die Herren ganz bedenklichen Masse.
Den Freiburger Herren aber mag die turbulente Meuterei der Greyerzer
Bauern, von denen sie keinen einzigen gegen die Entlebucher auszuheben
vermochten, nahegelegt haben, sich im Rampenlicht der Oeffentlichkeit
tot zu stellen um hinter den Kulissen die Sache ihrer Berner Standesgenossen
und damit ihre eigene, umso ungestörter fördern zu können.
Und nun ist überhaupt zu sagen, dass der Traum der Herren
Zwyer, Waser und Wettstein, das Defensionale zum Grundstein der
neuen absoluten Herren-Herrschaft in allen Kantonen ohne Ansehung
der Religion zu machen, der Traum einer blossen Elite des Absolutismus
hierzulande war, einer Elite, die nur aus diesen drei Herren, sowie
den scharfmacherischsten Berner Junkern bestand, die allerdings
geistig tief unter jenen Drei standen und ihrerseits eifersüchtig auf sie
waren. Wenn dieses Projekt, das auch heute noch von stramm «demokratischen»
Geschichtsschreibern als «erhaben eidgenössisch» gerühmt
und besonders Waser als «genial» gutgeschrieben wird, im Defensionale
der Badener Tagsatzung trotzdem für einen kurzen geschichtlichen
Augenblick den Schein von Fleisch und Blut annahm, so war
dies nur der ausserordentlichen, allen dort anwesenden eidgenössischen
Herren gemeinsamen Panik vor dem drohenden allgemeinen Volksaufstand
zu verdanken. Kaum waren die Bauern niedergeschlagen, gerieten
sich sogar die Zürcher und Berner Herren, trotz ihrer so oft beschworenen
«eid- und religionsgenössischen Wolmeinung», der blossen
Kosten halber gar jämmerlich in die Haare. Und drei Jahre später ging
an dem fanatischen und blutigen Villmerger «Religionskrieg» der Waser-Wettstein-Zwyer'sche
Plan einer einheitlichen, totalitären und absolutistischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 197 - arpa Themen Projekte
also aus alledem weder eine erneuerte Bauern-Eidgenossenschaft —die
ist von den Herren schon in der Wiege abgewürgt worden —, noch
eine vereinheitlichte Herren-Eidgenossenschaft hervor, vielmehr lediglich
ein jämmerliches Konglomerat von lauter Duodez-Fürstentümern,
in denen die Oligarchen der «regierungsfähigen Familien» abwechselnd
die Fürstenrolle spielten. Man kann eben aus lauter miteinander rivalisierenden
Absolutismen ebensowenig ein Staatsgebäude errichten, wie
man aus lauter Kugeln ein Haus bauen kann.
Was aber im zweiten «Hauptwerk» dieser Tagsatzung, im «Gemeinen
Mandat» oder «Proklamation der Tagsatzung zu Baden an das
Eidgenössische Volk» vom 22. Dezember hundertprozentig siegte, das
nicht nur die allgemeine Panik vor dem drohenden Volksaufstand, das
war vielmehr das wirkliche Herrschaftsinteresse sämtlicher Herrenregierungen
aller Kantone ohne Ansehen der Religion, d. h. also auch derjenigen
von Zug, Schwyz und Unterwalden, geschweige von Freiburg.
Dieses Mandat war ein spezieller Sieg der Berner Herren. Denn der
Schrecken vor dem gerade während der Tagsatzung aus dem vermeintlich
soeben «gestillten» Luzerner Aufstand wie eine wachsende Lawine
hervorbrechenden Berner Aufruhr war es ganz speziell, was über alle
konfessionellen Hindernisse hinweg schon dem am 21. März beschlossenen
«Defensionale» den für die damalige Zeit so erstaunlichen Umfang
gab. Dieser selbe Schrecken war es erst recht, was dem am 22.
März endgültig redigierten «Gemeinen Mandat» gegen die Bauern die
Zustimmung sämtlicher Herrenregierungen aller Kantone —auch der
Herren des abwesenden Zug —sicherte. Dieselbe Panik war es auch,
was diesem in der Geschichte der Eidgenossenschaft wohl einzigartigen
Ukas — dem allerdings die Schimpflawine des Luzerner Manifestes
vom 16. März zu Pate gestanden haben kann —für immer das Brandmal
einer wahrhaft hysterischen Klassenwut aufdrückte!
Dieses «Gemeine Mandat», das nach Ablauf der nächsten acht Tage
gedruckt in der ganzen Schweiz verbreitet wurde, schwärzt eingangs
zunächst den gottvergessenen Undank der Bauern dafür an. dass die
Eidgenossenschaft vor den Greueln des dreissigjährigen Kriegs bewahrt
worden sei, dass trotz «Krieg, Hunger, Brand, Mord, Raub, Weib- und
Kinderschänden und anderen, fast unzählbaren Martern und Plagen»,
unter denen andere Länder litten, «der grundgütige Gott unter so vielen
Königreichen, Landen und Herrschaften allein unseres geliebten
Vaterlandes verschont und dasselbige die ganze Zeit über, mit grosser
Verwunderung bald aller Welt, von dergleichen Uebeln gnädiglich bewahrt
hat». Statt, was das Volk betrifft, dafür nun «inniglich Lob und
Dank zu sagen und sich desto mehr eines gottseligen, christlichen und
friedliebenden Lebens zu befleissen» — z. B. à la Frisching und Tribolet!
—, «so haben doch unsere GH Herren und Oberen, dem gänzlich
entgegen, nicht ohne besondere Bestürzung ihres Gemüths, vernehmen
müssen, dass ein guter Teil ihrer Unterthanen dieses alles aus
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 198 - arpa Themen Projekte
Hintansetzung ihrer schuldigen Eidespflicht, Treue, Ehre und Glaubens,
wider ihre natürliche hohe Oberkeit auf gelehnt und empört, ja
sogar die Waffen wider sie ergriffen und allerhand hochsträfliche Fehler
und Muthwillen, wie öffentlich am Tag, unverantwortlich verübt und
begangen, ja sich noch dabei soweit erkühnt, auch anderer Oberkeiten
Unterthanen an sich zu ziehen und solche unter allerhand falschem
Schein und Vorwand auch zu dem Abfall von ihrer, von Gott vorgesetzten
Oberkeit zu bewegen» und durch «Aufwiegler und ihres gleichen
böse Buben es so weit durch getrieben, dass sie zu ihrem bösen
Vorhaben ziemlichen Beifall gefunden...»; «welches dann Unsere
allerseits GH Herren und Obern» bewogen hat, «auf allerhand Mittel
und Wege, auch erspriessliche Verfassungen und gute Ordnungen zu
denken, durch welche dergleichen theils boshafte, theils unbesonnene
und verirrte Leute wiederum auf den rechten Weg und zur Erkenntniss
ihrer schweren Sünden, Abfalls und Fehlers gebracht» werden sollen.
So kindisch «religiös»-moralistisch malte sich in diesen, was ihren
Vorteil betrifft, sonst höchst realistischen Herrengehirnen der ganze
ungeheure Knäuel von ökonomisch-politischen Problemen, die den damaligen
Bauer zum Aufstand trieben, dass nach diesem «Gemeinen Manifest»
«der vorgegangene Aufstand» lediglich «unter dem nichtigen
Prätext und Vorwand geschah, als wenn (!) ihnen und den ihrigen solche
Beschwerden, Neuerungen und Aufsätze unter oberkeitlichem
Namen zugefügt und aufgeladen wurden, dass sie ihres freien Herkommens
und darüber habender Briefe und Siegel gänzlich entsetzt und in
eine solche Dienstbarkeit nach und nach gebracht werden, die ihnen
und ihren Nachkommen ferneres zu erdulden ganz unleidlich falle,
welches alles doch nur aus einem recht bösen Vorsatz und Willen etlicher,
weniger, verdorbener, auch in Nöthen und Schulden steckender
Personen, die andere mit ihrem Gift unter vorberührtem Schein auch
an gesteckt haben... hergeflossen» sei!
Wenn noch etwas gefehlt hatte, um die Bauern von der unausweichlichen
Notwendigkeit zu überzeugen, mit diesen Herren einen
Kampf auf Leben und Tod auszufechten, um auch nur ihre Menschenwürde
vor deren Hochmut zu retten, der sie im Namen einer falschen
Eidgenossenschaft förmlich mit Verachtung bespie, dann waren es die
hochfahrenden Beleidigungen dieses Manifests der Tagsatzung!
In der Tat mobilisierten diese Beschimpfungen, sowie die darin
ausserdem ausgesprochenen Drohungen jeden auch nur anständig
denkenden Menschen, auch den bisher bedenklichsten und besonnensten
Bauern. Gegen jede Art von «Zusammenrottung» (also auch gegen
den Besuch von freien Landsgemeinden!), gegen «Empörung und Aufruhr»
wird «Leibes und Lebens Strafe» angedroht! Ferner ist jedermann
verpflichtet, der Spitzel der Obrigkeit zu sein: wenn «sie etwas
vermerken, hören oder vernehmen würden, dass dem oberkeitlichen
Stande Schimpf oder Nachteil geredet, gehandelt oder angezettelt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 199 - arpa Themen Projekte
Eide, zu leiden und anzuzeigen»! Wobei den Angebern von
«Oberkeits wegen hiemit zugesagt und versprochen» wird, «sie vor
aller Ungelegenheit, so ihnen dessnahen (dieserhalb) entstehen möchte,
gänzlich zu bewahren und schadlos zu halten...» Eine der abgefeimtesten
Despotie würdige Erziehung zum Spitzbubentum! Schliesslich ist
jedermann auch dazu verpflichtet, den Polizei büttel der Obrigkeit zu
spielen: wenn nämlich bei einer solchen «Rebellion» wie der jetzigen,
«so Gott gnädig abwenden wolle», die betreffenden Untertanen «von
allen übrigen Orten der Eidgenossenschaft gänzlich verrufen, alles Handels
und Wandels entsetzt» werden, so soll «Männiglich hiemit ernstlich
verwarnt» sein, «denen kein Gehör zu geben noch einigen Vorschub zu
thun, weniger sie zu behausen und zu beherbergen, sondern vielmehr,
da deren einer betreten würde, solchen anzuhalten und der Oberkeit
selbigen Orts namhaft zu machen...»! Die Erziehung zum fügsamen
Sklaven wird vollendet durch folgenden Schluss dieses wahrhaft «gemeinen»
Mandats: «Gleichwie nur die Gehorsamen sich des Beistands
und Segens Gottes wie auch des väterlichen Schutzes ihrer lieben Oberkeit
zu getrosten, also würden im Gegenteil die Ungehorsamen und Widerspenstigen
anderes nichts als den Zorn und Fluch Gottes, auch der
Oberkeit schwere Straf und Ungnade zu erwarten haben; darnach sich
Männiglich zu richten und vor Schaden zu bewahren wissen wird. —
Actum et Decretum Baden, den 12. (22.) März, nach der Geburt Christi,
unseres lieben Herrn und Heilands (!), gezählt 1653 Jahre.»
Da haben wir denn, zynisch offen ausgesprochen, den ganzen politischen
Zweck aller «Religion» der Herren! Sie ist nie etwas anderes
gewesen als, je nachdem, ein Betäubungsmittel oder eine Zuchtrute für
die Sklaven... Jetzt war sie für die Bauern wieder zur Zuchtrute geworden.
Die Gründe, warum die Bauern sich weder durch das erschreckende
«Defensionalwerk», noch durch die ungeheuerliche Strafpredigt
des «Gemeinen Mandats» der Herrentagsatzung einschüchtern
liessen, müssen wahrhaft elementare gewesen sein; Gründe, die die
Grundlage ihrer gesamten physischen und geistigen Existenz angingen.
Sehr verständnisvoll schreibt der alte konservative Basler Geschichtschreiber
des Bauernkriegs, Andreas Heusler: «Noch niemals war es
so bestimmt wie im badischen Mandat vom 12. (22.) März ausgesprochen
worden, dass die Einmischung des Bundes in kantonale Schwierigkeiten
unbedingt zu Gunsten der Obrigkeiten stattfinden solle, und
was war wohl natürlicher, als dass dieser drohenden Stellung der
Obrigkeiten gegenüber auch in den Unterthanen das über die konfessionelle
Scheidewand sich erhebende Bewusstsein eidgenössischer
Zusammengehörigkeit stärker hervortrat, dass auch sie sich zu Schutz
und Trutz verbanden?» Tatsache ist, dass es nun erst recht losging;
dass sowohl das «Denfensional», wie das «Mandat» zum förmlichen
Signal wurden für einen allgemeinen Zusammenschluss und zu einem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 200 - arpa Themen Projekte
der Religion oder der Kantonsgrenzen.
Wir haben bereits gesehen, wie dieser wahrhaft «aufrührerische»
Same, den die Tagsatzung in ihrem blinden Rasen über die ganze
Schweiz warf, im Luzernischen in den tiefst aufgepflügten Boden fiel;
tief aufgepflügt durch Zorn und Scham über die Niederlage, die Herr
Zwyer den Bauern als eidgenössischer «Ehrengesandter» in solch niederträchtiger
Weise zugefügt hatte. Wir haben bereits miterlebt, wie
überwältigend rasch dort dieser Same ins Kraut schoss: wie Hans Emmenegger
und Johann Jakob Müller nach dem hinterlistigen Schlag
des «Rechtlichen Spruchs» wie unter den Peitschenhieben des Tagsatzungsverrufs
aus der Niederlage sofort den tapferen Schluss zogen:
ein viel grösserer, viel stärkerer, die ganze Bauernklasse der Schweiz
umfassender Bund muss errichtet werden. Und wir sahen die Boten
des neuen, werdenden Bundes, die Entlebucher und die Willisauer,
unverzüglich durchs ganze Land und über alle Landesgrenzen in die
andern «Länder» eilen, um die Botschaft vom neuen Bund ins Emmental,
in den Oberaargau, ins Lenzburgische, nach Olten ins Solothurnische
und ins Baselland zu tragen. Ja, wir sahen, dass Johann Jakob
Müller am 26. März sogar vom Rat von Unterwalden, der doch dem
Badener Mandat auf der Tagsatzung zugestimmt hatte, als offizieller
Gesandter des Landes Entlebuch empfangen wurde, «um namens der
10 Aemter gegen die ehrverletzlichen Reden zu protestieren, die gegen
sie (im «Rechtlichen Spruch» wie im «Badener Mandat») geführt
wurden»!
Jetzt fiel der «aufrührerische» Same der Herrentagsatzung auch in
das durch die Langnauer Bauerntagsatzung erst eben frisch aufgebrochene
Erdreich des Berner Aufruhrs —und dies zwar ganz gleichzeitig
mit der grossen Botschaft der Entlebucher vom neu zu stiftenden, allesumfassenden
Bund! Kein Wunder, dass der Keim dieses Bundes auf
dem frisch gepflügten und noch unverbrauchten Boden besonders tief
Wurzel fasste und dass der eidgenössische Freiheitsbaum, der nun für
kurze Zeit im Leben des Schweizervolkes aufgerichtet wurde, einen
bernischen Namen bekam.
Ueber das Werk der Tagsatzung aber, die in Herrenstiefeln derart
blind über die edelsten Wachstumskräfte des eigenen Volkes hinwegstampfte,
kann füglich als Motto gesetzt werden, was schon zwei Menschenalter
vor dieser Zeit der solothurnische Staatsschreiber Hans
Jakob vom Staal seufzend ins Tagebuch schrieb:
«Je mehr man taget, je mehr es nachtet,
Das hab' ich oft mit Schmerzen betrachtet.»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 201 - arpa Themen Projekte
XI.
Die Erniedrigten und Beleidigten
1.
Die Berner Bauern finden den Leuenberger — aber müssen mit ihm
durchs Joch!
Es war, wie wir sahen, schon am 21.-22. März, fiel also gerade mit
den Beschlüssen des «Defensionals» und des «Gemeinen Mandats» der
Tagsatzung zusammen, dass eine geheime Sitzung von Ausschüssen
der zehn luzernischen Aemter den Zwyer'schen Spruchbrief als «gefälschtes
Machwerk» verwarf, ja für den darin soeben zum todeswürdigen
Hochverrat erklärten Wolhuserbund «geradezu staatsrechtliche
Gültigkeit unter Garantie der vermittelnden Orte» verlangte, wie der
Zürcher Historiker Peter sich ausdrückt. Die Zehn Aemter stützten sich
dabei auf die Tatsache, dass die Ungültigerklärung des Wolhuserbundes
«zu Kriens gar nicht eröffnet worden sei», was u. a. der Weibel von
Escholzmatt, Leodegar Theiler, bezeugte, der alle «verkündigten
Punkte» an Ort und Stelle auf ein Schreibtäfelchen notiert hatte.
Der venezianische Gesandte in Zürich berichtete über dasselbe
Ereignis an seine Regierung: die Luzerner Bauern erhoben «schon zwei
Tage nachher» (nach dem Zwyer'schen Theatercoup auf dem Krienserfelde)
den Anspruch, «dass der Vertrag nicht einer Unterwerfung
unter die Obrigkeit, sondern lediglich einem Bündnis zwischen beiden
Teilen gleichkommen solle». Das war die richtige Deutung des Unabhängigkeitsstrebens
der Entlebucher seitens des Auslands.
Es war ebenfalls noch in den Zwanziger Tagen des März, als die
Willisauer kühn über dieses «gefälschte Machwerk» hinwegschritten,
«indem sie Schultheiss, Stadtschreiber, Gross- und Kleinweibel und
Läufer entsetzten und an deren Stelle neue Beamten wählten», sowie
«einige Ratsherren, die der Obrigkeit treu bleiben wollten», aus dem
Rate ausstiessen.
Kurzum: aus diesen und manchen andern, ähnlichen Symptomen
spricht die klar hervortretende «Tendenz der Luzerner Bauern, sich
wenn möglich vom städtischen Regiment loszumachen». Schon dies
zwang sie folgerichtig dazu, die Stützpunkte bei den gleichgesinnten
Bauern anderer Kantone nun eiligst zu einem neuen, umfassenden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 202 - arpa Themen Projekte
der aristokratischen Herrenherrschaft überhaupt aussichtsreich
zu machen.
So weit waren die Berner Bauern noch nicht, als sie am 24. März
im Wirtshaus zu Trachselwald, direkt zu Füssen des hoch über der
weiten Landschaft thronenden Schlosses des Landvogts Tribolet, zum
erstenmal von allen wichtigsten Gemeinden des Landes offen gewählte
Ausschüsse zur Beratung des weiteren Vorgehens vereinigten. Immerhin
bedeutet schon die Tatsache des so rasch nach der Langnauer
Landsgemeinde erzielten Zustandekommens dieses ersten Berner Bauernparlamentes
einen mächtigen Schritt vorwärts in der Organisation
der ganzen Bewegung.
Zweifellos war diese Versammlung die Frucht der Arbeit, die auf
der Langnauer Landsgemeinde vom 14. März bis zum 19. März geleistet
worden war, mithin wesentlich das Werk Uli Gallis, obwohl er
selbst in Trachselwald nicht in Erscheinung tritt. Dieser ganz gewiss
ausserordentliche Mann hat seinen Ehrgeiz überhaupt nie im persönlichen
Hervortreten, das er neidlos anderen überliess, vielmehr in der
zähen Bemühung erblickt, die schwerflüssige Masse der Berner Bauern
von Grund auf in Bewegung zu bringen und mit einem festen organisatorischen
Willen zu durchsetzen. Er war die geheime Seele der ganzen
Berner Bauernbewegung, ein Wille, dessen echt revolutionäre Zähigkeit
bis zuletzt hinter allen ihren Vorstössen steckt, sich jedoch
gegen die besonders schwer lastenden Kräfte der Beharrung nie völlig
durchzusetzen vermochte.
Die Versammlung in Trachselwald aber war keine Versammlung
von Revolutionären. Die zahlreichen Ausschüsse aus allen Landesteilen,
nicht nur aus dem Emmental, waren zwar von den Flügeln der
Empörung zusammengetragen, weil nach den horrenden Rüstungen
der Berner Herren und der Tagsatzung alles, was Bauer war, begriff,
dass man nun zusammentreten und beratschlagen müsse, was zu tun
sei. Aber gerade weil es seit Menschengedenken zum erstenmal selbständig
gewählte Ausschüsse waren, konnte in ihnen keine klare Willensbildung
zum Ausdruck gelangen. Es war der noch ganz führungslose
Durchschnitt der Berner Bauern. Auch sie waren übrigens sehr
fromm, genau wie die Entlebucher, nur auf ihre nüchternere protestantische,
bezw. sektiererische Art: sie «eröffneten und schlossen ihre
Beratungen mit einem Gebete zu Gott», berichtet Vock nach dem Tagebuch
des Zürcher Bürgermeisters Waser, der daran sein Wohlgefallen
gehabt haben muss.
Der kühnste Beschluss dieser Versammlung erschöpft sich in einem
«Gesuch an die Regierung, worin sie die Bezeichnung eines Ortes auf
dem Lande, statt der Hauptstadt, zur Besprechung mit Abgeordneten
des Rats verlangte, gleichviel ob Burgdorf, Thun, Worb oder Höchstetten».
Unter den Unterzeichnern dieses in der Form noch überaus
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 203 - arpa Themen Projekte
und Gerichten Trachselwald, Sumiswald, Ranflüh, Trub, Schangnau,
Steffisburg, Dürrenroth, Affoltern, Lützelflüh, Langenthal und
aus den Aemtern Aarburg und Aarwangen, z. B. Madiswil; womit aber
der Kreis der Teilnehmer bei weitem nicht erschöpft ist. Aber schon
diese Unterschriften zeigen, dass die Versammlung «nicht nur eine
emmenthalische, sondern eine allgemein bernische war».
Dass die vier grossen Landgerichts Konolfingen, Seftiger, Sternenberg
und Zollikofen nicht vertreten waren, ist einzig auf den Umstand
zurückzuführen, dass diese ihre Ausschüsse eben auf den folgenden
Tag, den 25., zu einem Parallelparlament nach Konolfingen aufgeboten
hatten. Immerhin vermissen wir in Trachselwald noch so wichtige Landesteile
wie das Oberland und das Simmental, die von Anfang an starken
Anteil an der Bewegung nahmen, aber erst später sich offiziell beteiligten.
Jedoch fallen gerade in die Tage um die Trachselwalder Versammlung
bedeutende Unruhen im Oberland, in Interlaken, Aeschi
und Frutigen, sodass die revolutionären Kräfte dort zu dieser Zeit
ohnehin beschäftigt waren. Ferner fehlen in Trachselwald auch die
rechtlich besser gestellten Landschaften Hasli und Saanen, obschon sie
die ersten waren, die sich, wenigstens der Münzkalamität und des Salzhandels
wegen, bewegt hatten; sie verschwinden aber von da ab überhaupt
aus der Bauernbewegung. Schliesslich fehlt in Trachselwald
auch das Seeland, das erst später einen wenigstens teilweisen und in
einzelnen Beteiligten sogar leidenschaftlichen Anteil nimmt.
Geschichtlichen Rang aber erhielt die Trachselwalder Bauerntagsatzung
durch einen Umstand, der erst für uns Rückblickende kapitale
Bedeutung gewinnt: durch die Teilnahme und das erste öffentliche Auftreten
Niklaus Leuenbergers, des späteren allmächtigen Obmanns des
grossen Bauernbundes und —im Guten wie im Schlimmen —entscheidenden
Führers im ganzen Bauernkrieg. Und zwar geschah dies in
einer Szene, die ihn sofort in dramatischer Weise in Gegensatz zur
obersten Staatsautorität brachte und die ihm seitens dieser noch im
Todesurteil ausdrücklich als erstes und grundlegendes Vergehen angekreidet
wurde.
Platzte da mitten in die allem Anschein nach sehr friedlichen Verhandlungen
über die «Beschwerdepunkte, um deren Abhilfe sie die
Regierung ersuchen wollten», zu aller Erstaunen niemand Geringeres
als Samuel Tribolet, der Landvogt von Trachselwald, in Person! Er hatte
sich offenbar eine Ueberrumpelung echt junkerlichen Stils ausgedacht
und sich von deren Gelingen einen mächtigen Stein im Brett bei den
Herren in Bern versprochen. Das Gewitter gegen ihn, das sich dort
schon lange vorbereitete, wäre vielleicht versprengt und er selber gar
auf den heissbegehrten Schultheissenthron erhoben worden!
Denn es handelte sich um nichts Geringeres als darum, die ganze
werdende Berner Revolution, um deretwillen schon die gesamte bewaffnete
Macht Berns und zum guten Teil bereits auch die der Tagsatzung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 204 - arpa Themen Projekte
köpfen! Hier, unter den Ausgeschossenen so vieler Gemeinden und Gerichte,
mussten ja so ziemlich sämtliche Rädelsführer sitzen, die ihm
und den Herren in Bern das Regieren bisher auf so ungreifbar heimliche
Weise sauer gemacht hatten und die zugleich auch diejenigen
sein mussten, aus deren ständig auf Umwegen nach Bern getragenen
Klagen das Gewitter dort sich immer drohender gegen ihn persönlich
zusammenzog. Sollte er den Herren als Blitzableiter für den Zorn der
Bauern dienen? Wer das dachte, der kannte Samuel schlecht. Umgekehrt:
er wollte den vollen Zorn der Herren, den diese seiner Meinung
nach immer noch nicht prompt genug an den Bauern auszulassen wagten,
mit eigener Hand auf deren Köpfe schleudern. Und so trat er mit
dem Mut des Verzweifelten, der alles zu riskieren oder alles zu gewinnen
wagt, mitten unter sie —und forderte die Köpfe der Rädelsführer!
Tatsächlich wird berichtet: er «las ihnen ein oberkeitliches Schreiben
vor, worin die Bauern zur Auslieferung der Rädelsführer und Unruhestifter
aufgefordert» wurden. Und was das nach bernischem Recht bedeutete,
wusste ein jeder. Um diesen Preis versprach er ihnen, «dass
wenn sie alsdann gegründete Beschwerden in gebührender Ehrerbietung
zur Kenntnis der Regierung bringen, diese die Klagen streng untersuchen
und alle billigen Wünsche befriedigen werde» .
Samuel Tribolet musste dabei seine Hoffnung naturgemäss auf die
Mehrheit setzen und er tat das bei dieser Versammlung tatsächlich
nicht ohne Grund: denn selbst wenn sämtliche bisherigen Rädelsführer
hier mit zu Rate sassen, die Mehrheit konnten sie in diesem Stadium
der Dinge und bei dem Zustandekommen der Versammlung —durch
Wahl der gewöhnlichen Gemeinden, nicht durch revolutionäre Komitees
— gar noch nicht sein. Und tatsächlich liess sich die grosse
Mehrheit durch das forsche Auftreten des gefürchteten Samuel zunächst
tüchtig einschüchtern; denn es wird berichtet: «Die Landesausgeschossenen
schienen bereits sich sämtlich (gerade «sämtliche» werden
es nicht gewesen sein!) dahin zu neigen, dass man dem Ansuchen
der Regierung entsprechen solle.»
In diesem Augenblick, als eben abgestimmt werden sollte, erhob
sich ein kräftiger, schön gewachsener Bauer von achtunddreissig Jahren,
mit breitem, eckigem Bart und in wallendem Haupthaar, mit langer,
gerader und festgefügter Nase unter einer hohen, denkerisch
durchfurchten Stirn und mit zwar nicht übergrossen. aber seltsam
bohrenden, fast melancholisch grübelnden Augen. Was sollte das? Der
war ja Tribolet sehr gut bekannt: das war doch der Klaus Leuenberger,
der sehr wohlhabende Bauer vom Schönholz in der Kilchhöri Rüderswil?
Hatte der nicht mehr als einmal mit ihm, Tribolet, zusammen
als Geschworener im Gericht zu Ranflüh gesessen, und ebenso bereits
vor zehn Jahren mit dem andern Samuel, dem Frisching? War das
nicht der hochangesehene, gerechte Waisenvogt, dessen Rechnungen,
immer bis zum letzten Batzen stimmten? (Was Tribolet von den seinen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 205 - arpa Themen Projekte
Vogt so mancher Witwen und Waisen, der unbestechliche Verwalter
ihres Vermögens und ihr unparteiischer Fürsprecher vor Gericht? Er
hatte dabei selbst eine ausgedehnte Familie, für die er, als ältestes von
11 Geschwistern (von denen allerdings vier im Kindesalter starben),
aufopfernd sorgte, nachdem sein Vater Hans Leuenberger und die Mutter
Elsbeth, geborene Moser, ebenfalls von Schönholz, bereits 1638 gestorben
waren. Für seinen jüngsten, 17 jährigen Bruder z. 13. verwaltete
er noch jetzt ein Vermögen von 2500 Pfund, d. h. etwa 15,000 Goldfranken;
für seine jüngste Schwester Verena ungefähr ebensoviel. Ungefähr
dasselbe wird auch er geerbt haben. Er selbst war verheiratet
und hatte Kinder (wieviele wissen wir nicht) und war «im vollen, freien
Besitz» eines schönen Bauernhofes in Schönholz. All das war Samuel
Tribolet von so manchem Zusammensein mit Leuenberger bei einer
Gerichtssitzung oder ähnlichen amtlichen Gelegenheiten genau bekannt.
Kurz und gut, dieser Niklaus Leuenberger, von dem «man» politisch
noch überhaupt nichts wusste, als dass er die «Treue selbst» war,
sprach. Sprach zum Staunen Tribolets. Sprach klug, besonnen, gesetzt
—aber dem Landvogt entgegen! Und zwar, wie Vock berichtet, folgendermassen:
«Das Ansuchen der Regierung sei von grosser Wichtigkeit,
und, demselben ohne reife Beratung zu entsprechen, bedenklich; morgen,
den 15. (25.) März werde eine zweite Gemeinde der Landleute zu
Konolfingen gehalten werden; es sei billig und nötig, dass man die Beschlüsse
dieser Versammlung abwarts und dann erst auf das Anerbieten
der Regierung Bescheid gebe; widrigenfalls würden die äussern Gemeinden
sich mit Recht beklagen und sie der Voreiligkeit beschuldigen
können.» Der so beinahe staatsmännisch berechnend —und zugleich
derart imponierend solidarisch mit den nicht Anwesenden, die davon
betroffen worden wären — zur Verhinderung der drohenden, verhängnisvollen
Beschlussfassung seitens einer grösstenteils ahnungslosen Versammlung
sprach, wusste warum: er war schon jetzt selber einer der
«Rädelsführer», was noch zu beweisen sein wird; wenn das auch niemand
von den Anwesenden als die Minderheit derer, die selber solche
«Rädelsführer» waren, wissen mochte, am wenigsten der Landvogt.
Und so ist klar, dass diese Minderheit jetzt, da sie das Losungswort
Leuenbergers vernahm, aufatmete, sich regte und sich ihrer Haut
zu erwehren begann. Und diese Rettungstat hat sie Niklaus Leuenberger
nie mehr vergessen! Besonders sprangen ihm zwei ganz Vertraute zuhilfe,
die erst während seiner Rede, verspätet, als Ausgeschossene von
Langnau den Saal betreten hatten: Christian Grimm von Gibel, der
Seckelmeister von Langnau, und Christian Eichenberger aus der Ramsern.
«Dadurch», so fährt Vock in seinem Bericht fort, «wurde die vorher
geäusserte gute Stimmung der Versammlung plötzlich geändert.»
Oder, wie es in Leuenbergers Todesurteil, zweifellos nach Angaben
Tribolets steht: «Und es wurde diese gute angefangene Sache um so
viel mehr verhindert»! Tribolets, dieses notorisch jähzornigen und gewalttätigen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 206 - arpa Themen Projekte
Eingreifen, seine Felle derart geschwind bachab schwimmen
sah. Damit aber hat Niklaus Leuenberger in der Tat der ganzen bernischen
Revolution das Leben gerettet!
Auf seinen Vorschlag wurde dann von der Versammlung Lienhart
Glanzmann, der Wirt zu Ranflüh, an die am Tag darauf tagende
Landsgemeinde der vier Landgerichts in Konolfingen abgeordnet. Leuenberger
selbst zeigte keinen Ehrgeiz, sich wählen zu lassen, wurde
aber durch die einhellige Willensäusserung der Gemeinde dazu gedrängt,
sich Glanzmann als Mitgesandter anzuschliessen. Leuenbergers
Vorschlag zeugt von seinem klaren Bewusstsein, worum es ging. Denn
sein intimer Freund Lienhart Glanzmann, Vater von sieben Söhnen
und vier Töchtern, war sein vertrautester Mitverschworener unter den
«Rädelsführern», von Anfang an einer der eifrigsten «Rebellen», und
er wurde später einer seiner besten Kriegsräte, wurde, wie Leuenberger
selber, in Bern geköpft und sein Haupt an den Galgen genagelt...
Das also ist Leuenbergers erstes öffentliches Hervortreten —nicht
aber sein erstes Auftreten in einer Bauernversammlung überhaupt, wie
das fast ausnahmslos in allen Darstellungen behauptet wird. Meistens
wird er dann übrigens noch — und zwar gerade von Sympathisierenden
— als ahnungslos in die Bewegung hineintorkelnder oder geradezu
Hineingezwungener dargestellt, um ihn von der «Schuld» reinzuwaschen,
ein «Revolutionär» gewesen zu sein. Wir meinen aber, dass
es keine Ehre ist, von dem «reingewaschen» zu werden, wofür man
gekämpft hat und den Märtyrertod gestorben ist. Darum kann es Leuenberger
nur zur grösseren Ehre gereichen, dass wir heute nachweisen
können: Leuenberger ist schon vor seinem ersten öffentlichen Hervortreten
auf der Versammlung in Trachselwald ein bewusster geheimer
Kämpfer für die Sache der Bauern gewesen! Er war wirklich einer der
«Rädelsführer», die hätten ausgeliefert werden müssen, wenn der Ueberrumpelungsversuch
Tribolets gelungen, sein Antrag, bezw. sein behördlicher
Befehl, in der Trachselwalder Versammlung durchgedrungen
wäre. Dafür liefert uns den Beweis eines der überaus seltenen Originalschreiben
von Leuenberger selber, das im Berner Staatsarchiv liegt und
das Bögli im «Schweizer Bauer» (19. Januar 1900) in Facsimile veröffentlicht
hat, ohne mit einem Wort diese wichtige Schlussfolgerung
daraus zu ziehen.
Dieses Schreiben ist in einer zwar ungelenken, aber höchst charaktervollen
deutschen Frakturschrift mit starken, beherrschten Senkrechten
geschrieben (einer Schrift, die merkwürdig wesensverwandt mit
derjenigen Ferdinand Hodlers ist, die dieser in seinen deutsch geschriebenen
Briefen verwendete, wie ein Vergleich mit solchen, in meinem
Besitz befindlichen, erweist!). Seine sprachliche Form ist in Orthographie
und Grammatik noch ungelenker als die Schrift, rein emmentalisch
dialektisch, und daher nicht leicht zu verstehen. Dafür ist der Inhalt
umso senkrechter: er enthüllt uns den «lammsfrommen» Leuenberger
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 207 - arpa Themen Projekte
geheimen, illegalen, konspirativen Bauernsitzung zur Erstellung eines
über das ganze Land sich erstreckenden militärischen Wachsystems
gegen die Rüstungen und Truppenbewegungen der Herren, und zwar
in einer Sitzung in Zollbrück, bereits am 19. März! Das war am Tag der
diplomatischen Niederlage der Luzerner Bauern und am Tag der Wahl
Sigmund von Erlachs zum Oberbefehlshaber der gegen die Bauern
ausgehobenen bernischen Streitmacht.
Das Schreiben ist datiert: «Dattum Dan 9. mertzen (bernischen
Kalenders) des 1653 jars von der zoln brug us geheim rat in il», und
ist ein Befehl an seinen «lieben nachher Ulr(i)ch Kipfer wach meister
zu wallt hus»: «Ir welett on ornig du der wachen (Ihr wollet eine Ordnung
tun der Wachen) die wil mir verständig sein (dieweil wir verständigt
sind) äs sigi fröndes folck im land (es sei fremdes Kriegsvolk
im Land) die bald ein geros schaden dun oder uf lucärn zu zion (das
bald einen grossen Schaden anrichten, oder gen Luzern zu ziehen
werde). So welett im ge heim wach uf stelen wo ir wisen das zum tunlichst
(So wollet Ihr insgeheim Wachen aufstellen, die ihr anweisen
mögt, wo es am tunlichsten ist) und wen folck wurdi an kernen da
die uf gehalt wurden und uns ein Zeren gäbe wurden (und wenn Kriegsvölker
ankommen würden, dass diese aufgehalten würden und uns ein
Zeichen gegeben würde). Und welett bost löüffer omen die bis gau
ruders wil louf und gen ranfli loufi (Und wollet schnellstens —? —Läufer
abordnen, die bis nach Rüderswil und nach Ranflüh laufen). De
glichen Weien wir ouch dun (Dasselbe wollen wir auch tun) dan äs ist
vo sig nouw und da dan bis gau harn (? denn es ist —vorgesehen ? ein
Wachsystem? von Signau und von da dann bis gegen Bern). Aber
als in ge heim (Aber alles insgeheim!) und wib und kinden nut ofen
baren (und Weib und Kind nicht offenbaren!) und un ver druetten lütt
(und unvertrauten Leuten auch nicht!). Und nitzen (?) von ortt zu ortt
in geheim schicken . . schicken...» («nitzen» unverständlich, vielleicht dialektisch
«nidsi =abwärts, hier also: in die unteren Landesteile; oder es ist ein
Name gemeint; letztes Wort nach «schicken» unentzifferbar). Folgt
die oben wiedergegebene Datierung, der noch hinzugefügt ist: «und
welett under drin stelen wes ir gesinett sigen und das schüben urnen
schicken» (und wollet unten drauf stellen bezw. setzen, was Ihr zu tun
gesinnt seid, und das Schreiben zurückschicken!).
Kurzum, dieses Schreiben ist ein Muster illegaler Korrespondenz;
wobei sich Leuenberger dessen so bewusst ist, dass er das Geheimhalten
seinem Korrespondenten wiederholt einschärft und sogar das Schreiben
selbst wieder zurückverlangt. Sein Inhalt beweist uns, dass Leuenbergers
Intervention auf der Bauerntagsatzung von Trachselwald am
24. März kein blosser «besonnener und den gemeinsamen Interessen
der Bauern angemessener Rat, vorläufig nichts zu beschliessen», war,
wie Bögli meint, sondern ein bewusster Akt des Revolutionärs, der
durch den Ueberrumpelungsantrag Tribolets, die «Rädelsführer» auszuliefern,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 208 - arpa Themen Projekte
Johann Heinrich Waser
Bürgermeister von Zürich,
"Vermittler" zwischen den Berner Herren und den Berner Bauern
in Bern, sowie in den Waffenstillstandsverhandlungen im Feldlager
bei Wohlenschwil.
Nach einem zeitgenössischen Originalstich von Conrad Meyer in
der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek in Zürich.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 208 - arpa Themen Projekte
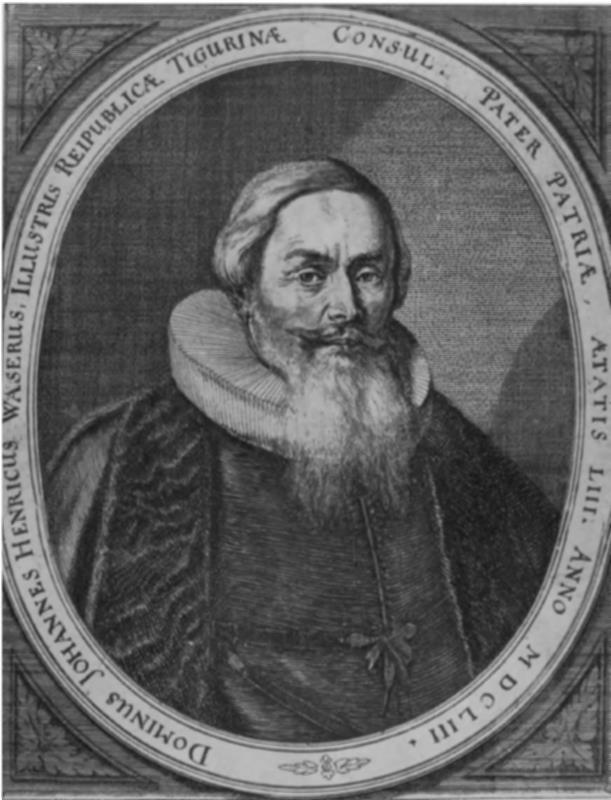
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 209 - arpa Themen Projekte
um dadurch materielle Vorteile zu erlangen, sich selbst und
sein ganzes, zusammen mit seinen Mitverschwörern bereits in Gang
gebrachtes Werk in Gefahr gebracht sah. Dadurch, dass Leuenberger
der Konterrevolution diese gefährliche Waffe im entscheidenden Augenblick
aus der Hand schlug, hat er sich fortan das unerschütterliche Vertrauen
aller wirklichen Führer der Berner Bauernbewegung erworben.
Das war es, was ihn zum Führer qualifizierte und was seine Mitkämpfer
bewog, ihn schliesslich, allem seinem Sträuben zum Trotz, bis an
die Spitze des neuen, umfassenden Bauernbundes zu schieben.
Nun wollen wir zu der wiederholt erwähnten Konolfinger Landsgemeinde
der vier Landgerichts vom 25. März, an der auch Niklaus
Leuenberger mit Lienhart Glanzmann zusammen teilnahm, noch nachtragen,
dass dort auch der künftige Bundesschreiber oder «Kanzler»
des neuen Bundes gefunden wurde. Und zwar war es, wie ausdrücklich
berichtet wird, Uli Galli, der ihn dafür gewann und in Vorschlag
brachte. Wir meinen Hans Konrad Brenner —berndeutsch «Brönner»
genannt und geschrieben —, der als gebürtiger Deutscher aus Britzingen
in der Herrschaft Badenweiler stammte, jedoch schon seit vierzig
Jahren in Münsingen als Notar niedergelassen war. Er zeichnete sich
vor allen andern Führern des Bauernkriegs —auch vor dem luzernischen
Bundesschreiber Johann Jakob Müller, der dafür ein besserer
Geschichtskenner der Landesgeschichte war — durch bedeutendere
Rechtskenntnis aus, und das war gerade das, was den Bauern insgemein
so schmerzlich abging. Brönner, wie wir ihn mit den Berner Bauern
nennen wollen, hat später, in den peinlichen Verhören vor seiner
Hinrichtung, behauptet, er sei auf dieser Konolfinger Versammlung
«durch Drohungen gezwungen, Schreiber der Bauern geworden». Wenn
dies nicht bloss eine nur allzu begreifliche Notlüge war, um dem Martertode
zu entrinnen, so würde diese Aussage für einen ausgesprochen
revolutionären Verlauf der Konolfinger Landsgemeinde zeugen. Dass
sie jedenfalls stürmisch verlief, bezeugt seine andere, gleichzeitig gemachte
Aussage —die nichts mit einer persönlichen Entlastung Brönners
zu tun hat und deshalb wohl stimmen mag —: «Damals habe man
sich wegen der Artikel nicht einigen können und deshalb eine neue
Versammlung nach Signau berufen.»
Doch nun haben wir den Ansatz zum Aufruhr auch im Bernischen
bis in jede Einzelheit gewonnen und wollen uns nun einer höchst
merkwürdigen Folge des eidgenössischen Zwischenspiels in Baden zuwenden.
Zusammenfassend ist bezüglich Berns zu sagen, dass auch den
Berner Bauern die Erniedrigung durch eine diplomatische Niederlage
nicht erspart blieb, wenn sie auch nicht so dramatisch ausfiel wie die
der Luzerner Bauern. Genau so wie die Luzerner aber haben auch die
Berner ihre Niederlage einer eidgenössischen «Vermittlung» zu verdanken.
Und diesmal waren es natürlich die Herren «Ehrengesandten» der
protestantischen Orte, und zwar die von Zürich, Basel, Glarus, Schaffhausen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 210 - arpa Themen Projekte
den protestantischen Berner Herren zu Hilfe sprangen. An ihrer Spitze
standen die beiden Zürcher, der allmächtige Bürgermeister Johann
Heinrich Waser und der Ratsherr und Statthalter Salomon Hirzel, der
in diesem Amt schon einige Uebung hatte: war er es doch, der damalige
Zürcher Bürgermeister, gewesen, der wie wir sahen, bereits im «Thuner
Handel» anno 1641 mit dem Basler Bürgermeister Wettstein zusammen
an der Spitze der «Ehrengesandtschaft» stand, die die Oberländer
und Emmentaler Bauern unter Führung Uli Gallis vor den Berner Herren
auf die Kniee zwang. Jetzt aber, im «Berner Handel», war der Bürgermeister
Waser dabei durchaus die Hauptperson, ganz ebenso alle
andern überragend, wie im Luzerner Handel der Urner Landammann
Zwyer es war.
Diese «Ehrengesandtschaft» war von der gleichen Tagsatzung
nach Bern abgeordnet worden, die das «Defensional» und das «Gemeine
Mandat» beschloss; sie konnte also unmöglich eine andere Gesinnung
nach Bern tragen als sie diese beiden Werke beseelt. Immerhin
war der strafende Eifer der führenden Herren, der beiden Zürcher,
inzwischen durch eine kurze, nur zweitägige Heimkehr Wasers nach
Zürich gedämpft worden. Denn: «Der Versuch einer friedlichen Vermittlung
zwischen der Berner Regierung und ihren Untertanen», sagt
Peter, «schien dem Zürcher Rat umso notwendiger, als man sich hüten
musste, in dieser für die Obrigkeiten gefährlichen Situation das Zürcher
Volk, dem man nicht vollkommen traute, irgendwie vor den Kopf
zu stossen.» Das ist das Dauermotiv für Zürich, besonders als Vorort,
geblieben, Bern möglichst am Losschlagen zu hindern. Trotzdem beschloss
der Zürcher Rat bereits am Sonntag, den 23. März, «nach dem
Morgengottesdienst», «dass die durch den badischen Abschied dem
Vorort auferlegten Truppen Mittwoch, den 26. März, nach Lenzburg
marschieren sollten und dass Glarus, Basel, Schaffhausen und Appenzell
und die Stadt St. Gallen sofort hievon zu verständigen und aufzufordern
seien, ,Ire völcker, die auch unter dissem Corpus dienen, und
dazu gehören', bei Lenzburg zu den zürcherischen Truppen stossen zu
lassen».
Zum Oberkommandanten (Generalissimus) des ganzen «Corpus»
wurde jetzt der Badener Mitgesandte Wasers, der neben diesem allmächtige
Zürcher Standesseckelmeister Johann Konrad Werdmüller,
gewählt. Diesem, als dem Organisator der zürcherischen Wehrmacht,
stand fast der ganze männliche Teil des weitverzweigten Geschlechts
der Werdmüller als erstklassige Militärs zur Verfügung, die alle, wie
er selber, im dreissigjährigen Krieg bei verschiedenen Kriegsfürsten in
zum Teil sehr hoher Stellung gedient hatten und die er nun auch gegen
die Bauern einsetzen konnte. Die Werdmüller waren wohl überhaupt
die damals modernsten Militärfachleute in der Eidgenossenschaft —
und als solche waren sie zu geschichtlichen Ueberwindern der schweizerischen
Bauernerhebung geradezu prädestiniert.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 211 - arpa Themen Projekte
Gleichzeitig aber, um die eigenen Bauern, besonders die Knonauer
und die Wädenswiler, über das Kriegstreiben zu beruhigen, erliess der
Zürcher Rat einen von Waser selbst, zur Rückendeckung für seine Berner
Mission, angeregten, überaus bieder und «friedlich » lautenden «Bericht
an die Landschaft», den er in den nächsten Tagen nicht nur in
allen Truppenteilen durch die Hauptleute, sondern auch in allen Hauptgemeinden
des Landes durch eigene Boten verlesen liess, wobei er alle
Ausgeschossenen in den Gasthäusern auf Kosten des Rates freihalten
liess. In diesem Bericht steht die Versicherung, dass die ausgehobenen
Truppen «wider jemand den gwalt ze brüchen, nit sollint angeführt
werden, ess seyge dan sach, dass alle güetliche gebühr und billiche
mittel, so dem gwalt vorgahn..., mutwillig und verächtlicher wyss
ussgeschlagen wurden». Das war Bauernfängerei grossen Stils, wie sie
im Bauernkrieg kein anderer Stand der Eidgenossenschaft zuwege
brachte und die tatsächlich umsomehr verfing, als man gleichzeitig
die völlige Freigabe des Salzhandels versprach. Man frage nur nicht,
wie diese Dinge später, nach der Niederwerfung der Bauern, gehandhabt
wurden!
Waser und Hirzel, den man jenem anstelle des zum Oberkommandierenden
gewählten Werdmüller als Mitgesandten gab, konnten mithin
am 25. völlig beruhigt nach Bern abreisen. Noch am Abend dieses
Tages trafen sie in Aarau mit den «Ehrengesandten » von Schaffhausen,
Basel und Glarus zusammen während der von St. Gallen schon
nach Bern gereist war, der von Appenzell A.-Rh. später nachreiste.
Aber, merkwürdig —noch am selben Abend entliess der Zürcher Rat
Knall auf Fall sämtliche Truppen des aufgebotenen «Corpus», von
denen die Stadt und das Fraumünsteramt förmlich wimmelten! Was
mag da vorgefallen sein? Wir vernehmen nur Folgendes, das uns nicht
hinreichend erscheint, um diesen vom Herrenstandpunkt aus erstaunlichen
Akt zu motivieren: Vom Berner Rat sei schon am 24., mithin als
Waser noch in Zürich war, Bericht eingelaufen, Bern sei bereit, die
«fründgüetliche Pacification» zu versuchen; im gleichen Schreiben ersucht
derselbe Rat dennoch um die «zugesagte tapffere Hilffleistung»!
Ferner sei am selben Tag ein Schreiben der auf der Heimreise befindlichen
bernischen Tagsatzungsgesandten eingetroffen: «wir erachtend,
dass disses Gschefft könne, wie zu Lutzern, mit Güete bygelegt werden».
Am 25. aber kam «die Meldung einiger in den Aargau ausgeschickten
Späher, dass die bernischen Untertanen in der Grafschaft
Lenzburg entschlossen seien, den zürcherischen Truppen den Pass in
Mellingen zu versperren»!
Sollte das wirklich genügt haben, um die so umfassend eingeleiteten
militärischen Pläne, wenigstens für den Augenblick, völlig preiszugeben?
Der Zürcher Rat selbst behauptete es, und zwar in einem
Kreisschreiben an sämtliche evangelischen Stände, das noch am 25.
März an diese abging: «Da die Bauern im untern Aargau jetzt noch
unbewaffnet, aber durch die Entsendung von Truppen in Harnisch gebracht
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 212 - arpa Themen Projekte
Untertanen gütliche oder rechtliche Mittel anwenden wolle, setze er
seine ,gantze Hoffnung auf das Werck der Gesandtschafft', und lasse
daher vorläufig die schon eingerückten Truppen nicht ins Feld rücken;
die übrigen Orte möchten es auch unterlassen.» Und schon am andern
Tag erhielt der Zürcher Rat von Waser aus Aarau, wie zur Rechtfertigung
seines sonderbaren — für diese «absoluten» Herren wahrhaft
sonderbaren — Kleinmutes, den Bericht: «unsere eidgenössischen Völker
sind nirgends angenehm, auch nicht in Aarau und Brugg»! In
Brugg zogen die Schaffhauser Truppen eben an diesem Tage ein —
um am darauffolgenden, am 27., auf Grund der Zurückmahnung des
Vorortes, wieder nachhause zu ziehen.
Basel aber liess am 26., trotz der Abmahnung des Vororts, die es
gerade erhalten hatte, seine Truppen ausrücken, und zwar quer durchs
Baselbiet und über den Jura bis nach Aarau, wo sie am 28. eintrafen —
und das hat Folgen gehabt, die entscheidend in den Gang des ganzen
Bauernkriegs eingriffen, indem sie die gesamte Bauernschaft des Basellands,
samt der Stadt Liestal, ja auch die des Solothurnerlands, samt
der Stadt Olten, definitiv dem grossen Bauernbunde zu führten!
Doch ehe wir zur Erzählung der Geschichte dieser beiden Bauernschaften
bis zu ihrem Eintritt in die grosse Gesamtbewegung ausholen,
um damit das Viergespann des Bauernkriegs voll zu machen, müssen
wir endlich die «Ehrengesandtschaft» nach Bern begleiten und die Erniedrigung
der Berner Bauern schildern, die bei ihnen ganz ebenso wie
bei den Luzerner Bauern, die Revolution erst eigentlich auf ihren Gipfel
gebracht hat. Erst der Wiederaufschwung der Berner Bauern holt
dann die Basler und Solothurner Bauern wieder ein, die während der
«Pazifierung» der Berner grad ebenso in die scheinbare Lücke in der
Gesamtbewegung einspringen, wie es die Berner Bauern in Langnau
und Trachselwald während der «Pazifierung» der Luzerner getan
haben.
Am 26. übernachtete Waser mit den übrigen «Ehrengesandten»
in Langenthal. ((Gemäss ihrer Instruktion» erkundigten sie sich hier
«und am folgenden Tage in Wynigen und in Burgdorf nach der Stimmung
und den Begehren der Bauern, die auch im Oberaargau hauptsächlich
darüber aufgeregt waren, dass die Regierung fremde Truppen
habe ins Land kommen lassen. Bereits fingen die Bauern an, sich
zusammenzurotten... Doch liess sich das Volk» — so meint der Zürcher
Historiker Peter mit seinem Heros Waser — «durch die Vertröstung
auf einen durchaus friedlichen Ausgleich leicht beruhigen; die
meisten Gemeinden hatten ihre Ausschüsse zur Einreichung der Beschwerden
an den Rat bereits nach Bern gesandt, und die Emmentaler,
die Miene gemacht hatten, nicht mit ihren Herren unterhandeln zu
wollen, da man sie Aufrührer geheissen, entschlossen sich, nach einer
Unterredung mit Bürgermeister Waser, vor dem Berner Rat und den
Interponenten (Vermittlern) zu erscheinen.» Kurzum: Herrn Waser
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 213 - arpa Themen Projekte
zu sein, seine grosse «Diversion» zugunsten der Berner Herren zu starten.
Die Bauern waren auf das Glatteis der Diplomatie gelockt —und von
da war es nicht mehr weit bis zum Fussfall vor den Herren!
Am Abend des 27. waren die Herren «Ehrengesandten» endlich in
Bern und machten dem grossmächtigen Herrn Schultheissen Anton von
Graffenried, dem Chef der Kriegspartei, die erste ihrer vielen und
durch das höfische Zeremoniell, das in Bern herrschte, überaus komplizierten
und anstrengenden Aufwartungen. Am 28. setzten sie diese
in einem wahren Karneval von Kostümierungen und Empfangsriten
fort, in denen sich selbst ein chinesischer Obermandarin wohl kaum
zurechtgefunden hätte. Mit Samthandschuhen fasste Waser die manchmal
sehr «schützigen» Berner Herren an und versicherte ihnen eins
über das andere Mal in wohlgedrechselten Reden —besonders in der
zu seinem Empfang veranstalteten Ratssitzung —, dass er und seine
Mitgesandten nur eine «die obrigkeitlichen Rechte und die Souveränität
des Standes in keinerlei Weise gefährdende Interposition» beabsichtigten.
Worauf der Rat, zur Wahrung seiner «Souveränität», sie nur
«für den fahl» zu bleiben bat, dass «der Rat von Bern die sach nit selbs
erörtern könne».
Diese anstrengenden Komplimente hinderten die «Ehrengesandten»
jedoch nicht, bereits am 28., «Morgens in aller Frühe», auch «die
Emmenthalischen Anwesenden in einem Landtuszschusz in groser Zal»
(es waren ihrer 29) zu empfangen, um sich die «Copia Irer underthenigen
Bittschrift an ihre Gnedigen Herren und Oberen» überreichen zu
lassen. Sie «ermahnten dieselben» —wie Vock nach Wasers eigenem
Tagebuch berichtet — «auf ihre Bitte um Fürsprache, zur Abbitte gegen
die Regierung und zu vertrauensvoller Ueberlassung der Beschwerden
an die oberkeitliche Gnade und Abhilfe». Schon die erste Sorge der
Herren «Ehrengesandten» also war die Demütigung der Bauerngesandtschaft.
Unter deren Mitgliedern aber befand sich niemand Geringeres als
Niklaus Leuenberger; auch Christen Eichenberger war dabei, auch
Christen Grimm, auch der Hans Bürki, der schon bei der ersten Verschwörung
in Uli Gallis Haus in Eggiwil dabei gewesen war und später
vom Prädikanten Anthoni Kraft so schmählich verraten wurde. Nur
Uli Galli —nein, der war nicht dabei: der wusste es vom Thuner Handel
her besser! Auch Daniel Küpfer nicht, der alte «Schmied von Grosshöchstetten»,
aus demselben Grunde. Und ebensowenig Hans Rüeggsegger,
der Weibel von Röthenbach und alte Thuner Kämpfer. Sie gehörten
eben zu den ältesten und erfahrensten Revolutionären, denen
der blinde Fehler, auf die Gnade der Herren zu bauen, nicht mehr
widerfahren konnte. Aber auch Leuenbergers Freund Lienhart Glanzmann
war nicht mit in Bern; er wird durch seine Entlebucher Verwandschaft
über solche «Gespräche» mit den Herren gründlicher unterrichtet
gewesen sein. Und es ist ihm offenbar nicht gelungen, Leuenberger
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 214 - arpa Themen Projekte
d. h. von seiner Unfähigkeit, mitten im Kampfe, in dem es auf
rechtzeitiges Zugreifen und schlagkräftiges Handeln ankam, sich von
Bedenklichkeiten, Rücksichten und vor allem von edlen Illusionen über
obrigkeitlichen Anstand zu befreien.
So hatte denn Waser mit dieser Deputation von fast lauter Neulingen
und wohlmeinenden Illusionisten offenbar ein ziemlich leichtes
Spiel. Schwieriger war eine andere Opposition zu überwinden: die in
den Reihen des Berner Rates selbst, der sich im Ganzen nur zähneknirschend
— trotz allen Komplimenten —in die Tatsache der eidgenössischen
Intervention zu schicken vermochte. «Die Vermittler», so
schreibt Vock, «fanden bei den meisten Ratsgliedern und Stadtbürgern
grosse Hitze und Entrüstung wider die Bauern, und sie vernahmen,
dass die Vermittlung nicht wäre angenommen worden, wenn nicht der
Schultheiss Dachselhofer den Antrag» (hinter dem der andere Schultheiss
von Graffenried stak!), «die Emmenthaler mit Waffengewalt zu
überfallen, so kräftig bekämpft... hätte.»
Da kam ein grosser Theatercoup Herrn Waser als eindrucksames
Schreckmittel zuhilfe: als ein Beispiel dafür, wie man mit dem Feuer
spielte, wenn man auch nur die geringsten Truppen aufmarschieren liess!
Der Einmarsch der winzigen Basler Truppe von 500 Mann in Aarau am
Abend des 28. hatte vermocht, nicht nur Aaraus ganze Bürgerschaft, sondern
und vor allem die gesamte Bauernschaft des unteren und des
oberen Aargaus, des Amtes Aarburg, samt Stadt, der Grafschaft Lenzburg
und der Gegend von Langenthal, sowie der anstossenden Gebiete
von Solothurn und Basel, in hellsten, bewaffneten Aufruhr zu bringen.
Die Schreckenskunde davon drang in der Nacht vom Samstag auf Sonntag
den 29.-30. nach Bern. Noch vor Morgengrauen wurde der Rat zu
einer Sitzung zusammengerufen, die Herren «Ehrengesandten» dazu
aus den Betten geholt. Sofort erliessen diese letzteren, als eidgenössische
Autorität, auf Bitten des Rats ein Beruhigungsschreiben an die betroffenen
Aemter und sandten selbst die Hälfte ihrer Gesandtschaft, geführt
von Salomon Hirzel und begleitet von Wasers Sekretär, dem Ratssubstitut
Schmid, sowie von zwei Berner Ratsherren, «das Land hinab
bis nach Aarburg und Aarau..., um persönlich die Bauern eines Besseren
zu belehren». Nur Waser selbst und je ein «Ehrengesandter» von
Basel, St. Gallen und Appenzell blieben zur Fortführung der Verhandlungen
mit den Emmentalern in Bern. Dass diese selbst aber, inbegriffen
Leuenberger, trotz solch aufregender Kunde, die ihre ureigenste
Sache anging, ruhig in Bern sitzen blieben —das ist das Erstaunlichste
an der ganzen Sache!
Da dies überhaupt möglich war und da andererseits nun auch die
kriegerischsten Herren im Rat angesichts der Tausende und Abertausende
bewaffneter Bauern einigermassen stillehielten, hatte Waser nun
wirklich leichtes Spiel nach beiden Seiten, um einen Kompromiss
durchzudrücken. So bot er den Herren eine vorgängige «kniefällige Abbitte»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 215 - arpa Themen Projekte
«neue Huldigung» an; den Bauern aber, mit den nötigen Drohungen,
eine Auswahl wirtschaftlicher Erleichterungen aus sehr zahlreichen,
die sie begehrt hatten, aber einzig als Gnade und Lohn für Abbitte
und neue Huldigung.
Der Rat knurrte zwar und fasste, zur Wahrung seines Prestiges,
am 3. April trotz alledem folgende impertinenten Beschlüsse: «1. Die
Emmentaler haben das Laster des Meineids (!) begangen, und sie verdienen,
dafür gestraft zu werden. — 2. Sie haben, als Urheber der gegenwärtigen
Unruhen, die Kosten zu bezahlen (!). — 3. Sie haben die
Gnade der Verwandlung des Heuzehntens in einen ewigen Geldzins»
(d. h. einer Leibeigenschaftsabgabe in eine bürgerliche Steuer; eine
schon weit zurückliegende Geschichte, die extra zur Erniedrigung der
Bauern hervorgeholt wurde!) «verwirkt. —4. Sie sollen die Rädelsführer
ausliefern (!).»
Man denke sich Leuenberger angesichts dieser frechen Forderungen,
deren letzte, die Auslieferung der «Rädelsführer», er noch vor zehn
Tagen dem Tribolet in Trachselwald aus der Hand gewunden hatte!
Trotzdem ist die Reaktion der Bauern darauf eine geradezu bejammernswerte.
Zwar suchten sie sich dieser Pression dadurch zu entwinden,
dass sie erklärten, sie müssten Bedenkzeit haben, um die Sache
zuhause mit ihren «Mithaften» zu beraten. Nun zitterte aber Waser
um den Ruhm seines ganzen Schiedswerkes, wenn er die Bauern nicht
jetzt und hier zur Abbitte zu bringen vermochte; denn die Antwort der
Bauern im Lande draussen konnte er sich leicht denken. Für ihn waren
die vier Forderungen des Rates ja nur ein Schreckschuss, um die Abbitte
und neue Huldigung auf der Stelle zu erzwingen. Der Schuss
durfte nur jetzt um keinen Preis daneben gehen! So versprach er den
Bauern, sich bei den Gnädigen Herren und Obern mit der ganzen
Wucht seiner Autorität ins Zeug zu legen, damit sie Gnade statt Recht
walten lassen und auf die vier Punkte zurückkommen würden — wenn
sie, die Bauern, sich jetzt nur zur Abbitte verstehen würden.
Hier wenn irgendwo verrät sich die viel längere und vollständigere
Untertanenschaft der Berner Bauern im Vergleich mit den Entlebuchern
oder auch den Willisauern. Statt wie diese in ähnlichen Lagen
nun aufzuflammen und heimzustreben, um das ganze Volk gegen die
Erpressungen der Herren aufzurufen, zeigen sich die Emmentaler in
diesem Handel so stur und schwerblütig und wie vor den Kopf geschlagen,
dass sie wahrhaftig um ihre Ehre handeln! Sie erklären, «sie
werden sich zu dieser Abbitte verstehen, wenn die Vermittler Fürsprache
bei der Regierung tun wollen; sie verlangen dafür zwar die
Aufhebung der drei ersten Punkte; gerade vom vierten aber verlangen
sie nur «dass er gemässigt (!) werde; es falle ihnen zu hart, dass sie
selbst die Anführer ausliefern sollen; hingegen wollen sie sich der oberkeitlichen
Bestrafung derselben nicht entgegensetzen»! Sie erklären
sich alsdann bereit, «auf's neue zu huldigen; nur bitten sie die Oberkeit,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 216 - arpa Themen Projekte
Truppen zu entlassen». Was davon allerdings durch die redaktionelle
Fixigkeit des Herrn Waser —fast alle Kenntnis von diesen Verhandlungen
beruht auf dessen Tagebuch — den Bauern untergeschoben,
was ausserdem von der späteren Geschichte, die eine Herrengeschichte
war, dem hinzugefügt worden ist, das lässt sich heute nicht mehr ausmachen.
Tatsache, sehr betrübliche Tatsache aber ist, dass die Bauern am
Tag darauf, am 4. April, Abbitte und neue Huldigung geleistet haben,
nachdem der Rat die drei ersten Punkte vom 3. April —als sie ihren
Zweck, die Erpressung von Abbitte und Huldigung, erfüllt hatten —
aufgehoben und den vierten in der erwähnten, von den Bauern selbst
verschuldeten Weise «gemildert» hatte. Die Bauern wären auch den
vierten Punkt für den vereinbarten Preis der Abbitte und Huldigung
ganz losgeworden, wenn sie mehr Rückgrat gezeigt hätten. Der Akt
der grossen Demütigung aber ging, nach Vock, folgendermassen vor
sich: «Nachdem Bürgermeister Waser den Landesdeputierten diesen
Beschluss des Grossen Rats eröffnet hatte, wurden dieselben in den
Ratsaal geführt, wo sie vor versammelten Rät' und Burgern und den
Eidgenössischen Vermittlern auf ihre Knie fielen, um Verzeihung baten,
ihren Dank für die neue Gnadenbezeugung aussprachen und einer nach
dem andern im Namen ihrer Gemeinden durch Handgelübde, welches
Bürgermeister Waser abnahm, ihrer Regierung auf's neue Treue und
Gehorsam feierlich versprachen. Bürgermeister Waser erinnerte sie
noch einmal an die begangenen Fehler (!) und an die Pflichten, zu
deren treuer Erfüllung die neue Gnade der Obrigkeit sie bewegen solle,
und er entliess sie mit der Anzeige, dass die bewilligten Artikel ihnen
schriftlich werden nachgeschickt und zugestellt werden.»
Diese «bewilligten Artikel», die sogen. «Konzessionen vom 4. April»,
ihrer siebenundzwanzig, machen sich, in Geschichtswerken gedruckt,
ganz hübsch zugunsten der Berner Herren aus; denn sie scheinen ein
unerwartetes Entgegenkommen dieser machtstolzen Junker und beinahe
so etwas wie soziales Verständnis für die gedrückte Lage der
Bauern zu beweisen. (Obwohl auch die wirklichen Konzessionen, die
diese Artikel enthalten, bei genauerem Zusehen nur Halbheiten oder
Zweideutigkeiten darstellen: so ist z. B. bezüglich des Salzhandels
festzustellen, dass trotz der Konzession, «dass der Fryc Kouff des
Saltzes für ihren Hussbruch allein zugelassen, aber nit uff fürkouff»,
das Salzmonopol fest in der Hand der Regierung blieb.) Nur schade:
diese Artikel sind den Bauern niemals «zugeschickt und zugestellt»
worden, wie Waser es ihnen versprochen hatte! Noch weniger ist
auch nur versucht worden, sie jemals in die Praxis umzusetzen!
Sie sind dem grossen Emmentaler Ausschuss nur vorgelesen, d. h. nur
als süssduftende Leimrute unter die Nase gestreckt worden, auf die sie
hereinfliegen sollten — und hereingeflogen sind.
Dieselbe Verwendung fanden diese Artikel dann noch gegenüber
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 217 - arpa Themen Projekte
Bipp, Lenzburg und Burgdorf, die die Berner Herren, nach dem unverhofft
geglückten Spiel mit den Emmentalern, durch die «Ehrengesandten»
auf den 9. April ebenfalls eiligst nach Bern hatten bestellen
lassen.
In diesen Gegenden war ja ohnehin inzwischen die andere Hälfte
der «Ehrengesandtschaft» unter Salomon Hirzel bis zum 4., als sie
nach Bern zurückkehrte, so eifrig am «Versöhnungswerk» tätig gewesen,
dass es nicht mehr schwer fiel, mit dem Versprechen weitgehender
Konzessionen geeignete Ausschüsse nach Bern auf dasselbe Glatteis zu
locken, wie die Emmentaler. Dennoch gab es mit diesen Ausschüssen
in Bern noch beträchtliche Schwierigkeiten. «Aller Vorstellung ungeachtet»,
sagt Vock, «wollten diesmal nur Wenige der Landdeputierten
aus den genannten Aemtern sich zu einem solchen Fussfälle verstehen....
Diesem Ansinnen aber widersetzten sich die Deputierten von
Aarburg und aus der Grafschaft Lenzburg beharrlich.» Die «Ehrengesandten»
mussten ihnen zünftig drohen, dass sie «dadurch die bereits
erhaltenen Gnaden verwirken und grössere Strafen zu erwarten haben
werden». Diese Ausschüsse hatten eben inzwischen bereits bemerkt,
dass die 27 Artikel keine Spur einer Amnestie (eines Generalpardons
für die Teilnahme am Aufruhr) enthielten und taten ihren Fussfall
erst, nachdem ihnen dieser Pardon, sowie noch eine Anzahl weiterer,
ihre lokalen Beschwerden betreffenden Konzessionen, von den Berner
Herren feierlich «zugesagt» worden waren mit genau demselben Endeffekt
wie bei den sogenannten «Konzessionen»!
Ausserdem war dem Exemplar der 27 Artikel, das Herr Waser
diesen Ausschüssen, wie schon den Emmentalern, verlesen hatte, am
Schluss eine Klausel hinzugefügt, die den Wert dieser Konzessionen
restlos wieder aufhob. Sie lautete: «Alles dieses, so lang es Uns gefällt
und Wir es auch thunlich und nützlich erachten werden, mit dem Vorbehalt,
den einen und andern Artikel zu mindern, zu mehren, ganz
oder zum Theil abzuthun, nach Unserem Belieben»! Zwar möchte Bögli
diese Klausel gern wegdisputieren, weil das Exemplar der «Konzessionen»,
das im bernischen Staatsarchiv liegt, sie nicht enthält. Aber
dieses Exemplar braucht ja nicht notwendig dasselbe zu sein, das
Waser den Ausschüssen vorlegte und das er auch auf seiner anschliessenden
Beruhigungsreise durchs Emmental in einer Reihe von Gemeinden
vorlas. Gerade diese Klausel hat den Bauern —leider nur allzu nachträglich
—einen empörenden Eindruck gemacht, sie ist landesbekannt
geworden und hat bei der Wiedererhebung der Berner Bauern notorisch
genau dieselbe «aufrührerische» Rolle gespielt wie die Vertragsfälschung
Zwyers in derjenigen der Luzerner Bauern. Eine derartige
historische Wirkung ist nicht aus nichts entstanden, auch wenn es ein
Berner Staatsschreiber für klüger hielt, dem Staatsarchiv das Dokument
ohne diese Klausel einzuverleiben!
Ausser diesem Schlag ins Gesicht, den der Berner Rat dem Rechtsempfinden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 218 - arpa Themen Projekte
der Exekution der «Rädelsführer», die nun im Belieben der Regierung
stand und daher für sich allein schon genügte, um eine Gewitterwolke
über dem Lande zuzammenzuballen, war im Artikel 22 der sogenannten
«Konzessionen» allen Berner Untertanen das einzige politische
Grundrecht, das sie seit der Langnauer Landsgmeinde forderten,
ausdrücklich abgesprochen worden: «Die Abhaltung von Landsgemeinden
kann nicht gestattet werden, da diese schon von Alters her verboten
waren»! Da hatten die guten Berner Bauern die Quittung für ihre
unablässige Berufung auf die «guten alten Zeiten'! Statt vorwärtsblickend
sich das Recht, solange sie dazu noch im Stande waren, mit
Gewalt zu holen, das ihnen die Herren von «Alters her» mit Gewalt
geraubt hatten! Weil aber, um mit Bögli zu reden, «bei Anerkennung
der bestehenden städtischen Gewaltherrschaft dem Volke keine Garantieen
für seine Rechte, ja selbst für die feierlichen Zugeständnisse der
Regierung, geboten sein konnten, so war kein Ende des Konfliktes abzusehen».
Zwar «die wirkliche Abstellung der Beschwerden, wie sie
nun auf dem Papier ausgesprochen war, hätte bedeutend erträglichere
Zustände herbeigeführt. Doch dazu sollte es nicht kommen. Die Korruption
in der Staatsverwaltung war zu gross, der gute Eifer der Regierung
zu gering, und das Zutrauen des Volkes fehlte in Folge bitterer
Erfahrungen ganz. Die heimkehrenden eidgenössischen Vermittler hatten
daher unterwegs Gründe genug, sich zu überzeugen, dass durch
ihr Versöhnungswerk die drohende Gefahr eines verderblichen Krieges
nicht beseitigt war.»
Bevor wir einige dieser Gründe anschaulich machen, wollen wir
doch auch den Abschied der Herren «Ehrengesandten» von ihren Berner
Gastgebern nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, und zwar deshalb,
weil er ein für die damaligen Herrensitten höchst kennzeichnendes
Detail aufweist. «Am 12. April», so erzählt der Zürcher Historiker
Hans Nabholz diese Episode, «erschien vor den eidgenössischen Gesandten
eine Abordnung der Berner Regierung, und in ihrem Namen
verdankte der Schultheiss Graffenried» —der Chef der Kriegspartei,
der denjenigen der Friedenspartei, Schultheiss Dachselhofer, wenige
Tage darauf endgültig aus der Staatsführung verdrängte — «in einer
,zierlichen, langen Oration' die geleisteten Dienste. Wie das Gold im
Feuer, so habe sich die Freundschaft Zürichs und seiner Miteidgenossen
gegen Bern... bewährt. Um aber nicht nur mit schönen Worten,
sondern auch mit der Tat 'dieser Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen,
wurden beim Abschied jedem Gesandten 24 spanische Dublonen trotz
Sträubens in die Hand gedrückt und auch die Hotelrechnung der Herren
zu Bern und auf der Heimreise von Bern beglichen.'
Das «Versöhnungswerk» hat sich also für jeden einzelnen «Ehrengesandten»
über die rein «idealistische» Ehre hinaus auch materiell
nicht übel bezahlt gemacht: 24 spanische Dublonen waren gleich 96
Kronen, gleich 180 Gulden, gleich 336 Pfund, gleich 2400 Batzen! Das
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 219 - arpa Themen Projekte
2000 gute Goldfranken. Aber diesen «Ehrenlohn», den die Herren zu
ihren ausserdem bezogenen, fetten Amtslöhnen als Trinkgeld hinzuverdienten,
muss man, um ihn ganz zu würdigen, mit einem gewöhnlichen
Taglohn derselben Zeit für Schwerarbeiter vergleichen: dieser
betrug beispielsweise für einen Zimmermeister oder einen Steinhauermeister
im Emmental ganze 6 Batzen! Diese qualifizierten Arbeiter
(Meister, nicht Handlanger) hätten 'also, die Sonntage nicht gerechnet,
volle 400 Tage Schwerarbeit leisten müssen, um sich die 24 Dublonen
eines einzelnen «Ehrengesandten» nicht als zusätzliches Trinkgeld,
sondern als beruflichen Arbeitslohn zu verdienen! Aber dieses Verhältnis
ist vielleicht auch heute nichts so ganz Unerhörtes, insbesondere
wenn man bei unseren heutigen «Ratsherren» den zusätzlichen «Ehrenlohn»
der vielen Verwaltungsratsposten in Anschlag bringt. Und die
damaligen Berner Junker werden schliesslich selbst am besten gewusst
haben, was ihnen die «Schwerarbeit» der eidgenössischen «Ehrengesandten
wert war... Die Berner Geistlichkeit jedenfalls wusste es
auch: beim Abschied: dankte sie den Herren «Ehrengesandten» «mit
bewegten Worten und drückte ihre Freude aus, ,dass die lieben Engel
sie herbeigeführt hätten'»!
Auf der Heimreise, die sie am 12. antrat, teilte sich die «Ehrengesandtschaft»
abermals in zwei Hälften: die eine, unter Führung des
Statthalters Salomon Hirzel, ging' auf eine Pacificierungsreise» wieder
über Burgdorf, Wynigen, Herzogenbuchsee in die eben von Hirzel bearbeiteten
Gebiete: Wir verweilen nur noch kurz bei der andern Hälfte,
weil es der grossmächtige Bürgermeister Waser selbst war, der sie
führte, und zwar direkt in die Höhle des Löwen, oder wenigstens des
«Löuwenbergers»: ins innerste Emmental.
Des schlauen Wasers ganze Weisheit bei diesem Unternehmen
war der Grundsatz «divide et impera», wie es der Grundsatz Zwyers
gegenüber' den Luzerner Bauern gewesen war, wie es das Prinzip der
damaligen «eidgenössischen» Politik der Herren gegenüber dem Schweizervolk
überhaupt war. Zum Ueberfluss wird uns dies inbezug auf
Wasers Tätigkeit im Emmental noch ausdrücklich durch einen Bericht
Tribolets aus Trachselwald an den Berner Rat beurkundet.
Wasers Pazifizierung aber ging folgendermassen vor sich: «Sonntag,
den 13. April, am Osterfests» — so erzählt G. J. Peter nach dem
eigenen Tagebuch Wasers und seinen Briefen und Berichten —
«teilte er zu Langnau der versammelten Kirchgemeinde die Vereinbarungen
der bernischen Bauernausschüsse mit ihrer Obrigkeit nach
einem Konzept... mit», «auf solche form, wie dieselben bey den
G. Herren und Oberen. . . ausgefallen», «forderte sie schliesslich zum
Gehorsam und zu treuer Ergebenheit gegen die Obrigkeit auf und ermahnte
sie ernstlich, doch ja keine neuen Beziehungen mit den Entlebuchern,
die sich gegen ihre Obrigkeit so halsstarrig erzeigten, anzuknüpfen...
Aber der kleinere Teil der Versammelten gab die bestimmte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 220 - arpa Themen Projekte
darauf, dass sie ohne die Einwilligung ihrer ,Bundesgenossen' kein
bindendes Versprechen abgeben könnten...»
Da haben wir es endlich, was wir von den Berner Bauern schon
in Bern gern gehört hätten, als sie vor ihren eigenen Herren standen:
wir haben «Bundesgenossen», wir werden an ihrer Seite kämpfen, wir
lassen uns nicht mehr beschimpfen und erniedrigen! Aber das «Gemeine
Mandat» sowohl wie die Kunde von den Zumutungen der Berner Herren
brauchten Zeit, um sich bis in den Kern der Bauernschaft durchzufressen;
oder, um ein besonders hier im Emmental angemessenes,
«sehr nationales Bild» zu gebrauchen, das die damalige Solothurner
Regierung schuf: «Die Rebellion ist wie eine durchfressende Made in
einem Käse, sie frisst um sich»! Und das geht bekanntlich, wie schon
der alte Heusler bemerkte, nicht mit «elektrischer Schnelligkeit». Besonders
nicht bei den Berner Bauern, von denen ein schon damals
hundertjähriges Lied echt bernisch singt:
«Der Bär hatt die natur und art,
Das er fit gabet uff die fart,
Man thue in denn vor stupfen,
Darumm so rupf in nit zu vii,
In trüwen ich dirs raten wil,
Er thuot nit bald erklüpffen.»
Aber nun zeigte sich, dass man den Berner Bären schon «zu vii gerupft»
hatte. Wasers Redseligkeit setzte er ein zwar noch gedämpftes,
aber ein gefährliches, weil nun aus ganz neuer Tiefe kommendes
Brummen entgegen. Was auch Waser in Sumiswald, Trachselwald und
Affoltern, nach seiner eigenen Schreibseligkeit, für «beruhigendes Versprechen»
von Ohrenträgern gehört haben will, so hat doch der luzernische
Herrenchronist zweifellos recht, wenn er davon sagt: «Allein
dieses Versprechen war kaum mehr als ein Täuschungsmittel.» Ueberall
flüsterte man bereits wieder von neuen geheimen Versammlungen,
die entweder schon stattgefunden hatten, oder eben während der «Pacificierung»
Wasers stattfanden, oder demnächst stattfinden sollten,
unbekümmert um das in den «Konzessionen» erlassene strikte Verbot
von Landsgmeinden, das ihnen Waser überall vorlas, und trotz der
«Leibes und Lebens Strafe», die das Badener Mandat nun für jede Art
von «Zusammenrottierung» androhte. Ja, die Bauern sagten es Waser
im Emmental —und auch Salomon Hirzel in Burgdorf, Wynigen und
Herzogenbuchsee, besonders aber in Langenthal —offen auf den Kopf
zu, dass sie ihren Herren kein Tittelchen ihrer Zusicherungen glaubten,
dass sie erst «,Brief und Siegel' über die obrigkeitlichen Bewilligungen
in Händen haben wollten», ehe sie auch nur das Geringste zusicherten.
Das Schlimmste aber für Herrn Waser war: zu gleicher Zeit, da
ihm die Bauern angeblich versicherten, «dass sie der Entlibuecheren
müessig gau wellint», wohnten den neuen Versammlungen der Bauern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 221 - arpa Themen Projekte
zu neuem Abfall von der Regierung aufzustacheln»! Ja, in
Aarburg vernahm Waser gar, «dass bereits zwei Entlebucher Bauern,
sowie zwei aus dem Amte Willisau, worunter der Weibe! von Wykon,
daselbst gewesen waren und berichtet hatten, auf ihre Aufforderung
hin hätten die Oltener bereits geschworen, zum Wolhuser Bund zu
stehen», und die Aarburger hätten ihnen wenigstens zugesagt, «wenn
man möchte understahn wollen, die lutzernischen Underthanen mit
gwalt zu überziehen», so würden sie denselben sofort Nachricht geben
und selbst mit Waffengewalt «den durchzug so viii wie müglich hindern».
«Man wollte also», sagt Peter, «einem allfälligen bewaffneten
Eingreifen der Obrigkeiten direkt entgegenwirken.»
Ja, so weit war man nun wieder. Und das war auch schon nach
Bern gedrungen. Denn als die beiden Hälften der «Ehrengesandtschaft»
sich am 14. April in Aarau noch einmal vereinigten, erhielten sie
von den erschreckten Berner Herren den Bericht, «dass der unguete
Wolhusische underthanenbundt und dessen unguete frucht viel volkh
infiziert», und diese stolzen Herren riefen Waser schon wieder um eine
Tagsatzung an! Der Bär, auf dem sie ritten, und den sie soeben wieder
aufgezäumt zu haben glaubten, zeigte seine Krallen; wie es in dem
alten Bernerlied weiter heisst:
|
«Drum reitz in nit so fast uffs gspor, Er gibt dier ein dopen an ein or, Du wirst wohl daran dencken...» |
Aber der «unguete» Bund, der nun auf einmal im ganzen Bernerland
so «viel volkh infizierte», war nicht mehr nur der «Wolhusische»,
wie die Berner Herren meinten. Das war der neue Bund, den die Entlebucher
gerade während der tiefsten Erniedrigung der Berner Bauern
so bewundernswert hartnäckig propagierten. Und er fasste hier, auf
Bernerboden, umso tiefer Wurzel, je bohrender nun auch hier Zorn
und Scham am Herzen der Erniedrigten und Beleidigten frass.
2.
Die Solothurner schwenken ein, finden keinen Führer — und müssen
auch so durchs Joch!
Gerade als die Luzerner Bauern durch Zwyer und seine «Ehrengesandtschaft»
um ihren ersten Sieg betrogen worden waren — ohne
aber in die Kniee zu gehen —, waren die Berner Bauern in die gemeinsame
Bauernfront aktiv eingeschwenkt. Gerade als die Berner
Bauern durch Waser und seine «Ehrengesandtschaft» nach Bern gelockt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 222 - arpa Themen Projekte
Solothurner und vor allein die Basler Bauern in die Kampffront ein. Aber
auch diese beiden Bauernschaften mussten, nach einem ersten Aufflammen
des Rebellengeistes, zunächst einmal, jede für sich, durch
ein kantonales Joch der Erniedrigung, ehe sich genügender Zorn sammeln
konnte, um dem Streben zur gemeinsamen, überkantonalen Bauernfront
den nötigen Schwung zu verleihen.
Von allem Anfang an ist die Solothurner Bewegung mehr ein Reflex
der Solidarität mit den Bauern der benachbarten Luzerner und Berner
Aemter gewesen als eine urwüchsig selbständige Bewegung. Nicht dass
den Solothurner Bauern der allgemeine Stoff zur Rebellion gefehlt
hätte — sie litten vielmehr an genau denselben wirtschaftlichen und
sozialen Nöten wie ihre Klassengenossen jenseits der Grenze. Aber sie
hatten keine solch offensichtlich provokatorische Regierung wie die
Berner und Luzerner. Ein leiser Hauch von Menschlichkeit, der letzte
Rest eines noch patriarchalischeren Verhältnisses zum Volk, milderte
das Solothurner Junkerregime.
Nichtsdestoweniger war es ein Junkerregime, und zwar ein
schlaues und ein demagogisch bedeutend geschickteres als das der beiden
andern Kantone. Schon am 25. Februar —mithin einen Tag vor
der Beschwörung des Wolhuser Bundes —gab die Solothurner Regierung,
vom Luzerner Rat gewarnt, «ihren Vögten den schriftlichen Auftrag,
ingeheim beim Trunk und bei anderen schicklichen Anlässen zu
erkundigen und zu erfahren, ,was für Reden ihre Angehörigen von
diesem Wesen brauchen'». Dass sie dem Luzerner Rat durch Entsendung
zweier ihrer Räte, des Venners Jakob von Staat und des Gemeinmanns
Urs Gugger, als «Ehrengesandte» nach Werthenstein und Ruswil
zu Willen war, verstand sich von selbst. Zwar gab sie diesen den
«bestimmten Befehl, dass sie nur zu gütlicher Beilegung des Streites
Hand bieten sollen»; aber weder den «gütlichen» noch den «rechtlichen»
Betrug Zwyers haben diese beiden Biedermänner verhindert.
Die gleiche Bewandtnis hatte es mit dem Befehl an die beiden solothurnischen
Abgesandten an die Badener Tagsatzung, von denen, der eine
wieder Urs Gugger war: sie sollen «mit ihrem weisen Verstand jederweilen
uff die Güte schreien, damit, die Waffen zu gebrauchen, hinterhalten
werde». Das hat auch diese beiden nicht daran gehindert, für
das hetzerische und verleumderische «Gemeine Mandat» und für das
provokatorische Rüstungswerk des «Defensionals» zu stimmen.
Nicht viel anders verhält es sich mit der vom guten, alten Dekan
Vock vielgerühmten Frömmigkeit der damaligen Solothurner Regierung.
Denn wenn diese auch durch Ratsbeschluss vom 14. März «das
vierzigstündige Gebet» anordnete, «Gott um Abwendung der Strafe anzurufen»,
so riecht dies doch sehr nach einer Frömmigkeit pro domo,
zur Erhaltung der privilegierten Junkerherrschaft, nicht anders als die
Bussgebete der Herren zu Luzern. Der damalige solothurnische Staatsschreiber
Franz Hafner ist denn auch in seiner endlosen und geschwätzigen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 223 - arpa Themen Projekte
der überzeugtesten Advokaten des Gottesgnadentums der damaligen
Regenten, wenn er dabei auch von «Güte» und «Frömmigkeit» übertrieft.
Dieser Staatsschreiber ist der typische Kleinbürger im Herrenstand,
trunken emporblickend zu allein «Höheren»; darum ist er auch
der wirksamste Verbreiter der abergläubischen Mär von der «grossen
Finsternis der Sonne im martialischen Widder» und dem «gräulichen
Kometen mit dem gestutzen Bart» als «Ursächer» des Bauernkriegs
gewesen. Durch dieses Abschieben auf den Himmel nämlich war die
Schuld am Bauernkrieg am unauffälligsten und am wirkungsvollsten
von den Herren abgewälzt. Man sollte es kaum glauben, aber es ist
historische Tatsache, dass dieser «wackere Staatsschreiber» unter den
«Gebildeten» der ganzen Schweiz damals als besondere «Leuchte der
Bildung» galt, ein Mann, der von den beiden genannten Himmelserscheinungen
mit «wissenschaftlichem» Ernste schrieb: «Die Wirkung
beider erstbedeutender Zeichen hat sich unlang hernach mit der Bauten
Aufstand in der Eydtgenossenschaft herfür getan»!
Immerhin ist es anerkennenswert konsequent seitens einer von
dieser Ueberzeugung geleiteten Regierung, dass sie alsdann auch die
Bauern für weniger schuldig hielt und diese nach Möglichkeit danach
behandelte. Diese um eine Nuance sanftere Tonart des Solothurner Regiments
im Verkehr mit seinem Volk hat genügt, um die Solothurner
Regierung bei den draufgängerischeren Junkern von Zürich, Basel und
namentlich von Bern sogar in den Verdacht zu bringen, im geheimen
Einverständnis mit den Bauern zu stehen, sodass sich Urs Gugger vor
der Tagsatzung gegen diesen Verdacht ausdrücklich verwahren musste.
Aber es war ein wirklich gänzlich unbegründeter Verdacht.
Das zeigte sich schon in der Art, wie sich die Solothurner Herren
schützend vor Zwyer und seine «Ehrengesandtschaft» stellten. Zwei
Luzerner Bauern wurden in Olten nur deshalb ins Gefängnis geworfen,
weil sie leugneten, «dass den Eidgenössischen Ehrengesandten zu Russwil
irgend eine Schmach begegnet sei». Sie wurden zwar bald wieder
entlassen, aber —auf Ratsbeschluss vom 21. März — «mit der Anzeige,
dass wenn man ihnen deswegen den Kopf zwischen die Beine gelegt
hätte, ihnen der verdiente Lohn gegeben worden wäre»!
Die Solothurner Regierung war auch keineswegs faul im Unterdrücken
von Volksbewegungen und von allein Anfang an lieh sie ihre
Truppen zu diesem Zweck bereitwillig auch den Landvögten der angrenzenden
bernischen Aemter aus. Unter dem Vorwand des Schutzes
gegen bernische und luzernische Aufwiegler liess sie am 23. März plötzlich
die eigene Stadt Olten besetzen, und zwar durch die Truppen des
eigens dazu aufgestellten Kriegskommandanten Hauptmann Daniel Gibeli.
Das erregte einen heftigen Aufruhr der Oltener Bürger, die gar
nicht vor den Luzerner und Berner Bauern geschützt sein wollten, da
sie ja vielmehr mit diesen bereits heimlich verhandelten, um ihre eigene
Freiheit gegen die Solothurner Junker zu verteidigen. Als nun noch
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 224 - arpa Themen Projekte
Johann Rudolf Wettstein
Bürgermeister von Basel,
"Vermittler" im Thuner Handel (1641), eidgenössischer "Friedensgesandter"
auf dem westphälischen Friedenskongress (1846-48),
absolutistischer Scharfmacher im Bauernkrieg.
Nach einem späteren Originalstich von J. J. Hald in der Graphischen
Sammlung der Zentralbibliothek in Zürich (nach einem
Gemälde von F. Schellenberg).
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 224 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 225 - arpa Themen Projekte
zwei Herrendiener aus dem bernischen Aarburg herüberkamen —Hans
Jakob Suter, der Falkenwirt zu Aarburg, sowie der Hauptmann Jakob
Anton Weyermann, Bürger von Bern —, um von Gibeli Hilfstruppen
zur Unterdrückung der aufrührerischen Bürgerschaft von Aarburg auszuleihen,
da eilten die Oltener Bürger unter Führung des Mondwirtes
Hans Jakob von Arx und des aus dem Entlebuch stammenden Oltener
Hammerschmieds Balthasar Marbacher zu den Waffen, fingen und
banden die beiden Berner Herrendiener und lieferten sie gefesselt den
Aarburgern aus. Dies geschah derart spontan und mit solcher Uebermacht,
dass Gibeli und seine Truppen dem Geschehen völlig machtlos
gegenüberstanden und unverrichteter Dinge abziehen mussten. Dies
auch deshalb, weil die Truppen Gibelis Solothurner Bürger waren, die
zum Teil mit den Oltener Bürgern sympathisierten und deshalb den
Befehlen des Kommandanten passiven Widerstand leisteten.
Dieses Verhalten der Stadtbürger-Truppen von Solothurn —welches
Verhalten beweist, dass es in dieser Stadt eine progressive Bürgerklasse
gab, die sich mit der Herrenklasse nicht identifizierte —wiederholte
sich innert weniger Tage noch zweimal und steigerte sich bis zur
offenen Meuterei. Vock berichtet: «Als am 28. März eine Abteilung derselben
von 50 Mann, Stadtbürgern von Solothurn, auf Verlangen der
Bernischen Behörden, unter Hauptmann Wilhelm Grimm nach Aarburg
zu Hilfe ziehen sollte, versagten die Truppen den Gehorsam, lösten
sich auf und eilten nach Hause. Das Nämliche taten 50 Soldaten aus
der Stadt Solothurn, welche unter Hauptmann Urs von Arx als Hilfstruppen
ins Schloss Aarwangen geschickt wurden. Dort eingetroffen,
haben sie sich gegen ihren Hauptmann und den Landvogt Willading
in Worten und in Taten so benommen, dass dieser froh war, sie wieder
entlassen zu können.» Dass eine Regierung, die nur über solche Truppen
verfügte, auch gegen ihre Neigung schliesslich lernte, Samthandschuhe
anzulegen, um mit dem Volke zu verhandeln, ist mehr als begreiflich
und braucht nicht von einem besonderen «Edelmut» abgeleitet
zu werden, wie der Solothurner Stiftsdekan Vock unentwegt bemüht ist.
Zu derselben Zeit, als die beiden eben angeführten kleinen Meutereien
sich ereigneten, war das gesamte Solothurner Volk —gleichzeitig
mit dem der benachbarten Gebiete des ganzen Ober- und Unteraargaus
und der Basler Landschaft —in höchste Aufregung versetzt worden
durch die Angst vor dem Einmarsch fremder Truppen. Und zwar war
es jener fatale Marsch der Basler Herrentruppen über den Jura nach
Aarau, der am 28. März zur Besetzung dieser Stadt führte, was die gesamte
Bevölkerung des Mittellandes, die solothurnische inbegriffen,
in stürmische Bewegung und zum Teil sogar zur bewaffneten Empörung
brachte. Daran beteiligte sich nicht nur ein wahres Meer
von Bauern, sondern, von diesem getragen und mit fortgerissen, auch
die ganze Stadtbevölkerung der zahlreichen kleineren Städte dieser
Gegend, ohne Rücksicht auf die Kantonsgrenzen. So eilten beispielsweise
die bernischen Aarburger Bürger am 29. den solothurnischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 226 - arpa Themen Projekte
und vereinigten sich mit ihnen auf den Strassen und Plätzen Oltens
in Szenen von wahrhaft frenetischer Verbrüderung. Dabei ist bemerkenswert,
dass, wie im Luzernischen, die katholische Geistlichkeit zum
Teil leidenschaftlich für die Sache der Bauern und des Volkes überhaupt
Partei ergriff. So beispielsweise der Stadtpfarrer von Olten,
Balthasar Junker, ein Solothurner Stadtbürger, gegen den deshalb die
Solothurner Herren, die wirklichen Junker, später beim Bischof von
Basel (der in Pruntrut residierte) einen Prozess zwecks Absetzung des
mutigen Pfarres anhängig machten. Die Absetzung scheint ihnen aber
nicht geglückt zu sein; denn später, nach 1653, taucht Balthasar Junker
sogar als Stadtpfarrer der Stadt Solothurn selbst wieder auf.
Ueberall also im Kanton Solothurn, bei den städtischen Kleinbürgern
wie bei den Landleuten, «entstand ein Wetteifer» — wie Vock
sagt — «die grosse vaterländische Sache, wie sie meinten, nach Kräften
zu fördern. Der Untervogt von Dulliken, Kaspar Meyer, liess auf Boten
und Briefe der Regierung lauern und behielt dieselben zurück... Der
Untervogt von Däniken versammelte die Gemeinde und befahl, dass
wer mit Bauern es halte, mit dem Finger in einen auf den Tisch gestellten
Teller tupfen solle; wer sich dessen weigerte, dem wurde gedroht,
dass man ihn mit Weib und Kindern aus dem Lande vertreiben,
oder ihm Ohren und Nase abhauen werde... Michael Schwendimann
Kronenwirt in Schönenwerd, verlegte sich nicht minder tätig als der
Untervogt von Dulliken auf das Einfangen oberkeitlicher Boten und
Briefe; wer ihm verdächtig schien oder nicht gehorchen wollte, den
liess er in einen Stall einsperren. Aehnliches ging in andern Gemeinden
vor...» Und es ist in der Tat richtig, was Vock von solchen Vorkommnissen
im Solothurnischen sagt: «in dergleichen kleinen, ungeachtet
ihrer lächerlichen Form ernsten und bedeutsamen Zügen offenbarte
sich die Gesinnung und Gemütsart des Volkes...»
Am 31. März fand in Olten eine bedeutende Versammlung von Ausgeschossenen
rebellischer Gemeinden aus fast allen Solothurner Vogteien
statt —aber auch Ausschüsse aus der Basler Landschaft waren
dabei, wie z. B. Joggi Buser, der Sonnenwirt von Bukten, mit fünf andern
Basler Bauern —, und zwar zu dem Zweck, um eine grosse Landsgemeinde
derselben für die nächstfolgenden Tage nach Oberbuchsiten
einzuberufen, die denn auch bereits am 3. April zustandekam. Zu demselben
Zweck, wie es scheint, hielten auch die drei Jura-Vogteien Dorneck,
Gilgenberg und Thierstein am 1. April in Hochwald eine Landsgemeinde
ab.
Schon am Ersten aber verbreitete sich, gewiss als Folge des Auftretens
einiger revolutionärer Kräfte auf der Oltener Versammlung, das
Gerücht, «dass die Bauern... das Schloss in der Klus überrumpeln
werden, um sich Pulver und Waffen zu verschaffen». Das jagte die
Regierung so in Schrecken, dass sie dem Kommandanten in der Klus
sofort —schon am 1. April —den Befehl gab, «den Bauern etwas Pulver,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 227 - arpa Themen Projekte
damit dieselben den bösen Argwohn und das Misstrauen gegen die
Obrigkeit einmal ablegen». Da hat die Angst die Herren demagogisch
sehr klug gemacht. Angst wie Klugheit waren in ihrer militärischen
Schwäche begründet. Hintenherum allerdings haben sie «einen der
Hauptanstifter», welcher «mit den Rebellen zu Reiden (d. h. mit den
aufständischen Luzerner Bauern!) Briefe wechselte», Balthasar Marbacher,
den Hammerschmied von Olten, aber geborenen Entlebucher,
vorsorglich verhaftet «und durch die Klus, über die Schmidenmatte
und auf anderen sicheren Abwegen» nach Solothurn abgeführt. Von
einem Versuch der Rebellen, diesen ihren Führer wieder frei zu bekommen,
oder auch nur von einer Beschwerde über diese Gewalttat,
hören wir nichts, auch nicht auf der nun folgenden Landsgemeinde
zu Oberbuchsiten.
Inzwischen nämlich scheint das doppelzüngige Eingreifen des
Oltener Stadtschreibers, der an der Oltener Versammlung teilgenommen
hatte, den Charakter dieser Landsgemeinde im voraus korrumpiert
und sabotiert zu haben — oder aber die Oltener Versammlung
hat sich von ihm wirklich übertölpeln lassen. Er avisierte nicht
nur schleunigst die Solothurner Regierung von dem Vorhaben, sondern
lud diese, angeblich «im Namen der daselbst (in Olten) versammelten
Landesausgeschossenen», sogar ein, eine Ratsdeputation zu «einer Konferenz
und freundlichen Besprechung» nach Oberbuchsiten zu schicken,
«zu gegenseitiger Ausgleichung der streitigen Artikel». Diese Ratsdeputation,
bestehend aus dem «Gemeinmann» Urs Gugger und dem Ratsherrn
Zur Matten, erhielt von der Regierung am 2. April die Vollmacht,
der «Landsgemeinde» — die nun zu einer «Konferenz» mit der Regierung
gemacht war — «den freien Salzkauf und die unverzögerte Aufhebung
des Trattengeldes » zuzusichern, sowie dazu die Instruktion:
«Ehester Tage soll es geschehen, damit die Unterthanen abnehmen
können, dass auch Ihro Gnaden (die Regierung) Dero Stand und Amt
keineswegs mit Tyrannei zu stabilisieren gesinnt seien.» Das war wiederum
demagogisch sehr schlau und erreichte seinen Zweck vollkommen.
Kurzum: die «Landsgemeinde» zu Oberbuchsiten vom 3. April
wurde zu einer reinen Kapitulanten-Angelegenheit. «Die Landleute waren
mit den Anerbietungen der Regierung vollkommen zufrieden und
sie baten die Ratsabgeordneten um die Erlaubnis, persönlich die neue
Versicherung ihres Gehorsams und ihrer Treue gegen die Regierung
in einer Audienz vor Rat ablegen zu dürfen, wofür ihnen auch die beiden
Ratsdeputierten ihre Verwendung bei der Regierung verhiessen.»
Diese Demütigung fand genau am Tag des Kniefalls der Emmentaler
Bauern vor den Berner Herren, am 4. April, in Solothurn statt. Nach
einem Schreiben des Rats, das dieser noch am selben Tag triumphierend
an sämtliche Landvögte schicken konnte, baten die vor den
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 228 - arpa Themen Projekte
der verschiedenen Vogteien» «vorerst die Regierung um Verzeihung
für alles, wodurch das Volk in der grossen Verwirrung die der
Obrigkeit schuldige Pflicht verletzt haben möchte; sie erklärten dabei,
dass die heimliche Sendung der Truppen, des Nachts und auf Abwegen,
nach Aarburg das Landvolk zum Unwillen aufgereizt und im
Misstrauen bestärkt habe, dass die Boten und Briefe der Regierung,
zwar meistens ohne Geheiss und bloss von einzelnen Personen, aber
deswegen aufgefangen und zurückbehalten wurden, weil das Gerücht
umlief, dass fremde Truppen heranrücken und alle Dörfer in Brand
gesteckt werden sollen. Schliesslich versicherten sie die Regierung
neuerdings ihrer treuen Anhänglichkeit und des unverbrüderlichen Gehorsams
für die Zukunft.»
Einen Führer von Format haben weder die Solothurner Bauern
noch die Oltener Bürger hervorgebracht, nicht nur in diesem Anfangsstadium
nicht, sondern überhaupt keinen. Der Schälismüller Adam Zeltner,
Untervogt zu Niederbuchsiten, der gewöhnlich nur deshalb als
solcher angeführt wird, weil schliesslich auch er dem Henkerbeil des
eidgenössischen Blutgerichts in Zofingen verfiel, ist von Anfang an ein
Kapitulant gewesen, und er ist es, trotz späteren Schwankungen, immer
geblieben. Diesen —wie Vock sagt — «ehrlichen, seiner Regierung getreuen
und vom Strome der allgemeinen Verwirrung nur auf Augenblicke
hingerissenen Untervogt» hat die Solothurner Regierung bereits
durch hochoffizielles Schreiben vom 22. März an Zeltners Landvogt
Petermann Sury zu Bechburg folgendermassen belobigt: «In geheimer
Relation... haben Wir mit höchstem Wohlgefallen vernommen, was
Gestalten sich Adam Zeltner, Untervogt auf Schälismühle, dergestalten
verhalten, dass er nicht allein den Brief, so ein Bote von den rebellischen
und aufrührerischen Luzernischen Unterthanen ihm einhändigen wollte,
nicht annehmen wollen, sondern demselben seinen rechten Namen gegeben
und mit stark zugesprochenen Worten hinweg und fortgemahnt,
und er, Untervogt, die Aufrichtigkeit, wie es einem Unteramtmann
recht und wohl ansteht, gegen seine Obrigkeit zu erzeigen, gethan und
verrichtet hat. Desshalb haben Wir Ursache genommen, solches aus
unseren Gedanken nicht auszuschlagen und ihn und die Seinigen inskünftig
im Besten zu bedenken...» «Dieses ihr Versprechen», fügt
Vock hinzu, «erfüllte die Regierung treulich, als Adam Zeltner zu Zofingen
in Todesnot schwebte, und dass sie ihn, aller Fürbitten ungeachtet,
nicht retten konnte, bedauerte sie mit lebhaften Schmerzen...»
Wozu nur bemerkt werden muss, dass doch eben sie es war, die den
ihr als völlig unschuldig, ja als treuer Herrendiener bekannten Adam
Zeltner einzig «um des lieben Friedens mit den Miteidgenossen willen»
dem sturen Blutdurst des Zwyer-Werdmüller-von Erlach'schen Rachegerichts
ans Messer geliefert hat —ob nun mit oder ohne fromme Hafnersche
Herzbeschwerden!...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 229 - arpa Themen Projekte
Wenn man alles treugläubig für bare Münze nehmen wollte, was
die Solothurner Regierung selbst —und mit ihr alle Herrenchronisten
jener und unserer Zeit —über die Verbrüderung zwischen ihr und den
Solothurner Bauern und Bürgern zu Beginn des Aprils zu salbadern für
gut fand, so wäre für Solothurn der Bauernkrieg hier zuende gewesen.
Aber in Tat und Wahrheit sind an alledem die wirklichen Revolutionäre,
die es auch im Solothurnischen gab, überhaupt nicht beteiligt gewesen.
Diese waren vielmehr gerade in diesen Tagen. der geglückten
Diversion der Herren in Olten und Oberbuchsiten und der schafsfrommen
Kapitulation der Bauern vor dem Rat in Solothurn auf ganz anderen
Wegen zu finden: sie organisierten eben mit den Willisauern
und den Entlebuchern zusammen die definitive Aufnahme der Stadt
Olten in den grossen Bauernbund, und sie liefen bei Tag und bei Nacht
über den Jura in die Basler Landschaft, bauten auf den Pässen und
den Bergrücken des Juras das System der Hochwachten und des Signaldienstes
auf und schufen so die feste revolutionäre Verbindung zwischen
der inneren und der äusseren Schweiz.
3.
Die Basler Landschäftler brennen ihren Führern durch und
galoppieren durchs Joch in die Rebellion!
Am 3. April, am gleichen Tag, als die in Oberbuchsiten zu einer
allgemeinen solothurnischen Landsgemeinde versammelten Bauern
sich so widerstandslos über den Löffel halbieren liessen, bekam der
Rat der Dreizehn — die sogenannten «Herren XIII» —, d. h. die Regierung
von Basel, einen alarmierenden Bericht aus der Basler Landschaft,
der mit einem Schlage aufdeckte, wie weit dort die Sache
der Bauern bereits gediehen war und wie innig sie mit der Bauernbewegung
südlich des Jura zusammenhing. «Alle Dörfer seien mit Bauerngesandten
aus Bern und Solothurn überloffen, und man drohe mit
Häuseranzünden», so hiess es in diesem Bericht eines Herrendieners an
die Herren XIII, der uns enthüllt, wo wir die wirklichen Revolutionäre
der gerade in diesen ersten Apriltagen so tief gedemütigten Berner und
Solothurner Bauern während dieser Zeit zu suchen haben. Sie hatten
die Illusion, sich mit den eigenen Herren innerhalb der Kantonsgrenzen
«verständigen» zu können, bereits im voraus aufgegeben und hatten
sich darum umso eifriger zu wandernden Verkündern und fieberhaften
Baumeistern des zu errichtenden Bundes gemacht, der über alle Kantonsgrenzen
hinausgreifen sollte.
Dass aber die Berner und Solothurner revolutionären Bauern und
Bürger —denn es taten sich dabei besonders auch Oltener Bürger hervor
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 230 - arpa Themen Projekte
entfalteten, um die Basler Bauern und Bürger (nämlich die Stadtbürger
von Liestal) zum Aufstand gegen die Basler Herren und zum Anschluss
an den allgemeinen Bauernbund anzufeuern: das hatte einen
ganz besonderen konkreten und überkantonalen Grund. Dieser Grund
bestand in der Tatsache, dass gerade die Basler Regierung es war, die
in der Ausführung der bauernfeindlichen Tagsatzungsbeschlüsse, des
«Defensionals», mit dem grotesken Ausmarsch ihrer Truppen nach
Aarau in den Tagen vom 26.-29. März, den Vogel abschoss. Die erste
Aktion der Basler Regierung im Bauernkrieg war sofort eine überlokale,
eine eidgenössische. Das erklärt die provokatorische Wirkung derselben
auf die Bauernschaft der andern Kantone und deren expansive
Rückwirkung auf die Bauernschaft des Basellandes.
Doch sehen wir uns im Baselbiet zunächst ein wenig um. Hier war
bis zur Badener Tagsatzung alles ruhig geblieben. Zwar machten die Berner
Herren die Basler Herren bereits durch ein Schreiben vom 27. Februar,
also vom Tag nach der Beschwörung des Wolhuserbundes, mobil.
Auch ihnen schrieben sie, wie den Zürcher Herren: «es könnte leicht
im gemeinsamen lieben Vaterlande ein böses Feuer angezündet werden,
daher Basel ein getreues Aufsehen auf den ihm nächst angränzenden
Stand Bern haben, auch ihm melden möchte, in was Anzahl Volkes
(Kriegsvolkes) es sich von ihm versichert halten könnte». Aber die
Basler Herren wichen in ihrer Antwort vom 1. März vorsichtig jeder
Festlegung einer bestimmten Zuzugsverpflichtung aus, «weil man
nicht wisse, wo das Wetter sich hinziehen werde». Man hatte also
noch keinen konkreten Begriff von der Gefahr; sie brannte ihnen
nicht auf dem eigenen Leibe. Zwar beschloss man die vorsorgliche
Ergänzung der «auf der Landschaft zum ersten Auszuge ausgelegten
Musketiere»; und, was für die Rolle der protestantischen Geistlichkeit
in Basel im selben Sinne charakteristisch ist wie in Bern: man
beschloss, «mit Herrn Antistite (d. h. mit dem Oberhaupt der Basler
Kirche) zu reden, den Herren Decanis (d. h. den Oberprädikanten) auf
der Landschaft zu schreiben, die Unterthanen zum Gehorsam zu ermahnen».
Und am 15. wurde, gleichzeitig mit der Delegierung der Gesandten
für die Badener Tagsatzung, vorsorglich beschlossen, «folgenden
Tags die Bürgerschaft auf allen Zünften aufzufordern, sich mit
Wehr gefasst zu halten; den Obervögten wurde befohlen, Achtung zu
geben auf verdächtige Personen, welche anheizen, wie auch auf die,
so sich movieren wollten». Aber alle diese Anordnungen beruhten auf
keinerlei irgend feststellbarer Bewegung unter den Basler Bauern; es
waren blosse Reflexe der Solidarität mit dem Herrenregiment in den
anderen Kantonen. Und die Basler Herren fühlten sich ihren eigenen
Untertanen gegenüber noch während der Tagsatzung im März so
sicher, dass ihre dortigen Gesandten, der grossmächtige Bürgermeister
Johann Rudolf Wettstein und der Zeugherr Johann Heinrich Falkner,
in ihren Berichten an die «Herren XIII» in Basel von den Unruhen im
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 231 - arpa Themen Projekte
fremden Völkern reden, ungefähr so wie der «Andere Bürger» im
Osterspaziergang des «Faust»
«... von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten weit, in der Türkei,
Die Völker aufeinanderschlagen.»
\Vorauf ihm der «Dritte Bürger» antwortet:
Sie mögen sich die Köpfe spalten,
Mag alles durcheinandergehn;
Doch nur zu Hause bleib's beim Alten.»
Das hinderte allerdings keineswegs, dass die beiden Basler Tagsatzungsgesandten
schon aus Prinzip in dasselbe Horn der Ehrabschneidung
und der Gewaltanwendung gegenüber den Bauern stiessen
wie Waser, Werdmüller, Zwyer, von Graffenried und alle übrigen Bauernfresser
des Badener Herrenbundes. Besonders Wettstein war dies
schon seiner Vergangenheit schuldig, als ehemaliger «Ehrengesandter»
im «Thuner Handel» von 1641, wo er, der damalige Basler Oberstzunftmeister,
mit Salomon Hirzel zusammen führend dazu beitrug, die
Oberländer und Emmentaler Bauern vor den Berner Junkern auf die
Kniee zu werfen. Aber überhaupt strahlte dieser Herr Wettstein im
Glorienschein europäischen Ruhmes als der Repräsentant des neuen,
absolutistischen Herrenregimes der Eidgenossenschaft: er hatte den
Westfälischen Frieden anno 1648 für die Schweiz unterschrieben und
hatte von dort die «Souveränität» der «Eidgenossenschaft», d. h. des
damaligen Badener Herrenbundes, heimgebracht. Denn diese «Souveränität»
deuteten die regierenden Herren hierzulande —nach dem
Muster des französischen Königtums —sofort einmütig als die absolute
Unabhängigkeit ihrer Regierung noch innen, dem eigenen Volk gegenüber,
als Heiligsprechung ihrer Privilegien durch das Gottesgnadentum,
und als «rechtliche» Grundlage dafür, nicht nur jedes Mitspracherecht
des Volkes auszuschalten (das war längst geschehen), sondern auch
jedes Verlangen danach als «Hochverrat» und «Rebellion» zu brandmarken
und als solche mit dem Tode zu bestrafen!...
Man kann sich leicht denken, welch ein kostbarer Zuzug dieser
Herr Wettstein für die Herrensache im Bauernkrieg bedeutete. Wettstein
war in diesem Jahr ein Neunundfünfziger und stand auf dem
Gipfel seiner Macht und seines Ruhmes. Das hatte sich der jüngste
Sohn von fünfen des aus Russikon im Zürcher Oberland nach Basel
zugewanderten Spitalmeisters Jakob Wettstein ehemals gewiss nicht
träumen lassen, dass er sich einmal derart in Ruhm, Glanz, Macht und
Reichtum werde baden können. Aber er hatte das Glück — oder die
kluge Berechnung —, schon mit 17 Jahren eine geborene Falkner als
Frau zu erwischen, die, wenn sie auch um viele Jahre älter war als er,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 232 - arpa Themen Projekte
anzugehören. Ein Schwager von derselben Qualität, ein Emanuel
Socin, war es denn auch, der ihn als «Locotenent» nach Bergamo und
Venedig anwarb. Schon hoffte er, seine Karriere als Kaufmann ganz in
der Fremde zu machen und wollte sich von seiner Frau scheiden lassen
und sie samt Kindern für immer verlassen. Da beschwor ihn seine 73jährige
Mutter brieflich zur Heimkehr. In Basel war und blieb er dann der
Mann der Anna Marie Falkner und hatte anno 1635 neun Kinder von
ihr. Zuerst, anno 1617, machte er in der Vorstadt St. Elisabethen eine
«Schreibstube» auf, d. h. eine Advokatur. Aber die Rebleutenzunft
machte ihn, dank der hohen Verwandtschaften seiner Frau, bald zum
Ratsherrn. Als solcher stürzte er sich besonders in das Münz- und
Finanzwesen der Stadt und hatte darin grosse Erfolge; er wird z. B.
als Münzsachverständiger auf eine eidgenössische Münzkonferenz in
Zürich geschickt. 1624 wird er Landvogt im Amte Farnsburg, und das
war das reichste und ergiebigste aller Basler Aemter, das «kommlichste»,
um rasch reich zu werden: es zählte 28 Gemeinden, während
Waldenburg nur 17, Homburg 7, Münchenstein 6 zählte, Ramstein gar
eine einzige Gemeinde, nämlich Bretzwil (das dafür den geistigen Führer
der ganzen Basler Bauernbewegung,. Isaak Bowe, hervorbrachte).
1626 wird Wettstein Obervogt in Riehen bei Basel, und als solcher bezieht
er den vornehmen Falkensteiner Hof in Basel. Jetzt ist Wettstein,
der typische Repräsentant des Basler Handelskapitals, als Emporkömmling
endgültig in die Hochburg der Privilegierten eingedrungen.
1635 wird er Oberstzunftmeister, eine Handel und Gewerbe fast monarchisch
beherrschende Stellung, um 1645 endlich den Gipfel der lokalen
Macht, den Bürgermeisterstuhl, zu erklimmen.
Aber «auch die Wertschätzung der Eidgenossen wurde», wie ein
Biograph bemerkt, «immer grösser, als es ihm 1641 gelang, die Berner
Bauern, die es in Thun zum offenen Aufruhr hatten kommen lassen,
zum fussfälligen Widerruf in der Kirche und zum Gehorsam gegenüber
der Stadt zu bringen». Wir wissen, welche «Eidgenossen» damit allein
gemeint sein können! Diese sandten Wettstein denn auch 1646 als
«Friedensgesandten» nach Westfalen, wo er zwei Jahre hindurch
Ausserordentliches leistete und nebenbei das Leben und den Luxus der
«grossen Welt» Europas studieren und kopieren lernen konnte. Vierzigmal
ist Wettstein Gesandter auf eidgenössischen evangelischen Konferenzen
gewesen denn er war ein höchst kirchlich religiöser
Mann —, einhundertzwölfmal Gesandter auf Tagsatzungen!
Zu der Zeit, wo wir ihm nun begegnen, ist Wettstein auf das
innigste mit dem um fünf Jahre älteren Urner Oberst und kaiserlichen
Generalfeldmarschall Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach befreundet,
der katholischen Hauptstütze des gemeinsamen eidgenössischen
Herrenregiments, wie Wettstein dessen hauptsächlichste protestantische
Stütze neben dem Zürcher Bürgermeister Johann Rudolf Waser
war. Zwyer war, nach seinem geradezu fürstlichen Abenteuerleben im
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 233 - arpa Themen Projekte
Statthalter von Uri geworden, in dem Wettstein zum Bürgermeister
von Basel erhoben worden war. Und von da an war er unbestritten der
erste Agent des Kaisers in der Schweiz, der grosse Dublonenverteiler
für alle Pensionenempfänger der kaiserlich-habsburgisch-spanischen
Partei in der «Eidgenossenschaft».
Die zwei aktiven Pole der gesamten ökonomischen Existenz der
damaligen Herrenklasse der Schweiz hatten sich in Zwyer und Wettstein
—unbeschadet ihrer verschiedenen Konfession —gefunden: das
geschichtlich ältere und darum seinem Ursprung nach katholisch-feudale
Söldnerkapitel (das inzwischen allerdings längst «überkonfessionell»
geworden war!) und das geschichtlich neuere und darum vorwiegend
protestantisch-absolutistische Handelskapital. Zwischen diesen
beiden Mächtepolen der Zeit musste die letzte, wenn auch noch
so stark aufflammende Selbständigkeitsbewegung des eigentlichen
Schweizervolkes, ob Bauer oder Bürger, unweigerlich zermalmt werden.
Denn unser Volk war damals längst zum blossen ökonomischen
Objekt dieser beiden Mächte geworden, ohne deren «Gnade» es zu
existieren aufhören musste...
Doch kehren wir zu der Basler Geschichte zurück. Es ist eine
winzige und jetzt vorläufig noch eher possierliche als gefährliche Geschichte.
Sie wird ihre Krallen aber später schon zeigen.
Lief da im Baselland während der Tagsatzung im März geschäftig
ein alter, gesträubter Landsknecht umher und warb gegen Wartegeld
eifrig Soldaten für die Herren in Basel. Hans Jakob Zörnlin hiess er,
und wie ihm das Geschick des Zufalls einen diminutiven Namen gab.
so war er nur eine winzige Taschenausgabe des Söldnertyps à la Zwyer.
Hier aber im Dienste des Handelskapitals, d. h. Wettsteins und seiner
Konsorten. Zwar war er Oberst, Meister der Schlüsselzunft, ja sogar
Basler Ratsmitglied — aber nur weil man ihn so besser brauchen
konnte. Auch er war in fremden Diensten gewesen: schon 1616 Hauptmann
im venetianischen Dienst (also nun schon ein graues Haupt).
1623 Stadthauptmann von St. Gallen. 1630 aber Kommandant seiner
Heimatstadt Basel. Er wurde später sogar einmal, bei Errichtung des
eidgenössischen «Defensionals» von 1647, Kommandant der eidgenössischen
Artillerie. Inzwischen war er allerdings Landvogt vom Homburg
und Waldenburg gewesen —und das war hier genau so wie in Bern
und in Luzern das Mittel, durch Bauernschinderei rasch reich zu
werden.
Denn die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Baselland
waren nur lokal verschieden von den andern Bauerngegenden der
Schweiz. Generell herrschte dort genau dieselbe Aussaugung der Bauern
bis aufs Blut wie nur irgendwo in dieser Herren-«Eidgenossenschaft».
Zwar lag dies nach der Meinung des konservativen Basler Herrenchronisten
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Andreas Heuslers,
des Geschichtschreibers des Basler Anteils am Bauernkrieg. «in
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 234 - arpa Themen Projekte
fort: «namentlich gehört dahin die Anweisung der Oberbeamten
auf einen Teil der von ihnen ausgesprochenen Bussen» (was wahrlich
sehr milde ausgedrückt ist!), «was umso leichter zu schweren Missbräuchen
führte, als die Kontrolle über die Beamten eine höchst mangelhafte
war». Heusler gibt dann ein anerkennenswert gewissenhaftes,
rein formal finanzgeschichtlich (ohne jede soziale Note) bis in alle
Einzelheiten ausgeführtes Bild von den Bereicherungsmöglichkeiten
der damaligen Basler Vögte und sagt zusammenfassend: «Die Rechnungen
der Obervögte beschlagen lange nicht die gesamte Einnahme aus
ihren Bezirken.» Und dies zwar hauptsächlich deshalb, «weil manche
Leistung den Beamten direkt zukam und daher sowenig als die Dienste,
wozu die Leute verpflichtet waren, in den Rechnungen erscheint».
<Mit diesen Geldrechnungen verbunden sind dann die Fruchtrechnungen,
namentlich von Zehntgefällen, welche jedoch keineswegs als Hoheitssache
betrachtet wurden, sondern als Gegenstand des Privateigentums...»
«Die in diesen Rechnungen vorkommenden Einnahmen» (gemeint
sind die, welche die Vögte nur zum Teil für die Obrigkeit verrechneten,
zum andern Teil aber als «Privateigentum» einfach einstecken
durften! So ausser den endlosen Bussen z. B. nicht weniger als
48 Sorten verschiedener, noch aus dem Mittelalter stammender Leibeigenschafts-Abgaben,
die noch bis zum Zusammenbruch von 1798 zur
Plünderung des Volkes und zur Anhäufung der Herrenvermögen dienten!)
—diese Einnahmen also «waren jedoch nur der geringere Teil
dessen, was die Obrigkeit aus der Landschaft bezog. In denselben erscheinen
weder das Weinumgeld, noch das Metzgerumgeld, noch der
Salzertrag, noch die Soldatengelder...» Diese letztgenannten Steuern gehörten
alle von rechtswegen ungeschmälert der Regierung. Wie sich
aber auch bei diesen Abgaben die Landvögte einzuschalten wussten,
um den Ausbeutungsgewinn am Volke für sich selbst abzuzapfen, dafür
möge uns ein einziges Beispiel, das Salz, den Beweis liefern.
Der Salzverkauf war auch in Basel, wie in Bern und Luzern, Regierungsmonopol.
Wie dort konnten auch in Basel die Herren den Salzpreis
beliebig festsetzen, und sie schraubten ihn umso höher hinauf,
je grösser die Löcher in der Staatskasse waren. Ausserdem verkauften
sie das Salz den Bauern teurer als den Stadtbürgern. Die Salzfrage
spielte aber im Baselland unter den realen Ursachen zum Bauernkrieg
eine weit grössere Rolle als in Bern oder Luzern. Und dies zwar aus
folgenden Gründen. Wo es Monopole gibt, da blühen der Schmuggel
und der Schleichhandel, die natürlich den Gewinn am Monopol herabsetzen.
Gegen den Salzschmuggel und den Schleichhandel in Salz nun
hatten die Basler Herren gerade im Jahr vor dem Krieg, anno 1652,
eine Generaloffensive eröffnet, die ihrerseits zu einer ergiebigen Geldquelle
wurde: es wurden unerhört strenge «Salzbussen» verordnet,
Geldstrafen für jede Umgehung des «obrigkeitlichen Salzkastens», d. h.
für Salzkäufe bei Schmugglern und Schleichhändlern. Diese Bussen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 235 - arpa Themen Projekte
Bussbeträge gehörte ihnen «legal», d. h. wurde ihnen von der Regierung
überlassen. Das wurde für alle Landvögte der Ansporn zu einem
wahren Beutezug und schien auch für die Regierung die beste Garantie,
aus den Salzbussen ein gutes Geschäft herauszuholen. Aber die Habgier
der Landvögte war noch weit grösser, als die Regierung sie eingeschätzt
hatte. Sie verrechneten zwar derselben eine gewisse Anzahl
Bussen, von denen sie die Hälfte «legal» einstecken durften; die weitaus
grössere Zahl der Bussen aber unterschlugen sie der Regierung
gänzlich und steckten deren vollen Betrag ein! Die so erschwindelten
Beträge erreichten je nach den verschiedenen Fällen das zehn- bis
fünfzigfache und noch weit mehr der der Regierung verrechneten Beträge.
Heusler gibt Zahlen darüber. So verrechnete der Vogt von Homburg
im Jahr 1652 nur 88 Pfund für Salzbussen, von denen er also
44 Pfund einstecken durfte. Bei den Beschwerden der Bauern vor einer
Ratsdeputation während des Bauernkriegs kam der Schwindel heraus:
die Bauern rechneten, dem Landvogt ins Gesicht, vor, dass dessen Salzbussen
sich pro 1652 «auf vieltausend Pfund» beliefen! Der Vogt von
Farnsburg verrechnete 1020, der von Waldenburg 596 Pfund; wieviel
sie erschwindelten, ist nicht bekannt geworden. Der Vogt von Ramstein
verrechnete überhaupt keine Salzbussen; dabei aber wiesen die
Bauern von Bretzwil in einer schriftlichen Supplikation an die Regierung
nach, dass dieser Vogt allein «in 14 Tagen von 30 Haushaltungen
über 300 Pfund Salzbussen eingetrieben» habe! Welches Gift diese
und hundert ähnliche Praktiken im Basler Volk verbreitet haben, geht
daraus hervor, dass selbst Beamte dadurch in die Revolution getrieben
wurden: so wurden beispielsweise Galli Jenny, der Meyer von Langenbruck,
und Jakob Senn, Untervogt von Sissach, im Herbst 1652 um je
25 Pfund Salzbusse gebüsst — «beide gehören im folgenden Jahre zu
den Führern des Aufstands». Gally Jenny gehört dann zu den sieben
hingerichteten Führern des Basler Bauernkriegs...
Das genügt uns, um wenigstens zu ahnen, was so ein Vogt wie
Zörnlin, oder gar ein Wettstein in seinen Landvogtjahren verdiente —
und bei was für einem elend bedrückten und ausgesogenen Volk dieser
Zörnlin nun Schergen für die Herren warb. Die bittere Armut musste
viele Hände förmlich nach dem Hand- oder Wartegeld zucken machen,
das ihnen da angeboten wurde, obwohl es nur ein Pfund war.
Dabei war die Basellandschäftler Bauernschaft die bestbewaffnete
der ganzen Schweiz, ja vielleicht ganz Europas! Das geht aus den weiteren
Ausführungen Heuslers hervor und ist wohl zum Hauptteil auf
die dauernde direkte Kriegsgefahr an der unmittelbaren Grenze Deutschlands
während des ganzen Dreissigjährigen Kriegs zurückzuführen.
Viele Grenzverletzungen, Ueberfälle und Durchzüge fremder Soldateska
fanden in der Tat statt. Dies zwang die Obrigkeit zur Bewaffnung —
und zu einer ständig besseren Bewaffnung —der einfachen Stadtbürger
sowohl wie der Landleute. Das war ein sehr zweischneidiges
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 236 - arpa Themen Projekte
gegen Teilnahme an demselben, aber auch gegen schändliches
Beutemachen, Berauben und Aussaugen des benachbarten Landmanns,
wodurch der Stadt grosser Unwille zugezogen wurde, für Bürger
und Untertanen wiederholt werden»! Die Uebungen auf den Schiessplätzen
wurden trotzdem von der Regierung begünstigt, Munition und
Schützengaben verabreicht, Offiziere zum Exerzieren der Mannschaft
auf die Landschaft abgeordnet. Schon seit 1619, ein Jahr nach Ausbruch
des Dreissigjährigen Krieges, wurden jährliche Musterungen abgehalten.
«Die waffenfähige Mannschaft bestand aus zwei Abteilungen,
600 Mann (der sogenannte Ausschuss) sollten in steter Bereitschaft
sein, um auf erste Aufforderung, so Tags wie Nachts, sich zu stellen,
die übrigen sollten sich auf den Notfall gefasst machen.» Die Zahl 600
für die ständig auf Pikett gestellte Mannschaft scheint gering; aber das
Bild ändert sich sofort, wenn man mit Heusler annimmt, «jene 600,
die sich auf den ersten Ruf zu stellen hatten, wären sämtlich mit Musketen
bewaffnet gewesen». So lieferte beispielsweise das Städtchen
Liestal für sich allein 98 Mann mit Musketen, 58 in Rüstungen mit
Spiessen und 80 weitere für den Notfall. Und als der Bauernaufstand
niedergeschlagen war und der schwere Schlag der dauernden Entwaffnung
das Basler Landvolk traf, da kamen beispielsweise aus der einzigen
Gemeinde Ormalingen 50 Musketen und 4 andere Feuerrohre ans
Licht, das eine Amt Waldenburg «lieferte auf erste Anforderung 400
Gewehre, darunter 350 Geschosse, und versprach die übrigen, die zum
Teil in Wäldern versteckt seien, nachzuliefern»! Die einzige Gemeinde
Bretzwil, die «bei 30 Bauern und Tanner» (Taglöhner) zählte, «lieferte
34 Gewehre ab, also etwas mehr als Haushaltungen im Dorfe waren».
«Bemerkenswert ist dabei wohl», sagt darum Heusler mit Recht,
«dass zu einer Zeit, wo der Gebrauch des Feuergewehrs noch keineswegs
der ausschliessliche war, das Landvolk des Kantons Basel. . . gewiss
wie kein anderes Volk mit Feuerwaffen versehen war»; gewiss
wie auch nicht die übrige Schweiz, was ein Vergleich mit der Bewaffnung
der Entlebucher oder der Emmentaler beweist, die eine noch viel
mittelalterlichere geblieben war. Dennoch mag auch das Schweizervolk
als Ganzes bezüglich der Volksbewaffnung durchschnittlich weit besser
gestellt gewesen sein als alle umliegenden Völker — bis das Schweizervolk
durch die allgemeine Zwangsentwaffnung nach dem Bauernkrieg
endlich auf den jammervollen Stand der Wehrlosigkeit etwa des
deutschen Volkes zurückgeworfen wurde und so im Ganzen bis 1798
aller Mittel beraubt blieb, sich je wieder das Recht holen zu können,
das ihm die Herren geraubt hatten.
Heusler zieht Vergleiche mit andern Völkern. «Wie es» — zum
Beispiel — «mit der Wehrhaftigkeit des deutschen Landvolkes im
dreissigjährigen Kriege aussah, erhellt wohl zur Genüge aus den schauerlichen
Misshandlungen, die es sich von mansfeldischen, wallensteinischen
und schwedischen Freibeutern gefallen lassen musste.» Ein anderes
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 237 - arpa Themen Projekte
andern Dingen doch so vorgerückten englischen Volkes? Heusler
zitiert den grossen englischen Historiker Macaulay, der noch über
eine Zeit von mehr als 30 Jahren nach dem Schweizer Bauernkrieg,
über Ereignisse des Jahres 1685, erzählt, dass «der Herzog von
Monmouth das von allen Seiten ihm zuströmende Landvolk wegen
Mangels an Waffen zurückschicken musste, und dass er selbst nach
Einnahme mehrerer Städte und mit Verwendung aller Sensen, die sich
aufbringen liessen, nicht imstande war, über 6000 Mann zu bewaffnen».
Das also war das ganz Besondere bei den Basler Bauern: ihr aussergewöhnlich
hoher Waffenstand und ihre, als Volksmiliz betrachtet,
ungewöhnliche Schulung und Organisiertheit. Das wussten auch die
Bauern der inneren Schweiz, die von Solothurn, Bern und Luzern.
Gerade solcher Bewaffnung hätten sie so bitter bedurft! Aber vorläufig
waren noch die Basler Herren am Zuge: sie schickten, begleitet vom
Hauptmann Andreas Burckhardt, den Obersten Zörnlin auf die Landschaft,
der die Aufgabe vom Dreissigjährigen Krieg her gewohnt war,
und wollten die Waffenkraft ihres Volkes vorsorglich und unmerklich
aufziehn, um sie den anderen Herrenregierungen der Schweiz gegen
ihre inneren Feinde zur Verfügung stellen. Eben damit aber zogen sie
sich unversehens den inneren Feind auf den eigenen Hals —den sie in
ihrem blinden Eifer für ihre Klassengenossen in Solothurn, Bern, Luzern
und auch in Zürich beinahe übersehen hätten! Und das ging folgendermassen
zu.
Vorerst, und das war für den forschen Zörnlin schon eine ziemlich
«gottlose» Sache, ging es mit den Werbungen auf der Landschaft trotz
des «guten» Wartegeldes nur sehr harzend vom Fleck. Ganze 108 Mann,
davon 87 aus dem Amte Liestal, brachte er vom 17. bis zum 21. März
auf die Beine. Sodann musste Zörnlin bereits am 19. den Herren XIII
ganz «Gottloses» berichten: «die Bauersame habe sich grösstenteils erklärt,
keine Soldatengelder, weder die alten, noch künftig verfallende
mehr zu bezahlen»! Das war also die erste feststellbare Rebellion im
Baselbiet: ein Steuerstreik, und er betraf die in der gegebenen Lage
politisch empfindlichste Steuerhoheit, die Militärsteuer. Darauf beschloss
der Rat, «die Herren Deputierten (Zörnlin und Burckhardt) sollen mit
den Werbungen bis auf 250 Mann fortfahren und wegen der Soldatengelder
nichts rügen, sondern schweigen bis auf eine kommlichere Zeit,
inzwischen aber in der Stille erkundigen, wer die Rädlinsführer
seien . . .» Auch sollte heimlich Munition auf die Schlösser geschafft
werden.
Wo und wie ist diese erste Rebellion entstanden? Der zweifellose
Herd liegt im Amte Waldenburg, das dem Solothurnischen am nächsten
anliegt, und zwar in Oberdorf, am Oberen Hauenstein. «Noch bevor
Oberst Zörnlin zur Vornahme seiner Werbungen dahin kam, sassen
hier in der Wirtschaft von J. Schweizer sechs Bursche aus diesem
Orte: Balzer Waldner, genannt Xander Balz, Balzer Siegrist, Friedrich
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 238 - arpa Themen Projekte
gingen dann als Boten nach Buckten, Zunzgen und Liestal
und verlangten, man solle die Gemeinden anfragen, ob man noch
Soldatengeld zahlen wolle.»
«Noch bevor» —das könnte bedeuten, dass die Bewegung spontan
und unabhängig von den Werbungen Zörnlins entstanden sei. Wahrscheinlicher
ist jedoch, dass sie unmittelbar als Rückstoss auf diese
Werbungen erfolgt ist und darum auch ausgerechnet die Nichtbezahlung
des Soldatengeldes als erste Forderung aufs Tapet brachte. Denn
Zörnlins Werbungen waren bereits seit drei Tagen in vollem Gange
und setzten schon das ganze Land in Aufregung, als am «19. Nachts
bei dem unteren Tor in Liestal» die erste solche Anfrage erfolgte, die
allerdings von dem regierungstreuen «Torwächter Hans Hoch zurückgewiesen
wurde». «Um die gleiche Zeit kamen auch zwei derselben»
(d. h. der «sechs Bursche» aus Oberdorf, nämlich Heyd Erni und ein
weiterer, nicht genannter) «zu Conrad Schuler in Liestal mit ähnlichem
Ansinnen, auch war bereits von einer bewaffneten Landsgemeinde
auf den 24. März in Liestal, ,oder um mehrerer Sicherheit willen
auf dem Wildenstein, weil dort eine Freiheit ist', die Rede.» Das
wird ausdrücklich berichtet als geschehen «im Monat März (17.-21.),
als Zörnlin zur Werbung von Wartgeldern in Liestal war'.
Nachdem die beiden Oberdorfer Sendlinge mit Seiler Konrad
Schuler zuerst «von einer bewaffneten Landsgemeinde auf dem alten
Markt» gesprochen hatten — wovon ihnen dieser wohl abgeraten hat,
weil die Situation in Liestal selber dafür noch nicht reif war —, wollten
die beiden von ihm zu einem der beiden Schultheissen geführt werden,
um von diesem «die Abordnung zweier Liestaler zu einer Zusammenkunft
in Sissach» zu begehren. Aber Schuler musste ihnen darauf
erwidern, «die beiden Schultheissen seien gegenwärtig mit Oberst Zörnlin
im Schlüssel und so betrunken, dass man nicht mit ihnen reden
könne»! Es handelte sich offensichtlich darum, die Liestaler Delegierten
für eine noch in derselben Nacht stattfindende Beratung in Sissach
zu bekommen. Diese Versammlung muss bereits abgemacht und für
die Sache der Bauern sehr wichtig gewesen sein, sodass diese nicht
abwarten konnten, bis die Schultheissen wieder nüchtern waren. «Schuler
ging daher allein und ohne Vorwissen der Schultheissen nach Sissach»,
wo allerdings die Sache nicht so revolutionär verlief, wie es die
Heissporne von Oberdorf offenbar vorhatten, indem nämlich dank der
Intervention eines Kapitulanten, des «treuen» Untervogtes ,Jakob Wir:
von Buus, «von einer bewaffneten Landsgemeinde abgestanden und
(nur) eine Supplikation um Nachlass des Soldatengeldes und um Milderung
des Salzpreises zu entwerfen beschlossen wurde».
Das besonders Interessante an dieser Geschichte ist die durch sie
verbürgte Tatsache, dass die Basler Bauern von allem Anbeginn an
grossen Wert darauf legten, die Stadt Liestal für ihre Sache zu gewinnen.
Ebenso wichtig ist die andere Tatsache, dass sich ebenfalls
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 239 - arpa Themen Projekte
Schuler fand, der den Mut hatte, die Sache der von der Regierung bereits
weitgehend ihrer ursprünglichen Freiheiten beraubten und systematisch
ausgebeuteten Stadtbürger auf eigene Faust mit derjenigen der
Bauern zu vereinen. Das war der unscheinbare Anfang einer rapiden
Entwicklung, die dieses Städtchen mit der Gewalt einer Feuersbrunst
mitten in die Bewegung, ja an deren Spitze riss. Denn Zündstoff lag in
Liestal, wie wir noch erfahren werden, genug herum. Darum war diese
winzige nächtliche Geschichte mit Schuler gegeignet, dem regierungstreuen
der beiden Schultheissen, dem ehrgeizigen Herrendiener Hans
Christoph Imhoff, die Hölle heiss zu machen, als ihm bereits am Tag
darauf, kaum dass er den Rausch ausgeschlafen hatte, die ganze Sache
(wahrscheinlich durch den «treuen» Untervogt von Buus) hinterbracht
wurde, die er naturgemäss sofort an die Herren XIII nach Basel weiterberichtete.
So kam es, dass die XIII am 25. März ihren grossmächtigen
Bürgermeister Wettstein in Person, an der Spitze einer Ratsabordnung,
nach dem gefährdeten Städtchen schickten, um zu retten, was zu retten
war.
Nun aber war inzwischen mitten in die schon durch Zörnlins Werbungen
aufgewühlte Erregung der ganzen Landschaft die Nachricht
von den ungeheuerlichen Rüstungsbeschlüssen der Tagsatzung, die sich
nur gegen die Bauern richten konnten, hereingeplatzt. So musste Wettstein
in Liestal, ausser der lokalen Obrigkeitsbelehrung, «den versammelten
Untervögten, Amtspflegern und Geschworenen den ergangenen
Tagsatzungsbeschluss» durch echt Wettsteinsche diplomatische Vernebelungskunst
«erklären». Dabei hatte er die Stirn, zu behaupten,
dass dieser Beschluss «nicht zum Angreifen (!), sondern nur zum
Schirm der ruhigen (!) Landleute und zur Versöhnung (!) gefasst sei;
die Gn. Herren wollten sie als Kinder lieben (!) und ihnen, soweit die
Mittel reichen, alles Gute erzeigen»! «Diese Erklärung», fügt der Basler
Herrenchronist Heusler hinzu, «scheint beschwichtigt zu haben, die
Beamten versicherten ihre Treue und sprachen nur den Wunsch
aus...» etc etc.
Am gleichen Tag erliess der Rat zu Bern ein dringendes Ersuchen
an alle Mitstände, ihre Aufgebote gemäss Tagsatzungsbeschluss unverzüglich
marschieren zu lassen. Das war die Folge der Tags zuvor in
Trachselwald erlebten Niederlage. Mithin hatte bereits das erste Auftreten
Niklaus Leuenbergers unverzüglich eine beträchtliche geschichtliche
Wirkung, und zwar, durch seltsame Verflechtung der Dinge, die
unmittelbarste in Basel.
Als Wettstein am Abend des 25. März von Liestal heimkehrte,
fand er das Mahnschreiben des Berner Rates «zur eilfertigen Absendung
der verabredeten Anzahl Volkes» und zugleich zur «Anwerbung
von 200 Mann» auf Kosten Berns vor. Es war eine richtige Provokation
der bernischen Kriegspartei, die in diesen Tagen obenauf war und
die durch diese kriegerische Massregel der ihr verhassten Waser'schen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 240 - arpa Themen Projekte
Johann Konrad Werdmüller
Seckelmeister der Zürcher Regierung,
Generalissimus der von der Tagsatzung gegen die Bauern aufgebotenen
eidgenössischen Herren-Armee.
Nach einem Originalstich von Conrad Meyer in der Landesbibliothek
in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 240 - arpa Themen Projekte
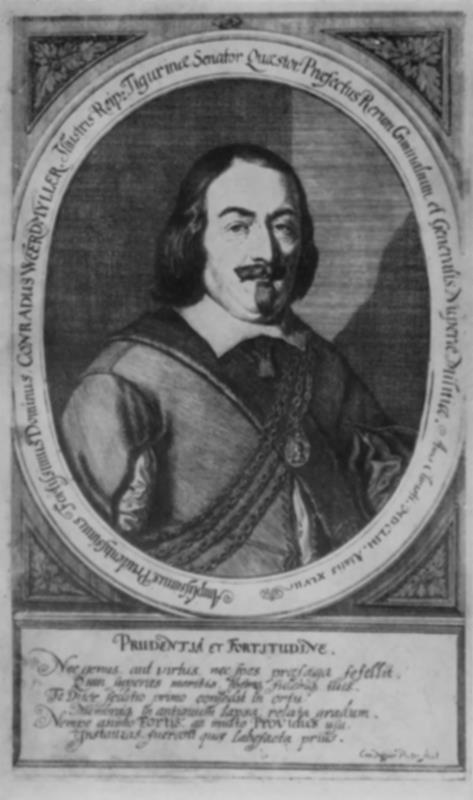
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 241 - arpa Themen Projekte
der Reise nach Bern, in Aarau angelangt. Gleichzeitig aber fand Wettstein
auch die Abmahnung des Vororts Zürich vor, mit dem Auszug
noch zurückzuhalten, um «die im Werk begriffene gütliche Handlung
nicht zu stören»; Zürich selbst unterlasse den Auszug seiner bereits
eingerückten Truppen nach Lenzburg ebenfalls. Wettstein hatte also
zu wählen: er wählte —der angebliche «geborene Friedensstifter» —die
Provokation. Und er hatte es damit eilig: schon am 26. setzte er die
Basler Truppen in Marsch, 400 Mann aus Basel und 100 aus Mülhausen,
zum Teil angeworbene Söldner, zum Teil Ausgehobene, zum
Teil Freiwillige. Der Kommandant war natürlich Oberst Zörnlin, sein
Adjutant der Hauptmann Andreas Burckhardt. Der Bestimmungsort
war, gemäss dem Badener «Defensional», Aarau; dort sollte die Truppe
bis auf weiteres als ständige Besatzung dienen.
Oberst Zörnlin setzte sich also forsch in Marsch. Er hatte Befehl,
«die Mannschaft zum Teil bis Gelterkinden, zum Teil bis Sissach marschieren
zu lassen, sich selbst aber nach Aarau zu begeben», um dort
mit dem Rat über die Bedingungen des Einmarsches zu verhandeln.
«Bei seiner Ankunft in Liestal aber» — so berichtet Heusler — erhob
sich dort grosse Unruhe, denn schon eine Stunde zuvor war mit einem
Doppelhaken auf der Mauer ein Losungszeichen gegeben worden, infolge
dessen sich alle Bürger ab dem Felde in die Stadt begaben.» Die Rebellen
waren also bereits organisiert! «Eine unzählbare Menge von Manns-
und Weibspersonen fand sich ein, welche teils ihre Männer, teils ihre
Söhne oder Dienstknechte, sowohl von gewordenen als ausgelegten (ausgehobenen)
Landleuten, wieder heim haben wollten; ein Heini Heid von
Oberdorf verlangte seinen ausgelegten Knecht zurück, unter Drohung, er
werde sonst dem Hauptmann den Kopf zerspalten»! Zörnlin musste die
Loslassung des Knechtes versprechen und im übrigen den Liestalern gestatten,
zuhause zu übernachten. Von Gelterkinden aus berichtete er
in der Nacht dem Rat: «aus Allem entnehme er, dass es je länger je
ärger werden möchte, wo man den gottlosen Leuten nicht wenigstens
mit Hoffnung begegnete. Und da ausser den gewordenen keine anderen
Landleute willens seien, fortzuziehen, so meine er, man solle fremde
Völker zu werben continuiren und die Schlösser mit ehrlichen Leuten und
Munition versehen, aber dergleichen nichts nach Liestal zuschicken.»
Der 27. verging mit der Reise Zörnlins nach Aarau, wo ihm der
Rat widerwillig, ebensosehr aus Angst vor den Bauern wie vor den
eigenen Bürgern, «nur auf eine Nacht Quartiere in den Wirtshäusern»
bewilligte. Der Rat erklärte Zörnlin ausdrücklich: «es wäre nicht ohne,
dass ihre Bürgerschaft vermeint, nicht allein kein Volk einzunehmen,
sondern auch niemand keinen Pass zu geben»; und nur der strenge Befehl
der gnädigen Herren zu Bern hätte die Bürgerversammlung vom
Tag zuvor «dahin bewegt, dass sie allerdingen darein gewilligt». Trotzdem
brach Zörnlin mit der Truppe am 28. über die Schafmatt nach
Aarau auf, und als er, mit Hauptmann Burckhardt vorausreitend, dort
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 242 - arpa Themen Projekte
der Bürgerschaft, freundlich empfangen».
«Noch weit grössere Erbitterung hatte» —nach Hans Nabholz —
«die Kunde von dem Herannahen fremder Truppen auf der Landschaft
erzeugt. Zu Huttwil war am 26. März eine Lands gemeinde abgehalten
und dabei beschlossen worden, die Oberaargauer sollten den Marsch
der erwarteten Baslertruppen aufhalten, während die Leute der Grafschaft
Lenzburg den Zürchertruppen den Pass zu versperren hätten.»
Dies Alles lässt auf eine bemerkenswert gute Organisation der Gegenwirkung
seitens der Bauern schliessen. In der Tat: sie spielte gegen die
Basler Truppen von Anfang an ganz ausgezeichnet. Kaum verschwanden
Zörnlin und Burckhardt reitend im Tor der Stadt, so waren sie
bereits von ihrer Truppe abgeschnitten, die sie im Felde vor Erlinsbach
zurückgelassen hatten. Da nämlich hörten die beiden Reiter in ihrem
Rücken Sturm läuten; es waren die Glocken von Erlinsbach. «Hauptmann
Burckhardt» —berichtet Heusler — «ritt hin, schon waren 200
Mann beisammen, um den Pass zu versperren, doch gelang es mit
Hülfe des Landvogts von Gösgen (des benachbarten Solothurner Amtes),
ungehindert Durchpass zu erhalten.» «Bei Erlinsbach den Pass
mit grosser Mühe erlangt», berichtete Zörnlin seinen Basler Herren.
Für die Truppen war dieser Einmarsch das reinste Spiessrutenlaufen.
Doch das war nur das Vorspiel des nun leidenschaftlich einsetzenden
bäuerlichen Gegenwirkens. «Sobald die Nachricht hievon sich in
der Umgegend verbreitete, rotteten sich die Bauern zusammen» berichtet
Vock. «In der Nacht vom 28. auf den 29. März ertönte das Sturmgeläut
in allen Dörfern» der Grafschaft Lenzburg; «auf den Höhen brannten
die Wachfeuer —das Signalsystem der Bauern! Und alles Volk
lief bewaffnet Aarau zu. «Am 29. früh sah man die Bauern in dichtgedrängten
Scharen vor Aarau, auf dem Thorfeld und in der Geiss, versammelt
und gelagert.» Nach Nabholz sind es «mehrere tausend» gewesen.
«Durch eine Gesandtschaft von Untervögten liessen sie die Stadt
auffordern, die fremden Truppen zu beseitigen, sonst werde man sie
mit Gewalt vertreiben. Als die ersten Gesandten nichts ausrichteten, erschienen
andere, die unter schweren Drohungen den Abmarsch der
Basler forderten.» Schon von diesem Stadium berichtet Vock: «Die
Soldaten von Basel und Mühlhausen bekamen Angst oder waren selbst
vom Geiste der Empörung angesteckt; denn die meisten derselben erklärten,
sie wollen nicht gegen die Landleute kämpfen, sondern lieber
die Waffen niederlegen. Die Verwirrung in der Stadt wurde mit jeder
Stunde grösser.» Folgen wir wieder dem Berichte Nabholzens: «Zörnlin
mit seinen Offizieren, der von Lenzburg herbeigeeilte Festungskommandant
May von Rued, Statthalter Dietzi, der als Ehrengesandter
der Appenzeller auf dem Wege zum Schiedgerichte nach Bern eben in
Aarau eingetroffen war, sowie der Rat von Aarau suchten die wütende
Volksmenge zu beschwichtigen. Zörnlin hatte angesichts der schwierigen
Lage Boten nach Basel abgefertigt, um neue Instruktionen einzuholen.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 243 - arpa Themen Projekte
gefangen genommen worden. May von Rued machte den Vorschlag,
die Basler sollen aufs Schloss Lenzburg ziehen; allein Zörnlin berief
sich auf seine Instruktionen, die ihn in Aarau Halt machen liessen.
Aber auch die Bauern hätten sich einem Weitermarsch der Truppen
mit Gewalt widersetzt.» Vock erzählt dazu: «Die Bauern vor der Stadt,
wahrscheinlich durch geheimen Bericht gewarnt, rüsteten sich schon
auf dem Thorfelde, den Weg nach Lenzburg zu versperren.»
Inzwischen hatte die Nachricht vom Einmarsch der Basler Truppen
in Aarau, durch angeblich «wilde Gerüchte» vom Anmarsch immer
neuer fremder Truppen verstärkt, auch das ganze Oltener und Aarburger
Gebiet in die Waffen gebracht. «In Olten erscholl am 29. März
schon vor Tagesanbruch das Geschrei» von solchen neuen Anmärschen,
wie Vock berichtet. «Eilig lief der Weibel von Olten, Leonhard
Kandel, nach Aarburg, die Nachbarn um Hilfe aufzumahnen. Alsogleich
brachen die Aarburger, 200 Mann stark, auf und eilten bewaffnet,
mit Trommelschlag und fliegender Fahne, nach Olten. Als sie
gegen die Stadt anrückten, zogen ihnen die Oltener entgegen... Paar
und Paar und Arm in Arm, allemal ein Oltener und ein Aarburger,
marschierten sie durch die Stadt, hinaus auf's freie Feld, wo sie sich
zur Landsgemeinde bildeten; ... worauf die Aarburger und die Oltener
sich gegenseitig zu Schutz und Wehr mit einem Eide verbanden und
gelobten, die fremden Völker nicht in's Land hineinzulassen und die
Hereingekommenen wieder hinauszutreiben... Hierauf eilten die Aarburger,
vereinigt mit den Oltenern und andern Landleuten des Kantons
Solothurn, auf dem linken Ufer der Aare hinab nach Erlinsbach,
um den Bauern, welche die Stadt Aarau belagerten, Hilfe zu bringen.»
Nach Nabholz waren es lediglich die wilden Gerüchte über den
Anmarsch neuer Truppen, war es «dieses Gerede, das jeden Hintergrunds
entbehrte», was «bewirkte, dass nunmehr auch die Bürgerschaft
der fremden Besatzung gegenüber eine drohende Haltung einnahm und
um die Wette mit den Bauern deren Entfernung verlangte». Wie wenig
dieses «Gerede» «jeden Hintergrunds entbehrte», wie begründet diese
«wilden Gerüchte» waren, die die Bauern und Bürger des ganzen Mittellandes
im Zusammenhang mit dem ja nicht wegzuleugnenden Basler
Zug nach Aarau in Aufruhr versetzten, das geht aus folgenden Nachrichten
des Zürcher Herrenchronisten G. J. Peter hervor: «Die Solothurner
Bauern hatten das Schreiben des Bischofs von Basel an Zürich
abgefangen, mit der Anzeige, er wolle die nach Olten (!) bestimmten
Truppen gemäss dem Badener Abschied bereit halten! Auch war ihnen
infolge der ,unfürsichtigkeit' des Falkenwirts von Aarburg, Hans Jakob
Suters, zur Kenntnis gekommen, der Berner Rat habe im Elsass eine
Anzahl Söldner angeworben, um sie über die Schaf matt (!) kommen
und durch Hauptmann Jakob Anton Weyermann ,heimlicherweiss' als
Besatzung nach Aarburg (!) und Aarwangen (!) legen zu lassen.» Suter
(bei Vock: Hurter) und Weyermann waren jene Herrendiener, die eben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 244 - arpa Themen Projekte
vom Hauptmann Gibeli Solothurner Regierungstruppen gegen die rebellischen
Aarburger auszuleihen, die dabei aber von den Oltener Bürgern
im Tumult überwältigt, gefesselt — «in Eisen geschlagen und
scharpf examiniert» —und den Aarburger Rebellen ausgeliefert wurden.
Ein Zeichen mehr für den zu allem entschlossenen Widerstandswillen
des Volkes gegen Ueberfälle durch «fremde Truppen»; ein Widerstandswille,
dem allein es zu verdanken war, dass die genannten
weiteren Ueberfallspläne unausgeführt blieben und der sich nun in so
überwältigender Weise gegen den Einfall der Basler Herrentruppen in
Aarau entfaltete.
Vock erzählt weiter: «Während nun in Aarau die Beratung auf
dem Rathause noch dauerte, kam Bericht von Erlinsbach, dass dort
die Kriegsscharen der Bauern stündlich anwachsen. Es entstand Lärm
und allgemeiner Schrecken.» Heusler berichtet: «Die ganze Bürgerschaft
lief zu den Waffen und der Brücke zu, um sie abzuwerfen» (d. h. um
den befürchteten Zuzug von noch mehr fremden Truppen zu verhindern),
«mit dem Rufe, es sei eine grosse Verräterei begangen, ihre Herren
handelten nicht redlich mit ihnen usw. Ohne nur Zörnlin ausreden
zu lassen, lief der ganze Rat in grösster Bestürzung auseinander und
den Waffen zu» um das Abwerfen der Brücke zu verhindern. In allen
Strassen der Stadt sah man auch fast ebensoviele Bauern als Bürger.
Schultheissen und Offiziere hatten genug zu tun, die Brücke zu erhalten
und Tätlichkeiten zu verhindern, bis die Truppen zwischen die
Brücken zusammengebracht waren.» Kurz, «es herrschte», wie Vock
erzählt, «grenzenlose Verwirrung, ohne dass man eigentlich den Grund
kannte. Die Basler und Mühlhauser Soldaten gerieten in solche Furcht,
dass sie das Morgenessen stehen liessen und nüchtern aus der Stadt auf
den Platz zwischen beiden Brücken flohen, wohin man ihnen, damit
sie nicht vollends Reissaus nehmen, Brot, Wein und Käse brachte.»
Hier ergänzt wiederum Nabholz: «Einzelne Soldaten verkrochen sich
in Häusern und Scheunen, aus Furcht, von den wütenden Bauern totgeschlagen
zu werden, andere schlichen sich vom Heere weg und suchten
einzeln aus der Stadt zu entkommen. Selbst den Offizieren war der
Schreck in die Glieder gefahren. Einer von ihnen erklärte, bei keinem
der Kriege, die er mitgemacht habe, sei es so gefährlich wie bei diesem
gewesen!»
Noch einmal schien sich für den vielgeplagten Zörnlin ein Ausweg
aufzutun, um der Schande eines schmählichen Rückzugs zu entrinnen:
«Laut Abrede mit den Vögten von Biberstein und von Schenkenberg
sollten die Truppen in diese beiden Aemter verlegt werden», berichtet
Heusler; «bald aber erfuhr man, dass das Volk der beiden Vogteien,
in Verbindung mit Leuten aus der Grafschaft Lenzburg, sich dem widersetzen
wolle.» Zörnlin liess also seine tapferen Truppen, «nachdem
sie gesättigt waren», vorläufig bis gegen Erlinsbach zurückmarschieren.
Aber, oh weh: «Hier lag das ganze Gösger Amt, 7 bis 800 Mann stark,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 245 - arpa Themen Projekte
und eines «langen Streites wegen Auslöschens der Lunten», um
Zörnlins «Heer» schliesslich «den Durchzug mit brennenden Lunten
zu gestatten». Das war der einzige «Prestige-Erfolg», mit dem Zörnlin
seinen Rückzug versüssen konnte. Dies nun aber unter einem noch viel
böseren Spiessrutenlaufen «mitten durch die Reihen der in Erlinsbach
zusammengelaufenen Landstürmer », als jenes gewesen war, durch das
er seine Truppen nach Aarau hereingebracht hatte.
Als sie so unter einem Hagel von Fluch- und Schimpfreden über
die Schafmatt wieder ins Baselland abgeschoben waren, da machte der
Meister Zörnlin seinem Herzen Luft in einem Bericht an seine Herren.
Darin jammert er zum Schluss: «man habe jetzt spüren müssen, dass
die Bauernsamen beiderseits der Aare über einen Leist gespannen und
resolviert seien, kein fremd Volk ins Land zu lassen: was man aber
sonsten aller Orten von diesen wilden Leuten für schändliche Reden
wider allerseits hohe obrigkeitliche Stände hören müsse, wolle er lieber
vergessen, als mehr daran denken...» Begreiflich, denn die Lorbeeren,
die Meister Zörnlin auf seinem kühnen Feldzug nach Aarau für seine
allerseits hohen Herren von Basel und der ganzen löblichen Eidgenossenschaft
geerntet hatte, gingen auf keine Kuhhaut!
Dieser Ausgang des Aarauer Zuges der Basler Herrentruppen gab
noch den ergiebigen Stoff für viel Krach zwischen den Herren selber ab.
Denn, wie der moderne Zürcher Herrenchronist des Bauernkriegs
G. J. Peter bezeichnend genug sagt, «der Ausmarsch ungenügender
Truppen und deren Rückzug verschlimmerte die Lage» (der Herren
nämlich!) «entschieden, weil ersterer den agitatorischen Bauernführern
Stoff zur Verhetzung der ruhigeren Elemente gab, letzterer aber
als Schwäche der Regierungen zu deuten war». Gewiss ist dies vom
Herrenstandpunkt aus ganz richtig; gewiss wäre es im Interesse der
Ausbeuter und Bedrücker viel konsequenter gewesen, wenn eine genügende
Truppenzahl, am besten gleich die gesamte, von der Badener
Tagsatzung aufgestellte Truppenmacht, ins Feld gerückt wäre, um den
neuen, erst ins Keimen gekommenen Bund aller ausgebeuteten Bauern
und aller unterdrückten Bürger durch militärische Uebermacht bereits
im Keime zu ersticken. Im Interesse der Ausgebeuteten und Unterdrückten,
der Erniedrigten und Beleidigten, kurz der erdrückenden
Mehrheit des Schweizervolkes, lag es jedoch, dass ihm aus dem Zusammenbruch
der ersten militärischen Exekution auf eidgenössischem
Boden gegen seine Rechte und Freiheiten wenigstens ein Schimmer der
Hoffnung und darum ein Ansporn entsprang, sich nun besser als bisher
für den Kampf zur Rückeroberung und Wiederherstellung dieser seiner
Rechte und Freiheiten zu organisieren!
Dieser Ansporn ist dem Schweizer Volk —im Rahmen des damals
überhaupt Möglichen — aus dem «verunglückten» Aarauer Zug in der
Tat entsprungen. Das wird uns das nächste Kapitel lehren, das uns die
Geburt des einzigen allgemeinen, überkantonalen und überkonfessionellen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 246 - arpa Themen Projekte
den die Geschichte der Eidgenossenschaft gegen die Gesamtheit ihrer
Regierungen, gegen den «Herrenbund», hervorgebracht hat. Tatsache
ist, dass der Aarauer Zug mit allen seinen Folgen —und also eigentlich
der Urheber dieser Provokation, der «pater patriae» Bürgermeister
Wettstein von Basel —als geschichtlicher Geburtshelfer des in den
Wehen liegenden Bundes gar nicht überschätzt werden kann.
Hier wollen wir uns nur noch mit den Folgen des Aarauer Zuges
speziell für die Basler Bewegung beschäftigen. Trotz allem bisher Berichteten
können wir sagen, dass die Basler Bewegung zwar nicht erst
mit dem Aarauer Zug beginnt, wohl aber erst durch diese, im Dienst
und im Interesse der eidgenössischen Herrenklasse unternommene Aktion
zur Revolution gemacht wurde. Das geht auch aus dem Fazit hervor,
das der Basler Herrenchronist Heusler aus dem Aarauer Zug speziell
für Basel zieht: «Der verunglückte Zug nach Aarau hatte für den
Kanton Basel eine doppelte Folge. Erstlich wurde durch denselben die
Aufregung in den Nachbarkantonen ungemein gesteigert und gegen
Basel» (d. h. gegen die Basler Regierung!) «gerichtet; die Oberländer,
d. h. die Landleute der oberen Kantone, stellten Wachen gegen die
Landschaft Basel auf und liessen sie durch zahlreiche Aussendlinge mit
Verlockungen und Drohungen bearbeiten. Zweitens aber erschütterte
die Expedition auch das Ansehen der Regierung im Lande selbst. Von
diesem Zuge an nimmt daher die Bewegung im Kanton Basel eine immer
ernster werdende Gestalt an.»
Wie «alle Dörfer» der Basler Landschaft gerade in den Tagen
nach dem Aarauer Zug «mit Bauerngesandten aus Bern und Solothurn
überloffen» wurden, haben wir bereits aus einem Bericht an die Basler
Regierung vom 3. April vernommen, als wir aus dem Zusammenhang
der solothurnischen Bewegung daran gingen die Geschichte der Basler
Bewegung aufzuholen. Am gleichen 3. April «vernahmen die XIII (die
Basler Regierung), wie düster Schultheiss Imhoff die Sache ansehe; die
Liestaler, meinte er, steckten auch unter der Decke, er sei ohne Gewalt
und überall umlauert; und Obervogt Brandt in Homburg meldete von
Bewaffnungen im Solothurnischen und von Anwesenheit baslerischer
Ausschüsse bei einer dortigen Landsgemeinde». In der Tat waren der
Sonnenwirt von Bukten, Joggi Buser, und noch fünf andere Basler
Bauern auf der Landsgemeinde zu Olten am 31. März. Kurzum, der
Obervogt von Homburg bat die Basler Herren «dringend um Abstellung
der Landesbeschwerden...»
Wie blind und verstockt die Herren XIII waren, geht daraus hervor,
dass sie ausgerechnet den so schwer belasteten Obersten Zörnlin
zur «Abstellung» der Beschwerden aufs Land schickten, wenn sie ihm
auch noch zwei andere Ratsherren mitgaben. Er sollte dort «besonders
den Umtrieben benachbarter Auf wie gier entgegenwirken..., über die
der Regierung zugeschriebenen gefährlichen Anschläge und die ihr
von bösen Buben (!) untergeschobenen Briefe und Schriften Beruhigung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 247 - arpa Themen Projekte
des Badener «Gemeinen Mandats». «Das Soldatengeld und den Salzpreis
werden sich die gn. HH. (die gnädigen Herren) bester Massen
recommandiert halten»; die Bauern «könnten diese Begehren nach Belieben
anbringen, doch wäre es besser, es noch zu verziehen, damit es
ihnen mit besserem Glimpf und reputation der Obrigkeit bewilligt werden
möge und nicht das Ansehen gewinne, ob hätten sie sich gegenwärtiger
Unruhen und troubles zu ihrem Vorteil bedienen wollen». So legten
die Basler Herren Köder aus, um die Sache womöglich bis zu einer
erfolgreicheren militärischen Exekution der Eidgenossenschaft hinzuziehen.
Inzwischen hatten die Bauern der vier oberen Aemter, d. h. der
Aemter Farnsburg, Homburg, Waldenburg und Ramstein, samt dem
Amte Liestal (d. h. samt den von der Stadt Liestal regierten Dörfern),
auf den 6. April ins Schützenhaus zu Sissach eine Lands gemeinde zusammengerufen.
Diese wurde zwar nicht so sehr durch ihre Ergebnisse
als vielmehr durch den Umstand geschichtlich bedeutsam, dass auf ihr
zum erstenmal die beiden Hauptführer der ganzen Basler Bauernerhebung
vor die Oeffentlichkeit traten: Isaak Bowe von Bretzwil und
Uli Schad von Oberdorf.
Isaak Bowe trat hervor als Wortführer des Amtes Ramstein, das
aus dem einzigen Dorf Bretzwil und dem Weiler Lauwil bestand. Gerade
dieses Amt hatte die meisten Klagepunkte vorzubringen. Isaak
Bowe brachte auf der Sissacher Landsgemeinde in offensichtlich sehr
eindrucksvoller Beweisführung, die den Herren sehr auf die Nerven
ging, 13 Beschwerdepunkte vor: «betreffend ungebührliche Anmassung
von Nutzungen durch den Landvogt, Lästigermachung gewisser Dienste,
namentlich auch durch Entziehung üblicher kleiner Gegenleistungen;
Nötigung zu bisher nicht gewohnten Diensten, besonders aber über
willkürliche Strafen», wovon wir die Büssung von 30 Haushaltungen
mit über 300 Pfund Salzbussen innert 14 Tagen bereits kennen gelernt
haben. «Es macht im ganzen den Eindruck» — sagt selbst der Herrenchronist
Heusler — «als ob der auf die einzige Gemeinde Bretzwil angewiesene
Landvogt (Jeremias Fäsch), obschon damals der Sohn des
reichsten Baslers, des Bürgermeisters Fäsch, durch kleinliche Knickereien
und Erpressungen ersetzen wollte, was ihm in Bezug auf den
Umfang des Bezirks abging.» Ebenfalls von einem Fäsch, der früher
drei Jahre lang Landvogt von Homburg gewesen war, verlangten die
Homburger in Sissach übrigens die Rückerstattung von «150 Pfund
oder drei Monaten Soldatengelder», welche er «zu viel bezogen, weil er
aus einem Jahr 13 Monate gemacht hatte»!
Isaak Bowe hat sich also zweifellos aus tief begründetermassen
verletztem Rechtsgefühl zum Wortführer seiner schamlos ausgebeuteten
Gemeinde gemacht. Seine aufrechte Rechtlichkeit und seine charaktervolle
Solidarität gehen auch aus folgender Auseinandersetzung mit
dem Schreiber der Landsgemeinde hervor. Als solcher nämlich fungierte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 248 - arpa Themen Projekte
der Landsgemeinde eiligst untergeschobene Person: Bischoffs Sekretär
J. J Stähelin, ein Lockspitzel der Regierung, von dem gefälschte Unterschriften
beider Liestaler Schultheissen, sowie Denunziantenberichte
an die Regierung vorliegen und der, weil die Bauern ihn wohl lange
nicht erkannt haben, auch auf späteren Landsgemeinden Schreiber der
Bauern war: «er schrieb auch die späteren Aktenstücke der Unzufriedenen»,
sagt Heusler und fügt naiverweise hinzu: «scheint aber deshalb
nicht zur Verantwortung gezogen worden zu sein». Kunststück —da
er für die Herren arbeitete! Mit diesem sauberen Herrn also hatte Isaak
Bowe bezeichnenderweise schon auf der ersten Sissacher Landsgemeinde
einen Wortwechsel. Bowe war Stähelin offensichtlich als höchst
ehrenwerter und untadeliger Mann bekannt, der zur Familie des Bürgermeisters
Fäsch in guten Beziehungen gestanden hatte; hatten doch
zwei Mitglieder dieser Familie eine Hypothek auf Bowes Gütern. So
stellte also Stähelin den Isaak Bowe zur Rede, «wie denn gerade er so
gegen den Landvogt auftreten möge»? Darauf antwortete Bowe: «es
müsse im Namen der Gemeinde so sein, und sei es an diesen Klagen
nicht genug, so wolle er noch mehr anbringen».
Die Parallele zwischen Bowe und Leuenberger, ja, auch mit dem
frühen Emmenegger, ist auffallend. Bowe war, wie diese beiden, zur
Zeit seines Auftretens 38jährig. Wie Leuenberger, der mit Tribolet
zusammen in den lokalen Gerichten sass, hatte auch Bowe nicht den
geringsten persönlichen Anlass zum Auftreten gegen seinen Landvogt,
zu dessen Familie er vielmehr offensichtlich gegenseitig wohlwollende
Beziehungen pflegte. Einzig die rechtliche Gesinnung und die Solidarität
mit seinen ärmeren und ausgebeuteten Klassengenossen trieb Bowe
auf die Seite der Revolution. Denn auch Bowe war, wie Emmenegger
und Leuenberger, ein wohlhabender Bauer: «Das Inventarium seines
Vermögens zeigt ihn als einen an Grundbesitz und Viehstand wohlhabenden
Bauern, dessen Hausrat und Leinenzeug aber sehr einfach
bestellt war; dabei hatte er eine aus einer Bibel, einer Postille und
einem Gesangbuch bestehende Bibliothek, in welcher er wohlbewandert
gewesen zu sein scheint.» Auch Bowe hatte, wie Leuenberger, eine
zahlreiche Familie und sorgte wie dieser aufopfernd für deren Glieder:
«Er war mit einer Weber von Bretzwil verheiratet und Vater mehrerer
Kinder; von seinem Lebenswandel wird gemeldet, er sei bis 1653 unsträflich
gewesen und ausser für Weib und Kinder habe er noch für
seine Schwiegermutter und für die Kinder eines Bruders seiner Frau
gesorgt.» Weiter urteilt Heusler, der Bowe erst eigentlich in seiner Bedeutung
entdeckt hat: «er ist ohne Zweifel der Gebildetste unter den
baslerischen Insurgenten; nicht nur schreibt er eine recht leserliche
und saubere Handschrift, er weiss auch seine Gedanken in wohlgeordnetem
Zusammenhang und nicht ohne einen Zug ansprechender
Gemütlichkeit auszudrücken. Täuscht nicht Alles, so war Isaak Bowe
der denkende Kopf der Bewegung, der Mann, der Mass und Ziel zu
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 249 - arpa Themen Projekte
immer wieder ihre Gemässigtheit und Besonnenheit gerühmt.
Ein fast ebenso schroffer und dabei zwar nicht gleich, aber ähnlich
gearteter Gegensatz wie zwischen diesen beiden und Schybi klafft
zwischen Bowe und Uli Schad. Dieser galt bis auf Heusler als der einzige
überragende Bauernführer der Basler, weil er als «Haupträdelsführer
» unter besonders entehrenden Bedingungen —als einziger durch
den Strang — hingerichtet wurde, während Isaak Bowe durch die
Flucht ins Ausland entkam und sich so auch der Aufmerksamkeit der
Nachwelt entzog. Uli Schad ist auf der Landsgemeinde zu Sissach als
Wortführer seiner Gemeinde Oberdorf, aber zugleich auch — mit
Werli Bowe, dem Schlüsselwirt zu Waldenburg und Bruder Isaak
Bowes, sowie mit Daniel Jenny zusammen —als Vertreter des ganzen
Amtes Waldenburg, und zwar «als Vertreter der Heftigeren», aufgetreten.
«Insbesondere erklärten diese, sie würden keinen Eid des Salzes
halb mehr tun, es sei das bei ihnen bereits abgemehrt, denn man habe
es ihnen mit dem Salze gemacht, dass sie wohl daran denken werden.»
Die stürmischste Forderung der überhaupt stets am revolutionärsten
und tumultuarischsten auftretenden Waldenburger scheint aber die gewesen
zu sein, «nicht wider die Eidgenossen gebraucht zu werden»! Das
war die unmittelbare Folge des Aarauer Zuges und zugleich der Ausdruck
des bereits heimlich bestehenden Bündnisses mit den Bauern
und Bürgern von Solothurn, Bern und Luzern. Zweifellos also haben
wir in Uli Schad den Führer der Aktivisten unter den Basler Aufständischen
vor uns, und seine Gruppe war ebenso zweifellos die, die
am frühesten die revolutionäre Verbindung mit den Aufständischen
der inneren Schweiz aufnahm und sie am zähesten festhielt und die das
militärische Wach- und Signalsystem auf der ganzen Jurakette aufbaute.
Für beides lag ja Oberdorf —und das Amt Waldenburg überhaupt
— am oberen Hauenstein ausgesucht günstig.
Uli Schad war nicht Bauer, sondern Weber, wie ja auch Schybi
nicht Bauer, sondern Wirt war, wenn auch gewiss für beide gilt, dass
sie in bäuerlichen Verhältnissen lebten. Ueber seine persönlichen Lebensverhältnisse
ist unsere Kunde gering. Ueber sein Alter wissen wir
nur, dass er «im kräftigen Mannesalter» stand. «Er hatte sich, wahrscheinlich
1651, mit einer Wittwe aus dem Bipper Amt verheiratet,
welche ihm Stiefkinder zugebracht hatte; eigene Kinder hatte er nicht.»
Für die Heirat einer Auswärtigen und Uebernahme ihrer Kinder, «für
alle sowohl Abzugs als der Ungenossame und Leibeigenschaft halb
habende Anspruch», zahlte er 100 Gulden. Abzug, Zuzug, Geburt, Leben
und Tod —Alles war ja damals in ein Netz von würgerischen
Steuern eingespannt. Im übrigen muss auch Uli Schad nicht einer der
Aermsten und ein ziemlich geachteter Mann gewesen sein: «er war
seit 1649 Gerichtsmann in Waldenburg, seit 1652 Bannbruder in Oberdorf,
welch letztere Stelle sein Vater wegen schlechten Gehörs niedergelegt
hatte». Auch Uli Schad hatte, wie Schybi, typisch landsknechtische
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 250 - arpa Themen Projekte
Kriegsdiensten gewesen wäre. So pflegte er nicht nur bei eigentlichen
militärischen Anlässen oder Aktionen, sondern auch auf den
Landsgemeinden «mit einem grossen Schlachtschwert den Oberbefehl»
zu führen, «welchem alle Bauern auf's pünktlichste gehorchten»,
wie Vock berichtet. «Was von ihm berichtet wird», sagt Heusler, «lässt
schliessen, er sei der Mann der Tat gewesen, der die Leidenschaften
des Volkes aufzustacheln wusste und es mit den Mitteln dazu nicht genau
nahm.) Von irgendeiner bemerkenswerten politischen Idee, oder
auch nur einer bestimmten Gesinnung wie bei Bowe hören wir bei Uli
Schad ebensowenig wie bei Schybi. Er war aber wohl ein besserer und
zuverlässigerer Organisator als Schybi.
Die Landsgemeinde auf dem Schützenhaus zu Sissach —welcher
übrigens auch eine Gruppe Solothurner, als Abgeordnete der Vogtei
Dorneck, beiwohnte —fasste ein paar klare und einfache Beschlüsse
bezüglich der wirtschaftlichen Beschwerden der Bauern, jedoch keinen
von erheblichem politischem Belang: «1. Erlass des Soldatengeldes für
die Zukunft; 2. gleicher Salzpreis wie bei den Nachbarn oder freier
Salzkauf; 3. Nichtverwendung zum Kriege gegen die Eidgenossen.. Eidgenossen...'
(Das ist der relativ bedeutendste Punkt, weil er der eidgenössischen Exekution
gegen die Bauern in den Arm fiel); «Nachlass der 2 fl. (Gulden)
bei Hochzeiten über 4 Tische.» (Ursprünglich eine Sittenbusse gegen
den Hochzeits-Luxus, 2 Gulden pro Uebertisch, jeder Tisch zu 12 Personen
gerechnet, längst aber zur Geldquelle für den Fiskus gemacht.
So überboten sich gerade hohe Geistliche, die solche Sittenerlasse mit
sittlichen Donnerpredigten zu begleiten hatten, gegenseitig mit dem
Ruhm, sich am meisten Uebertische bei ihrer eigenen Hochzeit leisten
zu können: «so hatte der Archidiaconus, spätere Antistes Lucas Gernler,
eine Hochzeit von 4 Tischen und 15 Uebertischen [also etwa 228
Personen], und der Archidiaconus, spätere Antistes Peter Werenfels
eine solche von 4 Tischen und 8 Uebertischen, wofür ersterer 61 Pfd.
5 Batzen und letzterer 35 Pfd. an Busse und Umgeld zahlte».) Der 5.
und letzte Punkt der Sissacher «Supplication» ist dann bereits die
Ueberleitung zur Kapitulation; er lautet: «man möge sie nicht für rebellische
Leute erkennen, wobei der Tumult bei Zörnlins Durchmarsch
durch Liestal mit Aufregung und Ueberraschung entschuldigt wird».
Aber man darf dabei nicht vergessen, welche Hand diese «Supplication»
abfasste: der Schreiber der Landsgemeinde war ja der Saboteur
und Lockspitzel der Regierung, Stähelin! Dessen Zusammenarbeit mit
den Herren XIII gab auch dem weiteren Verlauf das Gepräge. Am
9. April wurde das Machwerk Stähelins dem Rate von «Ausschüssen»
vorgelegt, von deren Wahlart wir nichts wissen. Wohl aber wissen wir
aus der Chronik des zeitgenössischen Dekans Brombach, dass dabei,
«eigenen Gewalts, unausgeschossen», als Wortführer die beiden Herrendiener
Untervogt Jakob Wir: von Buus, den wir bereits kennen, und
Amtspfleger J. J. von Arx von Sissach auftraten und dass diese «die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 251 - arpa Themen Projekte
Ausschüssen befohlen». Durch diesen Akt der Sabotage der Sache der
Bauern machten sich diese beiden «treuen» Herrendiener übrigens im
Volke als «Verräter» und «Ohrenträger» so verhasst, dass sie fortan
kaum mehr ihres Lebens sicher waren.
Wettstein, mit sechs Miträten, darunter wieder der unvermeidliche
Zörnlin, empfing also diese «Ausschüsse» und übergoss sie mit der von
ihm stets bereitgehaltenen «staatsbürgerlichen» und «religiösen» Moralpredigt.
Sie erhielten den salomonischen Bescheid: sie hätten Bedenkzeit
bis zum 15. April, und wenn dann «eine pflichtmässige (!) Antwort
(statt einer Antwort der Regierung!) erfolge, wie jüngst in Liestal (!)
geschehen, so werde er (der Rat) sich über die Beschwerden so erklären,
dass man seine väterliche Liebe und treueifrige Sorgfalt für ihre
zeitliche und ewige Wohlfahrt wohl erkennen werde»! Solch abgeschmackten
Bescheid liessen sich diese «Rebellen» als Antwort auf
ihre Forderungen, deren mit keinem Wort gedacht wurde, bieten! Ja,
sie wurden ausdrücklich gefragt, «ob sie der natürlichen und von Gott
gesetzten Obrigkeit an allen Orten, da es verlangt würde, alle schuldige
Treu und Unterthönigkeit ohne Beding und Vorbehalt leisten wollen?».
Worauf diese «Ausschüsse» sich «willfährig erzeigt» haben sollen,
besonders die des Farnsburger Amtes (<denen wir es», schreibt der
Rat, «nie vergessen wollen»); sie «erklärten aber doch, noch ihre Gemeinden
darüber anfragen zu wollen».
In den nächsten Tagen wurden jedoch nicht, wie man danach vermuten
sollte, örtliche Landsgemeinden veranstaltet wie in Luzern oder
Bern. «Die Gemeinden wurden nun durch die Vögte einvernommen.»
Allerdings lief dabei nicht alles glatt ab. Zum Beispiel wollte der Vogt
von Farnsburg, ein Schwager Wettsteins namens Eckenstein, in seinem
Amt von vornherein die Schafe von den Böcken scheiden, «den zuverlässigeren
obern Teil seines Amtes nach Gelterkinden, die Gemeinde
unter dem alten Bach aber nach Sissach berufen». Wenn er jedoch
hoffte, damit wenigstens in Gelterkinden eine einmütige Unterwerfung
zu erzielen, um damit im ganzen Lande Eindruck zu machen, so machten
ihm die eigentlichen Revolutionäre, die bestimmt nicht unter den
Ausschüssen in Basel gewesen waren, einen Strich durch die Rechnung,
durch Zusammenarbeit der rebellischen Majorität des unteren mit
der rebellischen Minorität des oberen Teils des Amtes. «Denn die
untern Gemeinden kamen nun unberufen in tumultuarischer Weise nach
Gelterkinden, und die hier im besten Zuge befindliche Versammlung
der obern Gemeinden wurde durch den Gelterkinder Hans Gerster gestört
und bewogen, den auf dem Schützenhause (zu Sissach) befindlichen
andern Gemeinden zuzulaufen, so dass auch der Landvogt sich
dahin begeben musste.» Bei diesem Tumult in Gelterkinden ist bezeichnenderweise
gerade den beiden Herrendienern Jakob Wirz und J. J.
von Arx, die in Basel als Saboteure der «Supplication» aufgetreten
waren, samt einem dritten, übel mitgespielt worden. Jakob Wirz
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 252 - arpa Themen Projekte
in Gelterkinden sei er mit Schlägen bedroht und die Amtspfleger
von Sissach und Wintersingen gar übel geschlagen worden»!
Daraufhin wagte der famose «treue» Wirz bezeichnenderweise nicht
mehr, auch am 16. April wieder nach Basel zu gehen.
Auf dem Schützenhaus nun verlangten die beiden sehr energischen
Rebellen Jakob Senn, der Untervogt von Sissach, und Jakob Modlen
von Diegten (welch letzterer später unter die sieben Hingerichteten
gehören wird) «allererst das Versprechen, sie nicht gegen die Eidgenossen
(d. h. gegen die Aufständischen der andern Kantone) zu gebrauchen
und kein fremdes Volk durch ihr Land zu führen». Der Vogt
schlug dies natürlich ab; er konnte gerade in diesem Punkt unmöglich
seine Regierung im voraus binden. Trotzdem sollen sich «die Anwesenden»,
wenn auch nur «nach längerem Wortwechsel», für die «unbedingte
Unterwerfung» erklärt haben.
Dass dies jedoch nur die Minderheit gewesen sein kann — aus der
der Vogt dann natürlich auch die «Ausschüsse» zusammenstellte, die am
16. den Bittgang nach Basel tun mussten —, das geht aus einem schwerwiegenden
Widerspruch hervor, der sich in diesem Bericht Heuslers
findet. Unmittelbar nach der angeblichen «unbedingten Unterwerfung»
nämlich berichtet er von Wahlen —das heisst Mehrheitsentscheiden —,
die diese Versammlung vollzog, und zwar mit folgenden Worten: die
Bauern «wählten aber neue Ausschüsse, und unter diesen die fürnehmsten
Rebellen, namentlich jenen Hans Gerster von Gelterkinden,
Baschi Senn, Bruder des Untervogts von Sissach, und einen Hans Gysin
von Oltingen, welcher gesagt haben soll, die gnädigen Herren seien
vom bösen Geist besessen und können keine Wahrheit mehr reden»!
Das sind Worte, die ganz zweifelsohne die wahre und vorherrschende
Volksstimmung zum Ausdruck brachten, und es ist ja gewiss kein Zufall,
dass gerade auch der, der diese Worte sprach, in die «neuen Ausschüsse»
gewählt wurde. Das können aber nicht dieselben Ausschüsse
gewesen sein, die dann nach Basel gingen; sonst wäre das Ergebnis
ein anderes gewesen.
Auf ähnliche Weise —d. h. genau so zweifelhaft —erklärten sich
auch die anderen Aemter «für unbedingte Unterwerfung, und ordneten
ihre Ausschüsse mit dieser Erklärung in die Stadt ab». Mit andern
Worten: was da am 16. April in Basel sich abspielte, war ein von den
Vögten für die «Herren XIII» hergerichtetes Theater, das Wettstein
die Gelegenheit gab, vor aller Oeffentlichkeit seine gewöhnte Rolle als
«Friedensstifter» und als «gnädiger Vater seiner Kinder, der Untertanen»
zu spielen, um dafür alle späteren Anstrengungen des Volkes
zur Wiedererlangung seiner Rechte und Freiheiten von vornherein
umso schärfer als Hoch- und Landesverrat an der «gnädigen Obrigkeit»
brandmarken und danach bestrafen zu können. In diese Falle
gingen nur die Kapitulanten —und das ist ihr Teil der furchtbaren
Verantwortung an den späteren Greueltaten der Regierung am Volke,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 253 - arpa Themen Projekte
Jahrhunderte, von der erst die Folgen der französischen Revolution
das Basler Volk erlösten...
Den so zustandegekommenen «Ausschüssen» — blossen Statisten
in dem am 16. April in Basel aufgeführten Schaustück —liess also der
Rat, d. h. natürlich Herr Wettstein, eröffnen: 1. «Wegen der Soldatengelder
wollen Unsere gnädigen Herren (wie sie ohne dies zu thun gesinnet
und im Werk gewesen) dieselben ihren getreuen Unterthanen
vom Eingang laufenden Jahres an aus sonderbaren Gnaden nachlassen...»
2. «Wegen Salzes seien die Salzherren befelcht, ihnen (wenn
die Kasten für diessmal geleert) das Küpflin» (etwa 6½ Pfund) «um
2 Batzen, oder da sie es selber holen wollen, umb 3 Batzen näher zu
geben... auch Verordnung thun, dass die Salzmütter auf der Landschaft
keinen unziemlichen Vorteil mehr gebrauchen». 3. «Uebrige
Punkte, als welche theils die Landesordnung, theils die Herren Obervögte
betreffen, habe man den Herren Deputierten» (des Rats!) «zu berathschlagen
übergeben.. übergeben...»
Das ist Alles an bewilligten «Konzessionen». Nur der «sonderbar
gnädige» Nachlass des Soldatengeldes kann halbwegs als solche gelten;
obschon dieser ohnehin längst fällig war, da diese Steuer lediglich eine
Kriegssteuer für besondere Aufwendungen gegen den äusseren Feind
während des 30jährigen Krieges und dieser Krieg seit fünf Jahren zuende
war. Die Regierung hatte also dem Volk bereits fünf Jahre zuviel
Soldatengelder abgepresst. Die «Ringerung» des Salzpreises um 2-3
Batzen ist ein Hohn; denn das Regierungsmonopol auf das Salz und
der drückende Kaufzwang blieben, und die lukrativen Salzbussen erst
recht —denn die waren eine zu bequeme Bereicherungsquelle für alle
jungen Herren, die sich als Landvögte die Sporen der höheren Regierungskarriere
verdienen wollten. Schon Punkt 3 aber kehrt den Spiess
um zur Offensive gegen das Volk: er bedeutet, dass so wichtige Forderungen
desselben wie die, nicht als Bürgerkriegstruppe gegen die Klassengenossen
der andern Kantone verwendet zu werden —und überhaupt
alle politischen Forderungen —der diktatorischen Entscheidung
des Ratsausschusses ausgeliefert werden sollten, an dessen Spitze Wetttein
stand.
Dann tritt der totalitäre Polizeistaatcharakter vollends hervor in
der «angehängten Vermahnung» an die Bauern, «ihren neulich geschworenen
theuren und schweren Eid zu beobachten, sich vor den
fremden Aufwieglern, sonderlich Entlebuchern und Oltenern zu hüten,
denen kein Gehör zu geben, sondern sie ihren Obervögten zu rügen»
(d. h. zu denunzieren!), «auch sonst sich alles Gehorsams, Friedens und
Einigkeit zu befleissen, weil sonst U. gn. H. (Unsere gnädigen Herren)
ihr Missfallen alles Ernstes würden sehen lassen»! Dann ist noch davon
die Rede, dass derselbe Ratsausschuss, an dessen Spitze Herr Wettstein
steht, dafür zu sorgen habe, wie künftig «das obrigkeitliche Ansehen
manuteniert » werden solle, wie die «Unschuldigen» (d. h. solche
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 254 - arpa Themen Projekte
«wider allerhand Tätlichkeiten geschützt und ihres Leibes und Lebens
versichert», wie «den bösen Buben (!) ihr Unrecht zu erkennen gegeben
und hiemit den verderblichen Bündnissen der Unterthanen zuvorgekommen
werden möge»! Und zum Schluss wird der Polizeiknüppel
selber hervorgeholt und die Auslieferung eines «Rädlinsführers » anbefohlen:
«Ein Michel Murrt, Glaser von Liestal, der den Emmentalern
als Schreiber gedient und zu Liestal nicht wenig Ungelegenheit, die
sich von da in die Aemter ausgegossen, verursacht, ist auf Betreten gefänglich
nach Basel zu schicken»!
Kurz, dieses Basler «Versöhnungsinstrument» vom 16. April ist
eine hundertprozentige praktische Anwendung des Badener «Gemeinen
Mandates». Und da sollen wir es gläubig hinnehmen, wenn unsere
Herrenchronisten (mit Heusler) durch die Bank weg behaupten: «Mit
grosser Freude (!) wurde dieser Beschluss von den Ausschüssen vernommen,
und sie eilten nach Hause, um die frohe Botschaft (!) ihren
Gemeinden mitzuteilen»! Diese «Freude» werde «gleichsam von Allen
bezeugt», sogar von Uli Schad und Isaak Bowe... Das ist zuviel verlangt,
da muss etwas nicht stimmen.
Und in der Tat: während die Kapitulanten, die Ohrenträger und
die Verräter am 16. April in den «Ausschüssen» zu Basel sassen und
sich als stumme Statisten in dem von den Obervögten zum Gaudium
der Herren XIII zurechtgemachten Schaustück vor dem Träger der
Hauptrolle, vor Wettstein, eines über das andere Mal bis auf den Boden
Buckten —genau zu derselben Zeit machten die echten Revolutionäre
draussen auf der Landschaft ihre erste richtige Revolution! Sie
konnten also gar nicht in Basel anwesend gewesen sein...
Es ist wahrhaft herzerfrischend, was für ein Sturm da auf einmal
durchs Land fegte! Und es ist nur natürlich, dass dieselben Herrenchronisten,
die uns soeben von der «grossen Freude gleichsam von
Allen» an der jämmerlichen Demütigung der Kapitulanten-Ausschüsse
berichteten, angesichts dieses allgemeinen Landsturms förmlich den
Atem verlieren und uns weismachen wollen, dieser Vulkanausbruch
eines ganzen Volkes sei lediglich auf einen grossen Jux zurückzuführen,
den ein paar junge Burschen, «untergeordnete Dorflärmer» und
«von durchschwärmter Nacht erhitzte Gesellen», in einer Wirtschaft
in Oberdorf ausgeheckt hätten. Wir wollen hier diese wahrhaft kindische
Fratze, die die Herrenchronisten der historischen Wirklichkeit
übergezogen haben, dieser wieder abstreifen und das edle Antlitz dieses
spontanen Volksaufstandes wiederherzustellen versuchen. Wir brauchen
uns dabei nur auf die Nachrichten zu stützen, die diese Herren
selbst uns liefern.
Mit welch verräterisch inniger Teilnahme schildert doch Heusler
die Enttäuschung der Kapitulanten, als sie schon bei ihrem Aufbruch
von Basel am Nachmittag des 16. April Kunde von den neuen Ereignissen
auf dem Lande bekamen! Und wie viel tiefere Ursachen müssen diese
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 255 - arpa Themen Projekte
darüber schreiben muss! Heusler erzählt: «Als so die Ausschüsse frohen
und leichten Herzens die Stadt verliessen, kam ihnen unter dem
Aeschentor die Kunde zu von dem, was sich inzwischen auf der Landschaft
zugetragen. Schmerzhaft betroffen beschleunigten sie ihre Heimreise,
um dem Uebel zu steuern. Denn in demselben Augenblicke, als
die Obrigkeit den Beschwerden der Untertanen mit Abhilfe entgegenkam,
gingen im Amte Farnsburg Dinge vor, welche zeigten, wie tief
bereits das Ansehen von Gesetz und Recht erschüttert, in welche Gärung
die sonst in der Tiefe des Volkslebens schlummernden anarchischen
Kräfte übergegangen waren.»
Was war geschehen? Auf dem Land hatte sich gegen das Kapitulieren
vor der Regierung seitens der «Ausschüsse» und aller bisherigen
«Führer» eine wahre Wut angesammelt. Man hatte ja bereits einige
Erfahrung damit seit den «Verhandlungen» in Liestal, Gelterkinden
und Sissach und besonders seit dem Bittgang der «Ausschüsse» am
9. April nach Basel. Man fühlte sich durch deren angemasste Sprecher
und Leisetreter wie den Untervogt Jakob Wirz, den Amtspfleger J. J.
von Arx und andere verraten und verkauft. Bereits hatte sich ja diese
Wut in Gelterkinden an den Verantwortlichen in Prügeleien ausgelassen.
Da brauchte nur der bekannte Funke ins Pulverfass zu springen
—und das ganze Land ging in die Luft.
Dieser auslösende Funke, aber natürlich nicht die Ursache, war
ein durchaus sinnvoller Handstreich, den sich eine Gruppe von Oberdorfern
unter der Führung von Heid Erni und Xander Balz —die in
Oberdorf, wie wir sahen, von Beginn an in der Führung lagen —bereits
am Abend des 15. in der Wirtschaft in Oberdorf ausdachten und
sofort ausführten. Es war ganz logischerweise auf eine Strafexpedition
gegen alle erreichbaren Miesmacher und Kapitulanten abgesehen, und
zwar auf ihre Unschädlichmachung durch Gefangensetzung; in erster
Linie auf die Gefangennahme der beiden, die den Landschäftler Bauern
ihre ganze «Supplication» vom 6. April am 9. in Basel durch ihre
Unterwürfigkeit der Regierung gegenüber völlig verdorben hatten:
den Untervogt Jakob Wirz von Buus und den Amtspfleger von Sissach,
die es nach ihrer Verprügelung in Gelterkinden nicht mehr gewagt
hatten, abermals nach Basel zu gehen. Eine andere als Selbsthilfe, etwa
die Kaltstellung dieser von der Regierung bestellten und gestützten
Volksschädlinge durch Wegwahl oder andere politische Mittel, gab es
ja in einem politisch entrechteten Lande überhaupt nicht. Dass aber
die erdrückende Mehrheit des Volkes, nicht bloss eine Handvoll «untergeordneter
Dorflärmer», gegen diese Art von Vorteilfressern war,
bezeugt gerade die Schilderung des Herrenchronisten Heusler, wie aus
diesem «Streich loser Buben» innert 24 Stunden ein «wirklicher Landsturm»
wurde. Wir drucken den Bericht Heuslers hier in seinem vollen
Wortlaut ab:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 256 - arpa Themen Projekte
Johann Rudolf Werdmüller
Generalmajor (Generalstabschef) der von der Tagsatzung gegen
die Bauern aufgebotenen eidgenössischen Herren-Armee.
Nach einem Originalstich von Auvray in der Landesbibliothek
in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 256 - arpa Themen Projekte
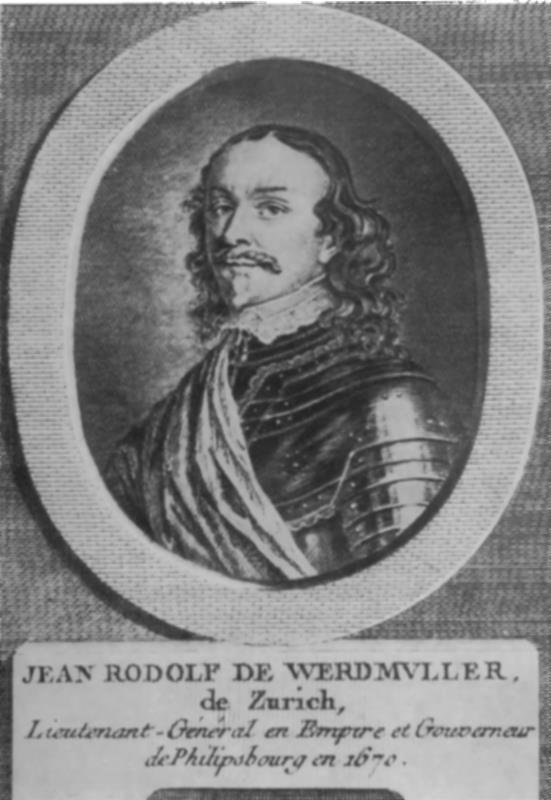
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 257 - arpa Themen Projekte
«Als nun am 5. (15.) Abends eine Anzahl untergeordneter Dorflärmer,
unter ihnen Hans Erni, genannt Heid Erni, und Balzer Waldner,
genannt Xander Balz von Oberdorf, in letzterem Orte zechten,
vernahmen sie, der Untervogt von Buus halte sich bei seinem Tochtermann
Martin Jenni, dem Senn auf dem obern Bölchen versteckt. Da
kam der Meyer des Alphofes Schwengi, Hans Stämpfli, zu ihnen und
erbot sich, sie über den Berg dahin zu führen. Ihrer 12 zogen mit ihm,
und als sie gegen den Bölchen kamen, liess sich der Schwengihans von
den Gesellen zum Schein binden, stossen, schlagen, um sich nachher
vor den andern Alpmeyern darauf berufen zu können, er habe nur gezwungen
bei dem Ueberfälle des Sennhofes den Weg gezeigt. So durchsuchten
sie den Sennhof, fanden aber den Untervogt nicht, worauf
Stämpfli sie ermunterte, ihn in Buus selbst aufzusuchen. Dieser Rath
fand bei den von durchschwärmter Nacht erhitzten Gesellen um so
leichter Eingang; sie rannten die Berghalde hinab nach Diegten, verstärkten
sich da mit freiwilligem und unfreiwilligem Zuzug, und stürmten
gleich einem durch Zuflüsse aus jeder Seitenschlucht anschwellenden
Waldstrom nach Sissach, nahmen hier den Amtspfleger von Arx
in seinem Wirthshause zur Sonne gefangen, und leerten ihm Küche und
Keller. Bereits hatte sich nun auch der Lärm dem Homburger Amte
mitgeteilt; von da kamen Schaaren nach Sissach, und was vorher ein
Streich loser Buben gewesen war, organisierte sich nun zum wirklichen
Landsturm. Unter Anführung von Amtspfleger Uli Gysin von
Läufelfingen, überfielen sie nun mit Ober- und Untergewehr die Dörfer
Gelterkinden, Ormalingen, Rothenflue, Anwyl, Oltingen, Wenslingen,
Zeglingen und andere, führten die treuen Beamten nach Sissach
ab und trieben allerlei Unfug. Der Vogt von Buus, auf den es zumeist
abgesehen war, hatte sich, zeitig gewarnt, nach Rheinfelden und
von da nach Basel geflüchtet; als sie ihn in seiner Wohnung nicht
fanden, entschädigten sie sich damit, dass sie allerlei Schaden bei ihm
anrichteten. —Gegen Abend kehrten die Ausschüsse aus der Stadt mit
dem günstigen Bescheide der Regierung nach Hause, worauf die Gefangenen
sofort wieder freigegeben wurden.»
Dazu ist nur noch Folgendes zu bemerken: wieso hatten die Bauern
es nötig, die ganze Reihe der angeführten Dörfer zu «überfallen»?
Merkwürdig, wo doch Heusler selbst sagt, dass ganze «Scharen»,
«gleich einem durch Zuflüsse aus jeder Seitenschlucht anschwellenden
Waldstrom», gen Sissach gestürmt seien und dass sich nun alles zum
«organisierten Landsturm» entwickelte! Woher sollte dieser gekommen
sein, wenn nicht eben aus den begeisterten «Zuflüssen» aus diesen Dörfern
selbst? Begeistert, ja: für den nur vorläufig allzu flüchtigen Traum
der Wiederherstellung des Rechts! Und leider wieder einmal —wie immer
in diesen Bauernkämpfen —mit ungeeigneten und nicht genügend
<>organisierten» Mitteln! Sodass der Begeisterungssturm ebenso rasch
wieder verfliegen konnte wie er aufgerauscht war und dass die heimkehrenden
Kapitulanten dank ihrem «günstigen Bescheide» —als welchen
sie den Fusstritt der gnädigen Herren submissest empfanden —
mit den ermüdeten und übernächtigten Landstürmern leichtes Spiel
gehabt zu haben scheinen...
Unser Herrenchronist beruft sich für sein Urteil über «die beiden
Urheber des Zuges» als «untergeordnete Dorflärmer» auf Uli Schad
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 258 - arpa Themen Projekte
genannt habe. Das kann sehr wohl sein; denn sie sind ihm offensichtlich,
ohne ihn zu fragen, einfach durchgebrannt, weil sie das blinde
Instrument des Volkszorns waren. Das mag den geltungssüchtigen
Basler Schybi umsomehr erzürnt haben, als es wohl stimmen wird, was
Heusler von Hans Erni, genannt Heid Erni, sagt, dass er «in den Akten
fast meist als ein ergebener Gehilfe von Schad» erscheine, «nirgends
aber als eigentlicher Führer». Ausserdem aber schildert Heusler den
Uli Schad selbst als einen, «der es mit den Mitteln nicht genau nahm».
Und schliesslich berichtet er auch, dass Uli Schad «im Anfange der
Bewegung krank» gewesen sei, sodass er möglicherweise nur wütend
darüber war, seine Führerrolle nicht schon in dieser ersten, gewissermassen
anonymen Rebellion durchführen zu können. Denn auch die
Anwesenheit Isaak Bowes in derselben ist nicht festzustellen; vielleicht,
weil die vom Waldenburger Amt aus im entfernteren Farnsburger Amt
vom Zaun gebrochene Bewegung in der Blitzesschnelle ihrer Entwicklung
nur noch das Homburger, nicht mehr das entlegenere Ramsteiner
Amt mitzuerfassen vermochte, wo Bowe zuhause war.
Tags darauf nun, am 17. April, am Gründonnerstag, als alle «Rebellanten»
längst wieder zuhause waren, schoss der Basler Rat mit 300
Mann Truppen gegen Liestal los, darunter 100 Mülhausern. Das tat
er sogar gegen den Rat des vorausgeschickten Zörnlin, den die Herren
XIII indigniert abfertigten, als er ihnen die inzwischen wieder eingetretene
Ruhe und die Freilassung der Gefangenen meldete. Letzterer
Meldung nicht achtend erklärten sie: «Es wäre das nicht dem obrigkeitlichen
Stande gemäss, getreue Unterthanen in böser Buben Gewalt
sitzen zu lassen, daher sollen die Truppen dort Poste fassen, das heisst
Liestal besetzen!
Das hatte gerade noch gefehlt, um endlich auch dieser Stadt den
Stachel des Zorns und der Empörung in die innerste Herzkammer zu
treiben. Denn Liestal war, ungeachtet noch mancher an Basel zu zählender
Steuer, die an ihre mittelalterliche Leibeigenschaft erinnerte (so
Manumissions-, Abzugs- und Zuzugsgebühren etc.), eine gegenüber den
Leuten der Landschaft unvergleichlich viel freiere Stadt, die stolz war
auf ihre Eigenrechte und sie auch bei viel geringeren Anlässen eifersüchtig
gegen alle Uebergriffe Basels verteidigte. Liestal war so frei,
«dass sogar von der (Basler) Regierung amtlich behauptet wurde, die
Obrigkeit habe die Liestaler, die doch erkaufte Eigenleute seien, freier
als ihre Burger und die Regimentsglieder selbst sitzen und wohnen
lassen». In der Tat wurden z. B. während des 30jährigen Krieges auf
die Stadt Basel «Lasten gelegt, mit denen man Liestal und das Land
verschonte». «Die Stadt Liestal hatte nicht nur ihre selbständige Munizipalverwaltung
unter einem durch Kooptation (eigenes Zuwahlrecht)
sich ergänzenden Rate von 18 Mitgliedern und zwei jährlich im Amte
wechselnden Schultheissen, welche der Form nach jedes Jahr durch
die (Basler) Regierung aus einem rechtlich unverbindlichen, aber faktisch
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 259 - arpa Themen Projekte
wurden. Sie hatte auch überdies eine Art von Regierungsrechten
über das aus den Dörfern Lausen, Seltisberg, Frenkendorf, Füllinsdorf
und Gibenach bestehende Amt Liestal. Schultheiss und Hat zu Liestal
behaupteten laut altem Herkommen das Recht, die Untervögte und
Meyer in diesen Ortschaften zu ernennen, der Schultheiss zu Liestal
hatte die Aufsicht über das Gericht Frenkendorf, die Mannschaft der
Dörfer stand unter den von Liestal ihr gesetzten Rottmeistern, und aus
allen Aemtern mussten die Masse in Liestal gefochten werden.» Das
Städtchen hatte mithin sogar eine winzige eigene «Armee» und selbstverständlich
eine eigene Stadtwache. Es hatte übrigens während des
dreissigjährigen Kriegs, den es ständig in nächster Nachbarschaft
hatte, starke Anstrengungen gemacht, seine nicht unbeträchtlichen Befestigungen
laufend zu verbessern. Ein im Juni, unmittelbar nach der
Niederschlagung des Aufstands, von Basel nach Liestal abgeordneter
Ratsherr, Jeremias Gemusäus, meldete dem Rat, «mit einer Art schreckhaften
Erstaunens», der Ort sei «mit festen Blätzen, Thürmen, Stückhen
(Kanonen), Geschoss, Munition und allerhand Defensionswerk dermassen
bewandt, dass man sich gegen etliche tausend Mann eine ziemliche
Zeit wehren und aufhalten könnte».
Nun hatte Liestal zu dieser Zeit zwei Schultheissen von ganz verschiedenem
Gepräge. Den einen, den erklärten Herrendiener Imhoff
kennen wir schon; er war seit 1650 im Amt und war zugleich Salz-
und Kornmeister; an ihm war im Jahre 1653 die Reihe als regierender
Schultheiss. Der andere, in diesem Jahr Altschultheiss, war Heinrich
Gysin, Schneidermeister; er war, hoch geachtet in Stadt und Land,
schon seit 1624 im Amt und war zugleich Zolleinnehmer; er stand jetzt
im achtzigsten Lebensjahr. Dieser achtunggebietende Mann nun, die
Verkörperung der Freiheitstradition der Liestaler, war zusammen mit
seinem feurigen Sohn Hans Gysin, einem Schuhmachermeister, die
Seele und Stütze der gesamten revolutionären Bürgerschaft Liestals,
und sie blieben es standhaft bis zum bitteren Ende. Grund genug für
einen Herrenchronisten wie Heusler, diese ehrwürdige Figur, die die
Sache der Rebellion umso sympathischer machen könnte, als er selbst
gestehen muss, Heinrich Gysin habe «zwar seit 29 Jahren sein Amt
untadelich geführt», nun wenigstens als altershalber unzurechnungsfähig
hinzustellen. «Der Aufgabe», sagt Heusler, «war er nicht mehr
gewachsen. Ihn beherrschte sein leidenschaftlicher Sohn, Hans Gysin
der Schuhmacher, den man den kleinen Schultheissen hiess; was dieser
wollte, musste sein, auch der Vater tat seinen Willen.» Aber selbst
Heusler erklärt: «Stadtschreiber Bischoff meinte ohne Zweifel den
Schultheissen Gysin, wenn er (22. Juni) schrieb: ,es sei unschwer zu
erachten, wenn nicht zu Anfang etliche ansehnliche Personen Wohlgefallen
an dem Aufruhr getragen, sondern bei guter Zeit dem glühenden
Funken ernstlich gesteuert hätten, so würde das Feuer nicht in so
grausame Flammen ausgebrochen sein'.» Und der Führer der revolutionären
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 260 - arpa Themen Projekte
Konrad Schuler, der als erster die Verbindung mit den Bauern aufgenommen
hatte, erklärte stolz noch vor dem Blutgericht, das ihn zum
Tode verurteilte: der Schultheiss Gysin «sei ein frommer Mann, sei bei
ihnen gestanden wie Moses», fügte aber, um ihn zu entlasten, hinzu, er
habe «kein ungeduldig Wort gegen die Obrigkeit nie geredt».
Nun ist leicht zu ermessen, welche Beleidigung es für die Bürgerschaft
dieser freiheitsstolzen kleinen Stadt bedeutete, als am Gründonnerstag
früh «die eine Basler Kompagnie, unter Hauptmann Ludwig
Krug, sich dem obern Tore nahte, dort ohne weiteres die Bürger mit
barschen Worten vertrieb und die Wache selbst übernahm, und als die
Mülhauser das gleiche bei dem untern Tore taten»! Es ist natürlich
nicht genug, wie Heusler zu sagen: es «entstand unter den Bürgern
grosser Unwille»; oder: «die Liestaler liefen zusammen und wollten
sie nicht übernehmen, doch wurden sie beschwichtigt und die Mannschaft
hereingelassen». Vielmehr bedeutete dieser Ueberfall der «Herren
XIII» von Basel —des Herrn Wettstein — auf die friedliche freie
Stadt, die an den Unruhen des Tags zuvor nicht einmal beteiligt war,
einen eklatanten Verrat an den Freiheitsrechten der Stadt aus rein
machtpolitischem Interesse, um sich nämlich einen festen Punkt
mitten in der Landschaft gegen die Bauern zu verschaffen. Recht war
eben auch für die Basler Herren, was ihnen nützte —aber dieser rechtsbrüchige
Missbrauch trieb, wie die Folge zeigen wird, die Bürger
Liestals nicht nur in die Arme der Basler Bauern, sondern geradenwegs
in den grossen Volksbund von Sumiswald und Huttwil!...
Doch vorläufig wollen wir hier nur noch zeigen, welches die unmittelbare
Wirkung auf das Verhältnis von Bürger und Bauer im
Baselland selber war.
«Die Kunde von dem Auszuge der Basler nach Liestal erregte im
Lande gewaltigen Lärm», berichtet Heusler. Die Bauern im ganzen
Land hatten kaum eben — am Tag zuvor —die Waffen abgelegt, als
sie diese fuchsteufelswild schon wieder anlegten und gegen Liestal
stürmten, wie sie tags zuvor gegen Sissach gestürmt waren. Wer hat
sie aufgeboten? Die Basler Herren beschuldigten die Liestaler, und
wenn auch diese keinen Anlass hatten, dies zuzugeben, so wäre es
doch naiv anzunehmen, dass jedenfalls die Revolutionäre unter den
Liestalern mit verschränkten Armen zugesehen hätten, wie die Basler
Herrentruppen ihre städtischen Rechte mit Füssen traten und die Bürger
als «Leibeigene» beschimpften. Gewiss haben die Aktivsten unter
den Bürgern, wie Konrad Schuler und der Schultheissensohn Gysin,
sofort Boten in alle Täler geschickt, um die Bauern, mit denen sie
längst gute Verbindung hatten, zur Hilfe aufzubieten.
Aber noch ein anderes Aufgebot erweckt unser besonderes Interesse:
«dass Arbeiter aus der Stadt (d. h. aus Basel!) das Reingoldswilertal
— die Reingoldswiler galten alle als ,hart', nur einer sei
,lind' — von dem Ausmarsche in Kenntnis gesetzt und dadurch umso
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 261 - arpa Themen Projekte
(Heusler!) «des vorigen Tages nur unvollkommen unterrichtet
sein mochte». Das zeigt uns, dass es selbst in der Hochburg des Herrengottesgnadentum
eine herrenfeindliche Partei gab. Und in der Tat
wissen wir —schon durch eine Nachricht vom 26. März —, dass «auch
in der Bürgerschaft ungleich geredt wurde» und deshalb die Einberufung
des Grossen Rates nötig gewesen war; also ähnlich wie in
Luzern.
Aber das Aufgebot ging nicht nur an die Basler Landschäftler,
sondern auch an die Solothurner; z. B. lief Urs Schweizer, Wirt von
Reigoldswil, über den Jura nach Mümliswil, um «die Oberländer aufzumahnen»,
d. h. die Aufständischen der übrigen, «oberen» Kantone
überhaupt! Darin zeigt sich, noch bevor ein förmlicher Bund geschlossen
war, die Wirksamkeit des nach dem Aarauer Zug durch die gemeinsame
Anstrengung der Berner, Solothurner und Basler Bauern
über dem ganzen Jura errichteten Wach-, Signal- und Botensystems.
«Der Lärm», berichtet Heusler, «verbreitete sich durch das ganze Waldenburger
Amt bis ins Solothurnische, von wo aus bewaffnete Scharen
über den Hauenstein aufbrachen».
So kam es, dass innert weniger Stunden —auch alles hier noch
Folgende läuft innert des einen Tages, des 17. April, ab —weit über
tausend gut gerüstete, grossenteils mit Musketen bewaffnete Bauern
vor den Toren Liestals lagen. «An der Spitze stand Hans Bernhard Roth
von Reigoldswil», berichtet Heusler (nach Vulliemin war es Uli Schad),
«ein Mann mit rotem Barte, der ein grosses Schlachtschwert führte,
das, wenn emporgehoben, die tiefste Stille, wenn zur Erde gesenkt,
das unsinnigste Toben und Wüten der Landstürmer hervorrief. Dieser
schickte den Trommelschläger Fridlin Tschudin von Lupsingen in
das Städtchen mit der Erklärung, sie wollten keine ,Spitzhosen' (Herrentruppen)
darin dulden, und bis Schlag drei Uhr müssten sie fort
sein; nach den Angaben der Liestaler» (welcher? Imhoffs und der
Seinen?) «wurde auch gedroht, im Gstadig, wo die Einwohner Scheunen
und Ställe hatten, zu brennen. Vergebens war nun alles Abmahnen,
vergebens liess Oberst Zörnlin unter Trommelschlag die gestrigen Zugeständnisse
der Regierung ausrufen, vergebens liess ihnen Schultheiss
Imhoff zwei Saum Wein (!) versprechen, wenn sie abziehen wollten»!
Zu dem Druck von aussen kam nun auch der Druck von innen.
Schultheiss Heinrich Gysin, ein Teil des Rates und zweifellos die erdrückende
Mehrheit der Bürgerschaft erzwang vom Obersten Zörnlin,
«gegen das Versprechen, den Abzug der Bauern zu bewirken», die Bewachung
der Tore wieder der Liestaler Bürgerwache zu übergeben.
«Aber die Bauern zogen nicht ab. Die Schultheissen» (? wahrscheinlich
Imhoff allein!) «befahlen nun, die Tore zu schliessen aber die Bürger
schnitten die Seile an den Fallbrücken ab, viele Bauern wurden hereingelassen,
die ganze Bürgerschaft lief zur Wehr, auch die Soldaten fassten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 262 - arpa Themen Projekte
von Höllstein, angeritten: er beschwor, man solle das Volk» (die Herrentruppen)
«abführen; von allen Orten, auch aus dem Solothurnischen
kommen Leute. Die Bauern drängten immer mehr dem Tore zu.»
Dabei spielten sich Szenen ab wie folgende. Von den Basler Truppen
und Offizieren wurden die Liestaler Bürger als «Leibeigene» insultiert,
die ihnen zu gehorchen hätten. Das nun war der böseste Schimpf,
den man den Liestalern antun konnte, gerade weil tatsächlich, wie wir
sahen, noch Reste von Leibeigenschafts-Steuern sie an die Basler Herren
banden. «Ihnen grauste», wie der Schultheissensohn Gysin sagte,
«vor der Leibeigenschaft», und «als Wortwechsel zwischen Soldaten
und Bürgern stattfanden... wurde daher abgeredt, Bürger von Basel,
die ihnen die Leibeigenschaft vorhalten würden, ziemlicher Massen zu
schlagen». Was denn wohl auch geschehen ist. Aber nicht nur in
Liestal «auch in den übrigen Aemtern» gab es, genau wie in Luzern,
genug solcher, «welche vermeinten, die Obrigkeit habe nicht Land und
Leute, sondern nur Zins und Zehnten gekauft». So hat sie der Sekretär
des Liestaler Stadtschreibers, Stähelin, an die Herren denunziert. Eine
tapfere Reigoldswilerin, Margrit Barthlome, wagte es z. B., zu sagen:
«sie wollten nicht wie bisher erkaufte Leute genannt werden, man sei
seither» (seit dem 14. Jahrhundert!) «für den Kaufschilling durch allerhand
Einnahmen wohl wieder bezahlt worden...»
War dies schon Grund genug für die Liestaler Bürger, sich auf
die Seite der Bauern zu schlagen, um auch diesen letzten Rest des mittelalterlichen
Joches mit ihrer Hilfe abzuwerfen, so reizten sie andererseits
besonders die Waldenburger in ihrem Stolze auf durch Reden
wie die: «Wenn wir Stücklin (Kanonen) hätten, wie die Liestaler, so
wollten wir durch die ganze Welt ziehen, Gottes Freund und aller Welt
Feind sein!» Oder sie versprachen geradenwegs, «sie wollten einen Ort
der Eidgenossenschaft aus Liestal machen!» Was ja auch der Traum
der Entlebucher und der Willisauer war. Und was schliesslich 1832
zur Tatsache wurde.
Der Ausgang des Liestaler Zuges war für Zörnlin und seine Auftraggeber,
die Herren XIII, eine womöglich noch schmählichere Niederlage
als der des Aarauer Zuges. Zwar wollten die Hauptleute «nun auf
Bauern und Bürger losgehen, aber die Ratsdeputieren erinnerten sie,
dass sie nichts Tätliches unternehmen dürfen, gingen dann zu den
Bauern hinaus, die sie durch Zureden so lange aufhielten, bis die Soldaten
abgeführt werden konnten». Auf dem Heimwege wurde noch
durch Leute von Füllinsdorf auf dieselben geschossen und ein Soldat
aus Mülhausen verwundet. «Nach Abzug der Basler zogen auch die
Bauern wieder nach Hause. Die Solothurner blieben dann über Nacht
in Langenbruck und Waldenburg, und am folgenden Tag, Karfreitag,
wurde dann von einzelnen der Gedanke betrieben, mit denselben vor
Basel zu ziehen... Daniel Jenny, der Sattler zu Langenbruck, wurde
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 263 - arpa Themen Projekte
er sei der Meinung gewesen, die Mümliswiler sollten bis Muttenz
ziehen und die Stadt fragen lassen, ob Freund oder Feind?... Heid
Erni äusserte in einem Verhöre, nur junge Buben hätten von einem
Zuge gegen Basel gesprochen, sie wollten alle reich werden, wenn sie
Basel bekommen.» Aber es war nicht nur ein Bubengespräch; weit im
Volke herum ist seither immer wieder von einem «Zuge der Oberländer
gegen Basel» die Rede gegangen, wenn dieser Zug auch nie ausgeführt
wurde wie der gegen Luzern oder der gegen Bern. So hören wir beispielsweise
auch von der wackeren Reigoldswilerin Margrit Barthlome
wieder, sie habe gehört, <'die Berner werden für Basel ziehen, die Stadt
in Rhein stürzen, und gingen die Basler Unterthanen nicht so gern an
eine Hochzeit als begierig sie sind, diesem Werk zuzusehen»! Ein Solothurner
äusserte: «er wollte ohne Blutvergiessen nach Basel kommen,
denn die halbe Bürgerschaft sei auf der Bauern Seite»!
So muss also dieser Gründonnerstag als ein grosser Sieg des Basler
Volkes über seine Herren bezeichnet werden: als eine Demütigung der
Herren XIII und insbesondere Wettsteins, mit der das Volk die ihm
am Tag zuvor von diesen Herren zugefügte Demütigung mit bewundernswerter
Promptheit völlig wieder auslöschte. Selbst Heusler muss
lamentierend gestehen: «Diese Vorgänge verwischten nicht nur vollständig
den guten Eindruck der Tags zuvor gemachten Zugeständnisse,
sie erschütterten auch das Ansehen der Regierung aufs tiefste.»
Damit waren denn sowohl die Landschäftler Bauern wie die
Liestaler Bürger als dafür reif erwiesen, in den grossen, nun mit Riesenschritten
zur umfassenden schweizerischen Volkserhebung heranwachsenden
Volksbund aufgenommen zu werden. Nur sieben Tage
noch —und die Abgesandten aller aufständischen Teile der Eidgenossenschaft
trafen sich in Sumiswald zur ersten feierlichen Beschwörung
dieses Bundes!
Am Ostertag, den 20. April, «fand dann eine Zusammenkunft in
Höllstein, in der Wirtschaft des Amtspflegers Gysin, statt», auf der
zweifelsohne die Delegierten der Basler Landschaft zum grossen Sumiswalder
Volkstag bezeichnet wurden, an deren Spitze Isaak Bowe, Uli
Schad, Uli Gysin, der Amtspfleger von Läufelfingen, und Baschi Wirt:
von Sissach, als offizielle Vertreter der Aemter Ramstein, Waldenburg,
Homburg und Farnsburg. Denn bereits am folgenden Tag, am Ostermontag,
den 21. April zogen Ausschüsse aus der Landschaft Basel unter
Führung dieser Männer, sowie Joggi Mohlers von Diegten, über die
Kantonsgrenzen, um an der grossen Landsgemeinde der nun wieder
revolutionär gewordenen Solothurner in Oberbuchsiten teilzunehmen,
wo ebenfalls Abgeordnete für Sumiswald gewählt wurden, trotz
flehentlichen Bittens der Solothurner Regierung, davon abzustehen,
und trotz des obrigkeitlichen Aufgebots zweier engelszüngiger Kapuziner,
die «das Verbrechen des Hochverrats in seiner ganzen Abscheulichkeit
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 264 - arpa Themen Projekte
auch auf eine ganze Schar von Willisauern und Entlebuchern,
die auf allen in diesen Tagen im gesamten Aufstandsgebiet aufgebotenen
Amts- und Kantonalgemeinden allgegenwärtig waren, um das Feuer
des grossen Bundes für seine Stiftung und Beschwörung in Sumiswald
anzublasen...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 265 - arpa Themen Projekte
XII.
Die «Entlebuchischen boessen Botten» und die
«Wildsau von Willisau» —«in Suchung der Erwyterung
ihres schaendtlichen Pundts»
Die Entlebucher und Willisauer, Bauern und Bürger, waren und
blieben die tätigsten und leidenschaftlichsten Propagandisten für den
neuen Bund. Standhaft verweigerten sie jede Anerkennung des gefälschten
«Rechtlichen Spruchs» und liessen sich zu keiner neuen Huldigung
auf die Kniee zwingen. Denn das hätte die Abschwörung ihres alten, des
Wolhuser Bundes bedeutet —und den galt es um jeden Preis zu retten,
weil er für sie das Sprungbrett zum neuen, grösseren Bunde war.
Was aber führte den Umschwung herbei, der schliesslich die Verwirklichung
des grossen Planes der Entlebucher und der Willisauer
ermöglichte? Zwei geschichtliche Hauptmotive zu diesem Umschwung
treten in allen bisherigen Darstellungen des Bauernkriegs —bald getrennt,
bald gemeinsam, oft auch nur eines von beiden —hervor: die
Beschimpfung und Bedrohung der Bauern durch das «Gemeine Mandat»
der Tagsatzung vom 22. März, sowie die Beleidigung des Rechtsgefühls
der Bauern durch den zynischen Vorbehalt der Berner Regierung
bei ihren «Konzessionen» vom 4. April, diese nach ihrem Belieben
zu mindern, zu mehren oder auch ganz abzutun. Wir können die allgemeine
Auffassung so ziemlich aller Geschichtsschreiber des Bauernkriegs
über die Rolle dieser beiden Motive, besonders was das Badener
Mandat betrifft, mit dem Satz Liebenaus kennzeichnen: «Diese gegen
die gemeinsame Ehre der Bauern und die Freiheiten der zahlreichen
Gemeinden gerichteten Worte bildeten den Vereinigungspunkt für die
neue Erhebung.»
Jedoch wir bezweifeln, dass die blosse Wirkung von noch so starken
Worten, mag diese Wirkung so unleugbar und so tief sein, wie sie
wolle, hingereicht hätte, um eine konkrete geschichtliche Bewegung
von solchem Ausmass und insbesondere den faktischen grossen Zusammenschluss
aller revolutionären Kräfte gerade der Bauern zustandezubringen,
der nun in Gang kam. Wir suchen also noch nach anderen,
geschichtlich greifbareren Motiven.
Schwerlich dazu zu zählen sind die «Gründe», die eine solche
Koryphäe der Schweizergeschichtsschreibung wie Hans Nabholz nicht
ansteht, uns für den grossen Umschwung im Bauernkrieg (allerdings
in einer Arbeit, die schon 40 Jahre zurückliegt) anzugeben. Waren
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 266 - arpa Themen Projekte
Fälschung des «Rechtlichen Spruchs» für Nabholz «bloss Vorwände,
um weiter im Ungehorsam verharren zu können», so fährt er nun, um
den grossen Umschwung zu erklären, folgendermassen fort: «Die Bauernführer
gefielen sich als Leiter und Gebieter und gaben diese Stellung
nur ungern wieder auf. Auch den Bauern selbst war mit dem Essen der
Appetit gekommen...»! Diese tiefsinnige Erklärung konnte Nabholz
allerdings schon bei Liebenau lesen, der das Motiv des Umschwungs
ebenfalls im «Entschluss der Dorfkönige, von der einmal erlangten
Stelle nicht wieder abzutreten», erblickt; und Liebenau hatte es von
Vock, und Vock von den Luzernischen Herrenchronisten der Bauernkriegszeit
Cysat und Wagenmann. Aber Nabholz fährt unmittelbar
fort: «Immer deutlicher trat zu Tage, dass die ganze Bewegung ihren
Charakter zu verändern anfing. Die Untertanen begnügten sich nicht
mehr damit, Erleichterungen von einzelnen, allzudrückenden Lasten
zu verlangen, sozialistische und revolutionäre Pläne stiegen in ihnen
auf...» (Liebenau schrieb: « ... sozialistische Tendenzen traten nackter
als je hervor»!) «... die umso schneller zu widersinnigen Phantomen
anwuchsen, je geringer ihre Einsicht in die Organisation und die
Bedürfnisse eines Staatswesens» (notabene: des absolutistischen Herrenstaates!)
«waren. Es erwachte die Lust...» (Liebenau schrieb —
nach Cysat-Wagenmann —: «Immer allgemeiner wurde die Revolutionslust»!)
«... überhaupt keine Zinsen und Zehnten mehr zu bezahlen,
Handel und Verkehr mit der Hauptstadt abzubrechen und vor
allein einen grossen Bund zu stiften». Man denke — aus purer «Lust»!...
Doch wir suchen nach einem ernsthaften historisch-politischen
Ereignis, das wirklich ursächlich erklärt, warum es den Entlebuchern
und Willisauern gerade zu diesem Zeitpunkt, um die Wende vom März
zum April, gelang, die — ausser in ihrem eigenen Gebiet —derart zerstreuten
und anarchischen Kräfte ihrer Revolution zu sammeln und
binnen drei Wochen in einem grossen, überkantonalen Bund zu organisieren.
Höchst merkwürdig mutet es uns an, dass bei sogut wie allen Geschichtsschreibern
des Bauernkriegs ein historisches Ereignis. das
sie doch alle nennen und zum Teil sogar ausgiebig schildern und das
zeitlich ausgesucht an der richtigen Stelle sitzt, um seinen ursächlichen
Zusammenhang mit dem entscheidenden Umschwung im Bauernkrieg
auf den ersten Blick zu erkennen, überhaupt nicht unter den von ihnen
gegebenen Motivierungen für diesen Umschwung erscheint: ich meine
den Aarauer Zug der Basler Herrentruppen vom 28./29. März, als von
der Basler Regierung eigenmächtig durchgeführtes Teilstück der ersten
eidgenössischen Exekution gegen die Bauern im Bauernkrieg. der von
der Tagsatzung am 21. März mit dem «Defensionalwerk» beschlossenen
und vom Vorort am 25. März mitten in der Durchführung unterbrochenen
militärischen Exekution.
Einen einzigen historischen Schriftsteller gibt es, bei dem dieses
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 267 - arpa Themen Projekte
auch wirklich nicht mehr): es ist der Zürcher Herrenchronist G. J. Peter,
der Geschichtschreiber des Zürcher Anteils am Bauernkrieg. Auch
bei ihm zwar erscheint dieses Motiv nicht in der richtigen Auswertung.
Aber er erkennt dieses Ereignis doch wenigstens in seiner Wirkung
als militärische Provokation und er bringt diese in ursächlichen
Zusammenhang mit der Entstehung des neuen Bundes. G. J. Peter berichtet
zunächst, wie die Luzerner sich mit den Berner und Solothurner
Bauern in Verbindung setzten und fährt dann fort: «Denn es kam
unter den Luzerner Bauern das Gerücht auf» (hier müsste es heissen:
es bildete sich aus der bitteren Erfahrung mit der Tagsatzung die begründete
Ueberzeugung!), «sämtliche Obrigkeiten hätten zu Baden
einen Bund wider die Untertanen geschlossen und man wolle die Landschaft
Luzern mit Waffengewalt zum Gehorsam zwingen, und als die
Solothurner Bauern einen Brief des Bischofs von Basel auffingen, worin
er sich bereit erklärte, seine Truppen gemäss dem badischen Abschied
marschbereit zu halten und als Bericht einlief, dass die Basler
und Mühlhauser Truppen bereits bis nach Aarau vormarschiert seien,
um offenbar nach Luzern vorzurücken, erwachte bei den Willisauern
der Gedanke, dem Bunde der Regierungen und zum Schutze dagegen
sei ein grosser Bund der gesamten unzufriedenen Bauernschaft entgegenzustellen.
Dieser Gedanke zündete.»
Nun ist zwar der Bundesgedanke nicht erst dadurch erwacht und
nicht erst bei den Willisauern —aber «zündend» ist dieser, von den
Entlebuchern längst ausgebrütete Gedanke in der Tat erst durch den
Aarauer Zug und seine Folgen auf sämtliche Aufständischen der Schweiz
übertragen worden. Durch diesen Zug nämlich, d. h. durch eine Exekution
von Herrentruppen in eidgenössischem Dienst, aus dem Hoheitsgebiet
der einen Regierung in dasjenige einer andern, wurde der von
den Entlebuchern, dann von den Willisauern und schliesslich von allen
Luzerner Bauern von jeher hartnäckig festgehaltene Verdacht des
«Ueberfalls fremder Truppen» in den Augen aller Schweizerbauern, ja
auch aller Bürger der abhängigen Städte, glänzend gerechtfertigt!
Denn «fremde Truppen» bedeutete nicht etwa nur nichtschweizerische
Söldner wie die «gefrorenen Welschen», sondern überhaupt
Hilfstruppen der Herren untereinander, der einen Regierung an die
andere, zum Zweck der Niederhaltung von Volksbewegungen in deren
Gebiet. «Die Regierungen sollten» —wie Liebenau das Begehren der
Bauern in dieser Hinsicht richtig interpretiert — »weder einheimische,
noch fremde Soldaten gegen die Untertanen zu den Waffen rufen, sondern
die allfälligen Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht entscheiden
lassen, bestehend aus Vertretern der Regierungen und der Untertanen.»
«Fremde Truppen» waren also in den Augen aller Unterdrückten und
Ausgebeuteten klar als solche erkannte Bürgerkriegstruppen, d. h. das
Unterdrückungsinstrument einer durch alle Kantone durchgehenden
herrschenden Klasse gegen die Klasse der Unterdrückten. Durch die so
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 268 - arpa Themen Projekte
Regierungen untereinander sollte seitens der durch sie bedrohten
Bauern und Bürger nicht nur die eigene Regierung als Verräterin und
Unterdrückerin des eigenen Volkes mittels fremder Gewalt gebrandmarkt
werden. Vielmehr galt der ganze lodernde Hass des Volkes eben
der Vereinigung der Herren zu diesem Zweck, d. h. dem von den Bauern
selbst so getauften «Herrenbund».
Sein militärisches Gesicht nun hatte der Herrenbund zum erstenmal
eindeutig im Aarauer Zug allem Volk vor Augen geführt, wenn
auch nur in einem im Verhältnis zum Ganzen des Badener «Defensionals»
eher lächerlichen Bruchstück. Tatsache war: die Regierung
des zuletzt in die allgemeine Bauernbewegung einschwenkenden Kantons
hatte als erste einen solchen gefürchteten und berüchtigten «Ueberfall
fremder Truppen», die erste militärische Exekution auf anderem
als dem eigenen «souveränen» Herrschaftsgebiet, mithin die erste eidgenössische
Exekution, vor aller Welt vollzogen. Gerade der Umstand
nun, dass diese erste eidgenössische Aktion, dank der so leidenschaftlichen
Gegenwirkung des bewaffneten Volkes ohne Ansehen der kantonalen
Zugehörigkeit, so jämmerlich scheiterte, gerade dies gab dem
Volk den von da an ungeheuer anschwellenden Glauben an die Möglichkeit,
seine Rechte und Freiheiten durch dieselben Mittel zu schützen
und zu erkämpfen, durch die die Herren sie zu unterdrücken suchten:
durch Vereinigung aller Volkskräfte zu einem ebenfalls überkantonalen
«Volksbund» (auch diesen Namen haben die Bauern ihrem
Bund selber gegeben) und durch militärische Organisation!
In der Tat war die sofortige Wirkung des Aarauer Zuges —und
also die erste konkrete Form eines faktischen, wenn auch noch nicht
formell beschworenen Bundes — die einer Verbindung über alle Kantonsgrenzen
hinweg zum gegenseitigen bewaffneten Schutz gegen das
Ueberzogenwerden mit «fremden Truppen». Die erste unmittelbarste
Folge nämlich war die, dass das militärische Wach-, Signal- und Bereitschaftssystem
der Bauern, das die Entlebucher erfunden, die Willisauer
und Rothenburger in allen zehn Aemtern eifrig entwickelt und
die Emmentaler schon früh von den Entlebuchern übernommen hatten,
sich nun mit einem Schlag auf alle übrigen aufständischen Gebiete,
und besonders intensiv auf die allerjüngsten, ausbreitete: auf alle
Brücken, Strassen, Bergpässe und Hochwachten im Ober- und Unteraargau
und in den Freien Aemtern, auf den ganzen Jura vom Weissenstein
bis zu den Lägern und das ganze Baselbiet hinab bis vor die
Tore Basels.
Die andere, kaum weniger unmittelbare Folge war eine grundlegend
politische. Jetzt endlich sah auch der dümmste Bauer in allen
von der Unruhe erfassten Gebieten ein, dass jede lokale Selbsthilfe
gegen eine Regierung, die von vielen verbündeten Regierungen jeden
Tag Truppen bekommen konnte, zwecklos und nichts als verpuffte
Kraft war; dass also nur die grosse Zusammenfassung aller Kräfte in
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 269 - arpa Themen Projekte
schuf, die Rechte und Freiheiten des ganzen Volkes gegen den
Herrenbund der Räuber dieser Rechte und Freiheiten durchzusetzen.
Wie positiv in diesem Sinne die Rückwirkungen gerade des
Aarauer Zuges waren, geht schon aus der galligen gegenseitigen Kritik
hervor, die sofort nach dem Misslingen dieses Zuges unter den Herren
selbst einsetzte. So schrieb der Basler Rat — also Wettstein — die
Schuld daran dem Versagen der anderen «Miteidgenossen» inbezug auf
die Ausführung der Badener Beschlüsse zu. Wie dem Zürcher Rat, so
schrieb er auch dem Berner Rat am 31. März — vom Herrenstandpunkt
aus ganz richtig —: «dass man am besten getan hätte, die Beschlüsse
der Tagsatzung von Baden in Bezug auf die Bewaffnung und die Verteidigungsanstalten
vorerst einmütig und genau zu vollziehen und dann
erst sich in Unterhandlungen mit den Bauern einzulassen». (Verhandlungen
unter dem Druck militärischer Gewalt: das also war, nebenbei
gesagt, das offen eingestandene Ziel des «Friedensstifters» Wettstein
dem eigenen Volk gegenüber!). In einem anderen Satz dieses Schreibens
nun malt der «starke Mann» des Basler Regiments den Miteidgenossen
den Teufel an die Wand, den sie dadurch heraufbeschworen
hatten, dass sie seine Exekution im Stiche liessen: «Aus solchen widersprechenden
und veränderlichen Beschlüssen werde nur grössere Verwirrung
und Unruhe hervorgehen, die Verzögerung und Unentschlossenheit
der Regierungen die Rebellen mutiger und unternehmender
machen und auch die bisher noch treuen Untertanen der Gefahr der
Verführung preisgeben.» Gerade das aber lag im Interesse der Bauern,
im Interesse ihrer Rechte und Freiheiten! Der Berner Ratsherr und
Venner Willading zahlte die Vorwürfe Wettstein persönlich heim in
einem Schreiben vom 2. April, in welchem er das Verhalten der Basler
Regierung als Provokation blosstellt (scheinheilig genug, denn sie war
ja vom Berner Rat ausgegangen, als da die Kriegspartei noch obenauf
war!), indem er schreibt: das Verhalten der Basler Regierung habe den
Bauern im Aargau «ein Herz gemacht, sich gleich denen im Emmental,
ja noch ärger, zu empören; jetzt seien die Bauern Meister und schrieben
vor, was sie wollten»! Gerade dies aber zeigt, wie positiv die Rückwirkungen
des Aarauer Zuges für die Sache der Bauern war.
Kein Zweifel also: dieser Aarauer Zug machte in der ganzen
Schweiz die wirksamste Propaganda für die Sache der Bauern. Nicht
nur trieb er die eigenen Bauern der Basler Regierung erst eigentlich
gegen sie in die Waffen; nicht nur versetzte er die von diesem Zug betroffenen
solothurnischen und bernischen Aemter in hellen bewaffneten
Aufruhr. Er ist durch die eben auseinandergesetzten Rückwirkungen
vielmehr zum eigentlichen historisch-politischen Geburtshelfer des
Sumiswalder und Huttwiler Bundes geworden.
Es war darum sehr logisch und konsequent von den Entlebuchern
und den Willisauern, den Aarauer Zug sofort, ohne einen Tag zu verlieren,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 270 - arpa Themen Projekte
möglich auch gleich die Bürgerschaft der Hauptstadt, wieder zu mobilisieren
und für ihre neuen, grossen Absichten fest in die Hand zu
bekommen. In der Tat stellten sie schon seit dem 28. März im ganzen
Land herum wieder Wachen auf und sperrten bald auch wieder, so
viel an ihnen lag, die Zufuhr von Korn und Vieh in die Stadt Luzern.
«Die mit der Ausstellung der Wachen gleichzeitig beginnende Sperre
gegen die Städte» —sagt Liebenau — «hatte den Zweck, die Bürger»
(d. h. die rebellisch Gesinnten der Stadt Luzern sowohl wie die anderer
Städte) «gegen die Regierungen aufzureizen. Von dieser Massregel
versprachen sich die Bauern den Sturz der ihnen verhassten Aristokraten.
Gerade deshalb knüpfen die Häupter der Revolutionäre in den kritischen
Momenten immer neue Verbindungen mit den Bürgern an...»
In der Tat berichtet der Luzerner Priester Jodokund Knab, der im
Jahr 1653 zum Bischof von Lausanne erhoben wurde, unterm 8. April:
«Die Bürger in hiesiger Stadt haben sich neuerdings erhoben und verlangen...
auch ihrerseits Zutritt zum geheimen Rate und die Berechtigung,
an den Ratswahlen teilzunehmen. Obwohl ihnen bei Todesstrafe
(!) verboten worden ist, Zusammenkünfte zu veranstalten, versammeln
sie sich gleichwohl fast täglich in ihren gewohnten Lokalen.»
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass sie dies nur in Verbindung
mit dem wieder mächtig anwachsenden Aufstand der Bauern im
Lande draussen wagen durften. Dennoch vermochten die Bauern diese
latente Bundesgenossenschaft nicht auszunützen. Dazu fehlte sowohl
ihnen wie den Bürgern von Luzern einstweilen noch das volle Bewusstsein,
worum es ging, und den Bürgern wohl auch der Mut. Denn auf
alle Verbündungsversuche der Bauern erklärten die Bürger nach Liebenau
«konsequent: wir wollten gern zu euch fallen, aber wir dürfen
nicht»!
Die fieberhafte Errichtung von Wachposten, die die Entlebucher
zusammen mit den Emmentalern hauptsächlich deshalb betrieben,
um Briefe der Herren untereinander über militärische Pläne abzufangen,
tarnte Hans Emmenegger übrigens mit der Vorgabe, «Mordbrenner
haben sich heimlich ins Gebiet von Bern und Luzern eingeschlichen».
«N. Willading von Bern dagegen bezeichnete in einem Schreiben
an den Abt von St. Urban die angeblichen Mordbrenner als Emmissäre
der revolutionären Emmentaler»! Das war in denselben Tagen,
als die andern Emmentaler mit Leuenberger an der Spitze nach Bern
gingen, um dort den Fussfall zu tun.
In eben diesen Tagen strengten sich die Luzerner Herren gewaltig
an, es den Berner Herren gleich zu tun, «Konzessionen» zu versprechen,
die man entschlossen war, nicht einzuhalten und auf Grund dieses
Köders von den Aemtern die neue Huldigung und damit die Anerkennung
des gefälschten «Rechtsspruchs» zu erschleichen. Aber der Erfolg
dieser vielen «Umritte» der Herren —denn von den Luzerner
Bauern war, ausser natürlich den heimlichen Spionen und Kapitulanten,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 271 - arpa Themen Projekte
am 5. April in den Landvogteien Malters, Büron, Triengen und Knutwil
«huldigte», waren winzige Grüppchen von Kapitulanten und
Ohrenbläsern, die die Herren selbst nicht ernst zu nehmen vermochten.
«Am 4. April sollte Kriens dem Landvogt Jost Pfyffer huldigen;
allein es kam zu einer ,Affront' und der Landvogt kehrte unverrichteter
Dinge heim.» «Als Schultheiss Dulliker und Rudolf Mohr in Ruswil
erschienen, fanden sie nur den vierten Teil der Bevölkerung auf
dem Platze; sie begnügten sich aber damit und nahmen die Huldigung
vor. In Horw war so wenig Volk anwesend, dass die Beerdigung auf
den 6. verschoben wurde.» Usw.
Einen Erfolg allerdings brachte diese Kampagne den Herren ein:
Kaspar Steiner fiel wieder um, ja, er spielte ihnen sogar — wenn auch
sehr vorübergehend —das ganze Amt Rothenburg wieder in die Hände!
Diese traurige Figur glaubte, für ihre ehrgeizigen Pläne wieder einmal
auf den Sieg der Herren setzen und deshalb sich um sie verdient machen
zu müssen. Darum «gelang es —wie Liebenau berichtet —der
Regierung von Luzern, anlässlich der am 3. April nach Rothenburg
einberufenen Gemeindeversammlung, den Demagogen Kaspar Steiner
für sich zu gewinnen, worauf das ganze Amt Rothenburg der Stadt
Luzern unter der Bedingung» (das war Steiners demagogisches Feigenblatt)
«huldigte, dass den übrigen Aemtern ihre Freiheiten und Rechte
bestätigt werden». Das war Kaspar Steiners zweiter Eidbruch gegenüber
seinen Wolhuser Schwurgenossen.
Bevor aber die Herren diesen Erfolg mit Hülfe Steiners weitertreiben
konnten, warfen ihnen die Entlebucher einen erratischen Block
in den Weg, wie nur sie es vermochten. Sie waren ja bei den Aelplersportfesten
der Innerschweiz immer die berühmtesten Steinstosser. Als
am 6. und 7. April eine feierliche Ratsabordnung mit Schultheiss Fleckenstein
an der Spitze —in Begleitung der beiden «Ehrengesandten»
Beat zur Lauben von Zug und Landammann Schorno von Schwyz und
des zu den Herren übergelaufenen päpstlichen Protonotars und Dekans
zu Ruswil Melchior Lüthard —überraschend ins Entlebuch kam, der
Meinung, durch solch ansehnlichen Aufmarsch das Land überrumpeln
und zur Huldigung bringen können, da liess sich der Landespannermeister
Hans Emmenegger «krank melden' und sein Stellvertreter,
der Landesfähnrich, «machte sich heimlich davon»! In der Kirche von
Escholzmatt, «vor nur 500 Personen, hielten Fleckenstein, der Dekan
und Landesammann Schorno zierliche Reden». Dann verlangte der
Weibe! Emmenegger, Hansens Vetter: «zuerst soll der Artikel 9 des
Spruchbriefes gestrichen werden». Das war der berüchtigte, von Zwyer
eingeschmuggelte Hauptartikel zur Verfemung des Wolhuser Bundes!
Alsdann verlangte der Landeshauptmann Glanzmann, dass «die hinterhaltenen
Urkunden ausgehändigt werden, damit sie sehen, welche
Rechte sie besitzen». Schliesslich, und das schien schon der Gipfel:
«Das Mandat der 13 eidgenössischen Orte vom 22. März soll aufgehoben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 272 - arpa Themen Projekte
Johann Georg Werdmüller
|
Zürcher Ratsherr und Militärdirektor, |
Generalfeldzeugmeister der von der Tagsatzung gegen die Bauern
aufgebotenen eidgenössischen Herren-Armee.
Nach einem Originalstich von Conrad Meyer in der Landesbibliothek
in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 272 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 273 - arpa Themen Projekte
werden. Die Tagsatzung solle dasselbe widerrufen und durch eine
Druckschrift eine Ehrenerklärung der 10 Aemter verbreiten»!
Dann aber trat der Bundeskanzler des Wolhuser Bundes, der
tapfere Schulmeister Müller, hervor und fragte den Schultheiss Fleckenstein
ins Gesicht: «Im Spruchbrief ist wohl die Rede von den Strafen,
welche die 10 Aemter treffen sollen, wer soll aber die Obrigkeit
strafen, wenn sie Fehler begeht?» Darauf Schultheiss Fleckenstein
empört: «Gott!» Als darauf aber der Pfarrer von Escholzmatt, ein
«Linder», in dieselbe Kerbe hauen und zugunsten der Regierung von
Gottesgnaden das Wort ergreifen wollte, da entstand «ein arger Tumult»,
und er wurde von den Bauern unsanft vor die Kirchentüre gesetzt!
Jetzt verlangten die Rädelsführer der Bauern: zuerst soll die
Obrigkeit schwören, dass sie die Rechte des Volkes respektieren wolle»!
Und Schulmeister Müller fragte den Schwyzer Landammann Schorno:
«Warum dürfen eure Leute Gemeinden halten, wir aber nicht?» (Er
hielt also diese Landsgemeinden immer noch für demokratisch!)
Zuletzt aber trat Stephan Lötscher auf und erklärte vor Volk und Regierung:
«Wir schwören nicht, sondern wollen aus unsern Suppenhäfen
und Sennkesseln Kanonen giessen»! Das war das Ende des Bekehrungsversuchs.
Die hohen Herren räumten entsetzt das Feld —aber
noch an der Kirchentüre «händigten ihnen die Entlebucher ihre Postulate...
schriftlich ein». Das muss man sagen: diesen grossartigen Stil
der Behandlung ihrer Herren hat den Luzerner Bauern kein anderer
Kanton nachgemacht.
Aber noch in einem andern Punkt überragten sie ihre Klassengenossen
in den andern Kantonen um Haupteslänge. Sie, die erzkatholischen
Entlebucher, versuchten wahrhaftig, um ihren protestantischen
Berner Kampfgenossen gerade im Moment ihrer tiefsten Demütigung
den Weg zum neuen Bunde zu erleichtern, niemand Geringeren als
das Oberhaupt der bernischen protestantischen Kirche selbst zur Anerkennung
ihres guten Rechtes zu bringen, sich mit den Berner Bauern
zur Wahrung ihrer Rechte und Freiheiten zu verbünden! Wie hoch
sie mit dieser kühnen Durchbrechung aller abergläubischen Religionsschranken
den geistigen Horizont ihrer eigenen katholischen Herren
überstiegen, geht aus einem Bericht des päpstlichen Nuntius hervor,
der am 8. April nach Rom schrieb: « ... Besagte Leute (die Luzerner
und Berner Bauern) wollen an ihrem Bunde festhalten, und die Herren
hier wollen und können dies nicht zugestehen; denn das Zugeständnis
würde unserer heiligen Religion zum schweren Nachteil gereichen»!
Jedoch war es in Wirklichkeit nicht die heilige Religion den den Luzerner
Herren dieses «Zugeständnis» nicht erlaubte —das war nur der
immer beliebte und stets wirksame, weil auf allgemeinem Vorurteil
beruhende Vorwand —; vielmehr war es ihr durchaus reales Klasseninteresse,
im ungeteilten Besitz ihres Machtmonopols zu bleiben. Genau
so aber war es bei den Entlebucher Bauern ihr Klasseninteresse, das sie
die «heilige Religion» hintansetzen und das Bündnis mit den Berner
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 274 - arpa Themen Projekte
Mitteln, unter Durchbrechung sowohl der kirchlichen wie der staatlichen
Schranken, zu verwirklichen hiess. Insofern ist dies nichts Neues;
sie waren schon lange auf diesem Wege.
Neu und erstaunlich ist das Mittel, da sie nun wählten: ein hochoffizielles
Schreiben vom 9. April, das «Landessiegler, Pannermeister
und die übrigen Vorgesetzten des Amtes Entlebuch» an das «bernische
Ministerium», d. h. an die geistliche, protestantische Oberbehörde des
Staates Bern, richtete, deren Vorsteher — «Antistes» —der Theologieprofessor
Christoph Lüthard war; seltsamerweise also ein Namensvetter
des inzwischen der Bauernsache abtrünnig gewordenen Dekans von
Ruswil und päpstlichen Protonotars, der den Wolhuser Bund feierlich
eingesegnet hatte. Es ist ein Schreiben, in dem die Entlebucher in rührendem
Idealismus, aber —wie der Zürcher Herrenchronist G. J. Peter
schreibt — «natürlich vollkommen erfolglos, die Berner Geistlichkeit
für sich zu gewinnen und darzutun suchten, dass sie zu einer neuen
Erhebung gegen die Regierung durchaus gezwungen seien und das
Recht auf ihrer Seite sei».
So einfach, wie dieser Herrenchronist sie darstellt, war die von
den Entlebuchern vorgebrachte Sache jedoch nicht. Wie aus der bei
Liebenau allein und nur im Auszug wiedergegebenen ausführlichen
Antwort des Antistes Luthard vom 19. April, die er natürlich im Auftrag
seiner Berner Herren verfasste, hervorgeht, haben die Entlebucher
zunächst sehr energisch das Recht der Berner Herren bestritten, «Volk
gegen sie aufzubieten, da die Erhebung ein Akt der Notwehr sei, die
durch allzu harte Bussen, Bestrafung der Verstorbenen und Eingriffe
in die alten Freiheiten und Rechte des Landes sei hervorgerufen worden»;
ein Akt der Notwehr gegen «die übermächtige, grosse Geldsaugerei
der luzernischen Amtleute » und die «Erfolgslosigkeit der...
Beschwerden, die oft sogar mit Einkerkerung der Kläger geendet habe».
Jedoch dies war nur die Rechtfertigung der Entlebucher für ihre rebellische
Haltung gegen ihre eigene, luzernische Obrigkeit. Und natürlich
nimmt Lüthard diese in seiner Antwort heftig in Schutz: «Die
Obrigkeit von Luzern werde doch auch das Recht der Verteidigung besitzen»!
Der Kernpunkt aber war ein anderer. Indem die Entlebucher den
Berner Herren das Recht bestritten, «Volk gegen sie aufzubieten»,
gingen sie unmittelbar zum Angriff gegen die Tagsatzung über und
forderten den Widerruf des sie beschimpfenden «Gemeinen Mandats».
Denn Lüthard kehrt in seiner Antwort den Spiess unverfroren um und
herrscht die Entlebucher an: «Die schimpfliche Behandlung der Obrigkeit
und der Tagsatzung der XIII Orte wegen des Patents (Mandats)
könne die Geistlichkeit nicht billigen. Der verlangte Widerruf sei mit
der Ehre der Obrigkeit unvereinbar»! Und auch sonst sei das Hauptbestreben
Lüthards in dieser «klugen, reich mit biblischen Beispielen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 275 - arpa Themen Projekte
diese protestantische Herrenrechtfertigung rühmt, — den «Bund der
XIII Orte und ihrer Zugewandten gegen die Untertanen», also den Herrenbund,
in allen Tonarten zu rechtfertigen, weil derselbe nur zu dem
Zwecke geschlossen sei, die Hoheit und die von Gott gegebene Gewalt
zu schützen». «Das Gesetz der Natur wie das Wort Gottes erlaube die
Hilfeleistung an die bedrohte Regierung einer verbündeten Stadt.» Dass
dasselbe «Gesetz der Natur» und dasselbe «Wort Gottes» auch die
Hilfeleistung der bedrohten Völker untereinander gestatte —das hingegen
war in den Augen des Berner Obergeistlichen eine Gotteslästerung.
Denn er wettert nun dagegen, «dass die Entlebucher das Landvolk
von Bern, das sich mit seiner Obrigkeit verglichen hatte, durch
,heimliche Zusammenkünften' wieder von der Treue gegen die Obrigkeit
abwendig zu machen suchen». Und er schleudert das Anathema
gegen sie: «Diese neue Verbindung gegen die Obrigkeit führe zum Eidbruch
und müsse mit dem Untergange der Untreuen enden»! Damit
sollte der nun in der Tat mächtig aufkeimende allgemeine Volksbund
ins Herz getroffen werden, zu dessen Wegbereitung die Entlebucher
das ganze Schreiben verfasst, das sie nur in hoffnungsloser «christlicher»
Blindheit an eine so falsche Adresse gerichtet hatten...
Als das Schreiben übrigens in Bern eintraf, war die protestantische
Koryphäe der Herren-Eidgenossenschaft, der Zürcher Bürgermeister
Waser, noch dort anwesend und eben damit beschäftigt, die von ihm
bewirkte Demütigung und Unterwerfung der Berner Bauern gegenüber
den Berner Herren weidlich auszukosten. Das Schreiben der Entlebucher
war für ihn das erste Sturmzeichen der neuen Erhebung. Was
tat Waser? Er schrieb sofort, schon am 11. April, der katholischen
Koryphäe des Herrenbundes, dem Herrn Feldmarschall Zwyer! Wie
Peter berichtet: «Kaum hatte Waser Kenntnis erhalten von der Zuschrift
der Entlebucher an die Antistes zu Bern, so wandte er sich an
Zwyer von Evibach mit der Bitte, ,durch seine bekannte fürsichtigkeit
und villgüetige weitere Interposition dem Lutzernischen gschefft seine
richtigkeit geben zu helfen'...»
Das «Lutzernische gschefft» aber hatten inzwischen nicht nur die
Entlebucher Bauern, sondern auch die Willisauer Bürger auf ein derartiges
Geleise gebracht, dass hier selbst von dem grossmächtigen Feldmarschall
nicht ein Korn mehr für die Herren herauszuholen war.
Noch am 7. April zwar schrieb Herr Zwyer an den Schultheissen Dulliker
vom Schloss Hilfikon aus in etwas galligem Humor: «Die Wildsau
in Willisau muss man wüten lassen; man muss diesen Leuten nur nicht
zu viel Rechte einräumen, dann wird mit der Zeit alles gut und den
Herrn Viktoria.» Aber bereits am 10. sah er keinen andern Ausweg
mehr als den, «ein Regiment, wie man sie in Italien habe», als «gutes
Mittel» zu verwenden —also den Krieg!
In der Tat waren auch die tapferen Willisauer inzwischen ihren
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 276 - arpa Themen Projekte
der gnädigen Herren, gerade ihren Fussfall herbeizuführen, zu
kümmern. Die Willisauer verwandelten jeden Versuch der Herren, eine
Kapitulanten-Gemeinde zustandezubringen, sofort in eine revolutionäre
Versammlung. Die Führer der Willisauer Bürger, der Sternenwirt Hans
Ulrich Amstein, der Kronenwirt Heinrich Peyer, der Metzgermeister
Hans Jakob Stürmli bildeten zusammen mit den Führern der Landschaft,
dem hitzigen Hauptmann Hans Diener von Nebikon, dem gerissenen
Bauernkrämer Jakob Schlüssel von Altishofen (der sich später
als gefährlicher Lockspitzel der Zürcher Herren entpuppte), dem Hofbesitzer
Fridolin Bucher von Steinaren bei Hilferdingen, jetzt Landesseckelmeister
des Amtes Willisau, und dem zähen Däywiler Bauer Hans
Häller eine Art von revolutionärem Klub oder Komitee, das permanent
in Aktion war. Sie entwickelten sich immer mehr zu den eigentlichen
Exekutoren der hochfliegenden Pläne der Entlebucher. In den Mauern
von Willisau wurde der grosse Plan des neuen Bundes am heftigsten
ausgegoren, und Hans Diener war dabei sein feurigster Prophet (aber
natürlich nicht sein Urheber, wie Liebenau es darstellt). Und die Spezialität
der Willisauer Stadtbürger war dabei begreiflicherweise die
Gewinnung anderer Städte für den Bund: der Nachbarstadt Sursee, die
sich lange dagegen sperrte, der solothurnischen Stadt Olten, die sie
seit dem Aarauer Zug in wenigen Tagen sturmreif zu machen verstanden,
der bernischen Städte Lenzburg und Aarburg und der baslerischen
Stadt Liestal, in welche alle sie ständig Briefe und Boten abfertigten.
Schon am 3. April — mithin genau an dem Tag, als die Solothurner
Bauern in Oberbuchsiten durchs Joch gingen — waren daher von
Olten der Mondwirt Hans Jakob von Arx, der Färbermeister Leonz
Müller und ein dritter Oltener Bürger namens Kaspar Klein, ebenfalls
Färber, nach Willisau herübergekommen, um sich bei dem Komitee
zu erkundigen, «in was Massen und Gestalt sie mit ihnen einen Bund
machen wollen». Dann fand wenige Tage später bereits eine Versammlung
auf dem Rathaus zu Olten statt, in der zwei Schreiben des rebellischen
Rates von Willisau verlesen wurden und zwei Willisauer und
zwei Entlebucher zusammen den Beitritt der Stadt Olten zum neuen
Bunde erwirkten. Es war die entscheidende Versammlung, die erst
eigentlich «Organisation in die Bewegung brachte», d. h. auf der der
allgemeine Volksbund über die Grenzen des Wolhuser Bundes hinaus
in andere Staatsgrenzen verstiess. Die Propaganda für den neuen Bund,
die durch den sensationellen Uebertritt des gesamten Behörde-Apparates
der grössten solothurnischen Stadtgemeinde ausser der Hauptstadt
gemacht wurde, war umso wirksamer, als an den Oltener Beratungen
ständig auch Berner Bürger aus Aarburg und Basler Bürger aus
Liestal, so Heinrich Stutz, aber auch Baselbieter Bauern, wie Werli
Bowe, der Bruder Isaak Bowes, sowie der leidenschaftliche Vorkämpfer
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 277 - arpa Themen Projekte
Uli Gysin, teilnahmen. Dieser Uebertritt stürzte darum in der Folge
nicht nur den ganzen, eben errungenen «Frieden» der Solothurner Herren
um, er machte auch starken Eindruck in Bern und Basel, geschweige
in Luzern, aus dessen Gebiet die «Anstifter» nach Olten gekommen
waren.
Bereits «am 9. April brachte der Abt von St. Urban in Erfahrung,
dass nächstens in Willisau eine Versammlung der Bauern aus den
Kantonen Luzern, Bern, Zürich (!), Basel, Solothurn und Freiburg (!)
gehalten werden sollte». Wenn wir auch nicht wissen, auf welche bestimmte
Tatsachen dieses Gerücht sich stützte, so ist es doch für sich
allein schon charakteristisch für die grosse Ausdehnung der Tätigkeit
der Willisauer und Entlebucher Emissäre, aber auch für die zentrale
Bedeutung, die der Stadt Willisau in dieser Phase hinsichtlich der Entstehung
des neuen Bundes zugeschrieben wurde.
Begreiflich, dass nun die Luzerner Regierung abermals alle Hebel
in Bewegung setzte, um diese Veste von innen her zu Fall zu bringen —
abermals vergeblich, wie schon einst, kurz vor der Errichtung des
Wolhuser Bundes. Diesmal aber hatte sie für ihre «Diversion» einen
gewichtigen Verräter einzusetzen: Kaspar Steiner! «Die vermittelnde (!)
Haltung Steiners» —schreibt beschönigend der Herrenchronist Liebenau
— «erfüllte den Rat von Luzern mit den grössten Hoffnungen auf
eine gütliche Beilegung des Streites.» Diese «gütliche Beilegung» bestand
für die Luzerner Herren nämlich darin, «durch den einflussreichen
Siegrist Steiner das Willisauer Amt vom Entlebuch zu trennen»!
Noch hatten die Willisauer dessen Rolle nicht erkannt und schrieben
ihm immer noch vertrauliche Briefe. Steiner lieferte sie dem Schultheiss
Dulliker aus. So z. B. einen Brief Hans Ulrich Amsteins vom
7. April, in dem dieser im Namen der Willisauer das Amt Rothenburg
vor Truppen warnte, die die Luzerner Herren in Basel geworben hätten:
«Die Rothenburger sollen diese Truppen nicht durchpassieren
lassen und nach Willisau berichten.» Aehnliche Aufmahnungen zu
Wachsamkeit und militärischer Bereitschaft schrieben die Willisauer
in diesen Tagen an die Mitverschworenen in allen rebellischen Gebieten.
«Steiner ersuchte nun am 10. April den einflussreichen Stürmli
in Willisau, zu ihm nach Emmen zu kommen, von wo er sich mit ihm
nach Rathausen begeben wolle, um mit Schultheiss Dulliker sich in
Sachen der Entlebucher (!) ins Einvernehmen zu setzen.» Der Jesuitenschüler
Steiner hatte also einen grossen Dreh eingeleitet, um
einen der Hauptführer der Willisauer zu korrumpieren und ihn dann
als eindrucksvollen Saboteur bei den Entlebuchern einzusetzen! Er beging
dabei nur den Fehler, sich gerade an den ehrlichsten und senkrechtesten
Kämpfer unter den Willisauern zu wenden. Jetzt erkannten
diese ihren Judas und stiessen ihn mit Verachtung weg. Die Sprache
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 278 - arpa Themen Projekte
dieser heiklen Sache eines Verräters im Dienste der Herren berichtet.
Und der mitfühlende Schmerz über dieses Misslingen wirft
Herrn von Liebenau sogar eine richtige und wichtige Erkenntnis ab:
«So beredt Steiner auch war, so einflussreich er auch in seiner Gemeinde
scheinen mochte, die Sache war nun einmal so weit gediehen,
dass nicht mehr die Anschauungen eines Einzelnen, wer dieser auch
sein mochte, im Lager der Bauern durchdringen konnte.»
Da Steiner sich seinen Herren nach dieser missglückten Diversion
weiter nützlich erweisen musste, wenn ihm der erhoffte Judaslohn
nicht gänzlich verloren gehen sollte, trieb er die Regierung dazu an,
sofort eine allgemeine Gemeinde von Ausgeschossenen aller zehn
Aemter zu veranstalten; er mochte dabei hoffen, die widerspenstigen
Entlebucher und Willisauer durch die anderen Aemter, auf Grund der
von der Regierung versprochenen «Konzessionen», majorisieren zu
können. Er hatte umso mehr Grund zur Eile damit, als die Herren bereits
am Tag seiner Abfuhr bei den Willisauern, am 10. April, einen
eigenen Weg zur Abhilfe beschritten hatten: sie mahnten «Zürich und
die andern Orte um getreues Aufsehen und Bereithaltung der Mannschaft».
Es war derselbe Weg zum Kriege, den Zwyer am gleichen Tage
empfohlen hatte. Zwar führte Luzerns Aufmahnung zu «getreuem
Aufsehen» noch nicht direkt zur Einberufung der Tagsatzung, d. h.
zur Kriegsberatung des Herrenbundes. Aber als dazu am 13. und 14.
April Bern, durch die starke Bewegung im Luzernischen und ihre
Rückwirkung aufs Bernbiet geängstigt, noch ausdrücklich die Wiedereinberufung
der Tagsatzung verlangte, da legte der Zürcher Rat die
Einladungsschreiben bereit, die dann zu der am 29. eröffneten Tagsatzung
führten. Schon am 11. aber erhoben die Willisauer —nicht
anders, als wären sie bereits ein souveräner Stand der Eidgenossenschaft
—die Forderung, ihre Klagen und ihre Rechtsansprüche durch
eigene Gesandte vor der Tagsatzung selbst zu vertreten. Dasselbe verlangten
sofort auch die Entlebucher. Und siehe da: «Der Rat von Zürich
entsprach dem Begehren der Bauern und gab den Delegierten von
Willisau und Entlebuch freies sicheres Geleit; ersuchte sie aber, inzwischen
sich ruhig zu verhalten.»
Inzwischen aber trieb gerade die auf Betreiben Steiners überhastet
in Gang gesetzte Maschinerie der zehn Aemter die revolutionäre Entwicklung
vorwärts. Und zwar waren es wieder die Willisauer, die sie
aus einem Mittel der Kapitulation zu einem Vehikel der Revolution
verwandelten. Auf den 13. April war die Delegiertenversammlung der
zehn Aemter ausgerechnet nach Schötz einberufen, an das sich für
alle Willisauer so stolze Erinnerungen an die kühnen «Schötzer Artikel»
knüpften, die man hier im Februar, ein paar Tage vor dem Bundesschwur
in Wolhusen, beschlossen und die man stets leidenschaftlich
aufrecht erhalten hatte. Am Tag vorher, am 12., machte man noch
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 279 - arpa Themen Projekte
Versuch, noch vorgängig der Zehn-Aemter-Versammlung
das Amt Willisau einzeln zu unterwerfen und es dabei sogar zu
spalten. «Am 12. April versuchten Abgeordnete von Luzern, im Beisein
des Abtes von St. Urban, in Schötz die Huldigung des Amtes Willisau
vorzunehmen» (d. h. der Landschaft Willisau). «Trotz des Zuspruchs
von Seite mehrerer Geistlicher war rein nichts auszurichten.» Am gleichen
Tage, am 12., wollte man durch eine Parallelaktion die Stadt
Willisau überrumpeln: «Als an diesem Tage der Landvogt Jost Pfyffer»
(ausgerechnet der eigene, bestgehasste Tyrann der Willisauer!) und
Johann Leopold Bircher in Willisau erschienen, um die Huldigung zu
verlangen, waren äusserst wenig Leute anwesend, die sich meist sehr
trotzig benahmen» — sogar die Wenigen, die überhaupt erschienen und
unter denen bestimmt kein einziger der revolutionären Führer war!
Die nämlich waren nach Schötz geeilt, um der Landschaft den Rücken
zu stärken. Es blieb Jost Pfyffer nichts anderes übrig, als den «äusserst
wenigen» Anwesenden mit den Folgen zu drohen, «die aus dieser Verweigerung
der Huldigung entspringen könnten», und gänzlich unverrichteter
Dinge wieder abzureiten.
Dass unter diesen Umständen auch die Delegiertenversammlung
in Schötz am darauffolgenden Tag ein glatter Misserfolg der Regierung
werden musste, ist klar. Diese Versammlung soll zwar «scheinbar
ruhig» verlaufen sein —aber nur weil all die jämmerlich kleinlichen
«Konzessionen» der Regierung, die hier als Köder ausgelegt wurden,
überhaupt keinen Eindruck mehr machten. Ja, gerade die umständliche
Wichtigtuerei für lauter —nicht einmal ernst gemeinte —Bagatellen
(in 25 Artikeln, sowie in 4 Extra-Artikeln für das Amt Kriens
und Horw, wie sie dann am 17. vom Rat zu Luzern feierlich promulgiert
wurden) musste im Vergleich mit dem Preis, der dafür gefordert
wurde, lächerlich wirken und auch die sanfteren Gemüter förmlich mit
der Nase darauf stossen, dass «Konzessionen» rein nichts als eben ein
Köder seien, für den es sich nicht lohnte, den Wolhuser Bund abzuschwören
und sich mit gebundenen Händen und Füssen an die Rechtsfolgen
der im «Rechtlichen Spruch» gebrandmarkten «Fehler» der
Bauern auszuliefern.
Kurz und gut: niemand hat ernstlich angebissen, mag auch der
Herrenchronist Liebenau versichern: «die Vertreter von acht Aemtern
(ausser Entlebuch und Willisau) erklärten, den Abgeordneten des Rates
Gehorsam leisten zu wollen...» Das werden die Ausgeschossenen nur
vorgeschützt haben, um Zeit zur Ausführung anderer, bereits beschlossener
Pläne zu gewinnen. Der Beweis für unsere Auffassung ist der:
schon am Tag darauf, am 14., konnte der revolutionäre Rat von Willisau
«je zwei Delegierte aus jedem der zehn Aemter zu einer neuen Versammlung
auf den 16. April nach Wolhusen» einberufen — und sämtliche
zehn Aemter folgten dieser Einladung! (Das war gerade an dem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 280 - arpa Themen Projekte
in der darauffolgenden Nacht der Baselbieter Landsturm gegen Liestal
losbrach.)
Schon die Wahl des Ortes der neuen Versammlung sprach deutlich
genug aus, was alle zehn Aemter wollten: nicht nur die Behauptung,
sondern sogar die Erneuerung und Erweiterung ihres Bundes. Hier
wurden die «Konzessionen» der Luzerner Regierung auch nicht eines
Wortes gewürdigt. Die Gegenstände ihrer Beschlüsse waren vielmehr
durchweg hochpolitische. Das drückte sich auch in ihrer Form aus.
Nicht nur an die Luzerner Regierung, sondern auch an die «sechs
katholischen Orte», die in Werthenstein und Ruswil unter Zwyers Direktion
«vermittelt» hatten, richteten die zehn Aemter ihre Beschwerden
und Forderungen. In erster Linie wiederholten sie ihre Anklage,
dass der «Rechtliche Spruch» der eidgenössischen «Ehrengesandten»,
dessen Anerkennung man ihnen mittels der «Konzessionen» abpressen
wollte, eine Fälschung sei: «der Rechtsspruch entspreche nicht den in
Ruswil getroffenen Vereinbarungen, da dort der Wolhuser Bund nicht
aberkannt worden sei», referiert der Herrenchronist Liebenau. Ferner
reklamieren sie ihr Rekursrecht an die sechs katholischen Orte gegenüber
der luzernischen Regierung: in Ruswil sei nämlich «auch zugestanden
worden, wenn Luzern wieder neue Aufsätze mache, sollen die
zehn Aemter berechtigt sein, bei den sechs katholischen Orten zu klagen».
Sodann verlangen sie, «im Spruchbriefe müsse das Wort ,Fehler'
getilgt werden», ja, wie Stephan Lötscher drei Tage später diese Forderung
vor dem versammelten Landrat von Nidwalden — «wo das Volk
sehr für dieselben (d. h. für die aufständischen Luzerner Bauern) eingenommen
war» —referiert: «Korrektur des rechtlichen Spruches in
dem Sinne, dass es dort heissen solle, nicht die zehn Aemter, sondern
die Regierung von Luzern hätte gefehlt»! Dann stellen sich alle zehn
Aemter einmütig vor die schon am 7. April von den Entlebuchern vor
dem in Schüpfheim erschienenen Schultheiss Fleckenstein erhobenen
zwei Hauptforderungen. Die eine formulierten sie jetzt so: «Dem Lande
Entlebuch müsse abschriftlich der Hauptbrief, wie Entlebuch an Luzern
gekommen sei, mitgeteilt werden.» Hinter dieser Forderung steckt
der zäh festgehaltene, ja immer hartnäckiger werdende Wille zur Unabhängigkeit
der Landschaft vom absolutistischen Regiment der Stadt
Luzern überhaupt. Und schliesslich gipfeln auch diese Wolhuser Beschlüsse
in dem nun unermüdlich wiederholten Verlangen: «das Mandat
von Baden sei zu revozieren»! Eine Forderung, die nun durch eine
Reihe von Gesandtschaften seit diesem Wolhuser Tage hartnäckig in
die Urkantone getragen wird, um sie zur Forderung der dortigen
Landsgemeinden zu machen.
Aber damit scheinen die Verhandlungsgegenstände dieser Wolhuser
Delegiertenversammlung der zehn Aemter noch nicht erschöpft
gewesen zu sein. Jedenfalls spricht Liebenau die wichtige Vermutung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 281 - arpa Themen Projekte
von Schullehrer Müller von Entlebuch vorgelegt.» In der Tat wird
das sehr wahrscheinlich gemacht durch die Tatsache, dass schon am
18. April in Willisau eine geheime Zusammenkunft von «Ausschüssen
der luzernischen Aemter » mit «Vertrauensmännern aus den Kantonen
Bern und Solothurn» veranstaltet werden konnte, die bereits «in die
artikelweise Beratung eines Bauernbundes» eintrat, «der an der Landsgemeinde
von Sumiswald vorgelegt werden sollte»! Und zwar berichtet
im Zusammenhang damit Liebenau: «Wie der Wolhuser Bund war auch
derjenige von Sumiswald nach den Geständnissen Emmeneggers... von
Caspar Unternährer ausgegangen.» Daran, wie auch an der soeben gemachten
Erwähnung des Schulmeisters Müller, ist jedenfalls soviel
wahr, dass auch der neue, grössere Bund, wie schon der Wolhuser
Bund, vom Entlebuch ausgegangen ist.
Wenn Vock dagegen, ebenfalls im Zusammenhang mit dieser geheimen
Willisauer Versammlung von Vertrauensmännern aus den Kantonen
Luzern, Bern und Solothurn vom 18. April, berichtet: «Der vom
bernischen Notar Johann Konrad Brönner entworfene Bundesbrief, der
auf der nächsten Landsgemeinde beschworen werden sollte, ward in
allen einzelnen Artikeln besprochen und beraten» — so kann daran
nur das Eine richtig sein: dass die Entlebucher und Willisauer die
weitere Ausarbeitung und vor allem die öffentliche Errichtung des
neuen, umfassenden Bundes den anwesenden Bernern zuschoben, was
durch die folgenden Ereignisse bestätigt wird. Es war von den katholischen
Luzerner Bauern und Kleinbürgern eine sowohl staatspolitisch
wie klassenpolitisch höchst kluge und weitsichtige Entscheidung: den
neuen Bundes plan aus seiner bisherigen Verschränkung mit dem Wolhuser
Bund, d. h. aus den Schranken des Luzerner Staats gebiets und
der katholischen Religion, herauszulösen und seine Realisierung auf
den Boden eines andern Staats und der protestantischen Religion zu
verpflanzen! Wir wissen wenig Genaues von dieser geheimen Willisauer
Versammlung. Aber wenn die eben genannte Entscheidung in ihr
fiel, dann stellt sie, konkret politisch gesehen, die Geburtsstunde und
das tapfere Städtchen Willisau die historische Wiege des einzigen allgemeinen,
an keine Kantons- und Religionsgrenzen gebundenen Volksbundes
der Schweizergeschichte dar.
Jedenfalls aber ist aus den auf diese Versammlung unmittelbar
folgenden Ereignissen mit Bestimmtheit zu schliessen, dass in Willisau
am 18. April Zeit und Ort der ersten, planmässig als solche einberufenen
interkantonalen Lands gemeinde beraten und beschlossen worden
sind: Sumiswald, den 23. April. Denn vom 18. April an vergeht kein
Tag, an dem nicht örtliche, Amts- oder Kantonal-Landsgemeinden in
allen vier aufständischen Kantonen, «zu Beratung der Artikel und zu
Ernennung der Deputierten» für die kommende grosse Landsgemeinde
stattgefunden hätten. Nach Vock «wählten die Luzerner ihre Ausgeschossenen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 282 - arpa Themen Projekte
Geheimversammlung selbst.
Ein starker elektrischer Strom ging schon seit Tagen von den unausgesetzten,
fieberhaften Beratungen in Willisau aus; er stärkte den
Verzagten den Rücken, er richtete sogar bereits umgefallene Kapitulanten
wieder auf. Alles wandelte sich jetzt schnell. Noch zur Zeit der
Delegiertenversammlung der zehn Aemter in Wolhusen am 16. schrieb
Hans Emmenegger im Namen der Geschworenen des Entlebuchs an
die Willisauer: «Steiner von Emmen sei bereits abtrünnig und ein der
Regierung angenehmer Denunziant geworden. Er sei selbst auf die
Knie gefallen und habe, wie man sage, um Verzeihung gebeten.» Schon
am 18. lief in Luzern zum grossen Aerger der Regierung die Kunde
ein: «Steiner von Emmen... sei wieder zur Partei der Bauern übergetreten
und habe diesen die Aeusserungen des Schultheissen Dulliker
hinterbracht»! Und am 19. schrieben die Willisauer selbst, die ihn
noch vor wenigen Tagen verachtungsvoll abgewiesen hatten, treugläubig
an die Entlebucher: «Steiner stehe wieder treu zum Bunde. In
Rothenburg werden am 20. April 3000 Mann zusammenkommen» —
d. h. zu einer Landsgemeinde, die trotz der eben erfolgten, von Steiner
bewirkten Unterwerfung und Abschwörung des Wolhuser Bundes
wieder zu diesem stehen und Delegierte zur Beschwörung des neuen
Bundes nach Sumiswald senden sollte. Und sie sandten sie wirklich, an
ihrer Spitze —Kaspar Steiner!...
Auch ein anderer Kapitulant von einiger Bedeutung wurde von
dem neuen Aufschwung mitgerissen. Es war der «Führer» der Solothurner
Bauern, der Schälismüller Adam Zeltner, Untervogt in Niederbuchsiten,
der mit andern Solothurnern zusammen an der Geheimversammlung
vom 18. in Willisau als neutral sein wollender Beobachter
teilnahm. Dort aber war es, wo «dieser ehrliche, seiner Regierung getreue»
Untervogt, wie Vock sagt, «vom Sturme der allgemeinen Verwirrung
(sic!) nur auf Augenblicke hingerissen» wurde. Aber das ist
nur ein sicheres Zeichen dafür, dass die Masse der Solothurner Bauern
von der neuen Bundesidee bereits «hingerissen» und auch ohne Adam
Zeltner entschlossen war, ihre Delegierten nach Sumiswald zu schicken.
Genau so wie das «Wiederaufstehen» Kaspar Steiners nur dem Druck
der 3000 Rothenburger zu verdanken war, die sonst über ihn weg
nach Sumiswald gerannt wären. Jetzt schien es eben wieder aussichtsreich,
auf den Sieg der Bauern zu setzen — und man wundert sich
nur über die schafsfromme Langmut der Bauern, dass sie solche Spekulanten,
die die Sache der Bauern in jedem gefährlichen Augenblick
von vorn und hinten verrieten, immer wieder treugläubig in ihre brüderlichen
Arme schlossen.
Wichtiger war der durch diesen neuen Begeisterungsaufschwung
herbeigeführte Neugewinn eines ganzen grossen Landstrichs, benachbart,
aber ausserhalb der luzernischen Kantonsgrenze: der oberen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 283 - arpa Themen Projekte
drückenden Ausbeutung von abwechselnd aus den sieben ältesten eidgenössischen
Orten —besonders also aus den «demokratischen» Urkantonen
—bestellten Landvögten litt, für die dieses Land ein fremdes
Untertanenland war, dem man skrupellos Reichtümer abpressen konnte.
Die Vögte bezahlten deshalb den biederen «Landgemeinden» der Urkantone
horrende Summen, um in Besitz dieser idealen Erpressungsposten
zu gelangen. Unter den Freiämtler Bauern, diesen wirklichen
«eidgenössischen Proletariern», zündete daher der Gedanke des neuen,
das ganze werktätige Volk umfassen sollenden Bundes begreiflicherweise
ganz besonders. Schon früher hatten sie durch heftige Zuckungen
ihre tiefe Sympathie mit dem Bund der zehn Aemter bewiesen.
Aber dem nur kantonal luzernischen Wolhuser Bund konnten sie nicht
beitreten, ohne sofort der Exekution durch die Tagsatzung, ihrer direkten
Regierung, zu verfallen. Jetzt sah das anders aus — wo das
gesamte werktätige Volk von vier «souveränen» Kantonen einen Bund
für alle Ausgebeuteten und Unterdrückten, Erniedrigten und Beleidigten
im ganzen Schweizerland errichten wollte!
Hören wir den Bericht des Solothurner Domdekans und frommen
Herrenchronisten Vock über diesen Neugewinn für die allgemeine
schweizerische Bauernsache. Das ist umso angemessener, als gerade
im Gebiet der Freien Aemter — wenn auch in ihrem unteren Teil. der
erst nach Sumiswald revolutioniert wurde —das Schlachtfeld liegt,
wo nach einigen Wochen die bewaffneten Massen der Bauernarmee
mit der Herrenarmee der Tagsatzung zusammenstossen werden. Nachdem
Vock beklagt hat, dass weder ein «rührendes Schreiben» des eidgenössischen
Vororts an die Willisauer, «worin er sie dringend hat,
von ihrem Beginnen abzustehen und die Ruhe des Vaterlandes ferner
nicht zu stören», noch ein ebensolches Schreiben, das die Solothurner
Regierung «an dieselben erlassen hatte, um sie, in wahrhaft väterlichem
und ganz unbefangenem Tone, zum Frieden zu ermahnen», bei den
Willisauern auch nur das geringste gefruchtet hätten, fährt er fort:
«Sie, mit den Entlebuchern, sannen nur auf glückliche Durchführung
und Befestigung des begonnenen Werks, und in allen X Aemtern des
Kantons Luzern war der Eifer und die Tätigkeit dafür lebhafter als
jemals, sodass auch die benachbarten Einwohner der obern freien
Aemter vom allgemeinen Taumel (sic!) ergriffen und in den gefahrvollen
Kampf hineingezogen wurden. Die Hochdorfer, im Amte Rothenburg,
redeten im täglichen Verkehr mit den Genossen der Pfarrei
Hitzkirch viel von dem neuen Wesen und von dem Bunde, den die
Bauern aus allen Kantonen bald miteinander gegen die Regierungen
schliessen werden. Uli Ineichen, aus dem obern Klotensperg. der
Pfarrei Hitzkirch, Hans Ineichen und Martin Moser, beide von Hitzkirch,
Hans Hegli, Sattler von Gelfingen, und der Statthalter Stoll. von
Aesch, wurden durch die Mitteilungen und Berichte der Hochdorfer
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 284 - arpa Themen Projekte
darin bestärkt. Sie ruhten nicht, bis sich das Amt in der Kirche von
Hitzkirch zur Gemeinde versammelte. In dieser Versammlung machte
Hans Hegli ... den Vortrag und schilderte, wie die freien Aemter unter
dem Drucke der Landvögte aus den VII alten Orten schmachten müssen,
wie sie, wohl noch viel härter als die Luzerner, um unbedeutende
Fehler gestraft werden, dem Landschreiber» (das war zur Zeit der
Zuger Altammann und Zwyer-Diener Beat Jakob Zur Lauben) «für
seine Schreibereien, die nichts taugen, viel zahlen müssen» (der Originalbericht
lässt Hans Hegli sagen: «das Schreiben, so von der Oberkeit
herkomme, koste viel und sei nit eine Schlottermilch werth»!), «und
mit neuen Verordnungen, von denen die eine die andere wieder aufhebe,
täglich geplagt werde; jetzt, fügte er hinzu, sei ein schicklicher
Anlass, sich von diesen Beschwerden zu befreien; man solle der Einladung
der X Aemter von Luzern folgen und gemeinschaftliche Sache
mit ihnen machen». Obwohl nun nach vielem weiterem Hin- und Herreden
«ein Teil der Versammlung lärmend schrie: ,den Bauern zu!'»,
kam vorläufig nur ein Neutralitätsbeschluss zustande (denn hier waren
noch viele, die vor der sofortigen Exekution der Tagsatzung zitterten):
«dass man gemeiniglich still sitzen und keinem Teile beistehen wolle».
Aber Vock fährt fort: «Durch diesen Beschluss sahen sich zwar die
Rädelsführer in ihren Erwartungen getäuscht; sie liessen sich aber
nicht abwendig machen, sondern, durch den Zuspruch der Rothenburger
und Hochdorfer angefeuert, reisten Hans Hegli von Gelfingen,
Hans Ineichen und Martin Moser von Hitzkirch nach Willisau zur Versammlung
der X Aemter und baten um Aufnahme des Amts Hitzkirch
in den Bund. Ihrem Begehren wurde freudig entsprochen und ihnen
die Aufnahme mit Siegel und Brief bescheinigt. Einige Tage nach
ihrer Zurückkunft wurde durch Anstiftung (sic!) derselben die Amtsgemeinde
Hitzkirch wieder versammelt, der Beitritt zum Bunde der
X Aemter von Luzern beschlossen und eine Abordnung zur Landsgemeinde
in Sumiswald gewählt.»
Damit war also gewissermassen ein fünfter «Kanton» für den
Bund gewonnen, wenn dieser «Kanton» auch nur aus einem der
«freien» Aemter bestand, deren «Freiheit», wie zum Hohn ihres Namens,
einzig in der Fessellosigkeit der «demokratischen» Herren bei
der Ausbeutung dieses eroberten Untertanenlandes bestand. Aber eben
deshalb erregte der Beitritt der Freiämtler Bauern zum grossen neuen
Volksbund bei den Herren der ganzen Eidgenossenschaft nicht geringen
Schrecken. Denn nun fürchteten sie die ansteckende Wirkung
dieser Erhebung auf alle übrigen «gemeinen Herrschaften», d. h. mitten
in der Eidgenossenschaft gemeinsam unterworfenen und gemeinsam
ausgebeuteten Untertanenländer. Es gab darin durchaus keinen
Unterschied zwischen den sog. «demokratischen» und den offen aristokratischen
Regierungen. Denn «selbst die Stände Zug und Nidwalden»,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 285 - arpa Themen Projekte
den Landsgemeinde-Kantonen, «mussten gegen ihren Willen die Lokalisierung
des Bauernaufstandes betreiben helfen, weil derselbe auch
auf die gemeinsamen eidgenössischen Vogteien sich auszudehnen begann,
aus denen sie ihre Staatseinkünfte bezogen und mit der Vernichtung
der Herrschaftsrechte in den eidgenössischen Vogteien der
Sieg der reformierten Konfession in der Schweiz entschieden war».
Die Erhebung der «eidgenössischen Vogteien» oder «gemeinen
Herrschaften» zu selbständigen Ständen der Eidgenossenschaft —also
ungefähr das, was erst über 150 Jahre später wirklich eintrat —wäre
zweifellos zu einer der wichtigsten geschichtlichen Auswirkungen des
Bauernkriegs geworden, wenn dieser nur um ein weniges länger gedauert
und für die Bauern auch nur halbwegs erfolgreich geendet hätte.
Das erkannte beispielsweise auch der venezianische Gesandte in Zürich,
der deshalb mit direktem Bezug auf dieses anscheinend winzige lokale
Ereignis an die Serenissima der Republik Venedig am 26. April schrieb:
«Man fürchtet hier sehr, dass auch die Leute von Baden und Bremgarten,
sowie die Thurgauer, Rheintaler und andere Bezirke und Gerichtssprengel
sich erheben werden, und daher hat man schon vor
zwei Tagen einflussreiche Personen ins Freiamt geschickt, die das
Verhalten der Landvögte und der Beamten prüfen und sich erkundigen
sollen, ob sich jemand zu beschweren habe, mit der Zusicherung, man
werde alles befriedigend erledigen... . diesen «einflussreichen
Personen» war, nebenbei, niemand Geringeres als der Seckelmeister
von Zürich Johann Konrad Werdmüller, der als bereits designierter
Generalissimus der gegen die Bauern aufgestellten Herrenarmee der
Tagsatzung die Gelegenheit dieser Reise nutzbringend dazu verwenden
konnte, das künftige Schlachtfeld zu studieren, für das ohnehin das
Freiamt schon deshalb die geeignetste Gegend war, weil es der Tagsatzung
und deren Vorort direkt unterstand und hier also keine Rechte
einer «souveränen» Kantonsregierung zu respektieren waren...
Die so ausserordentlich entschlossen vorgehende Tätigkeit der
Entlebucher und der Willisauer hatte natürlich ihrerseits eine direkte
Wirkung auf die Kriegsentschlossenheit der eidgenössischen Herren insgesamt.
Schon am 15. April waren «die Geheimräte von Luzern in Verbindung
mit den Kriegsräten der Urkantone» in Luzern unter dem Vorsitz
des Obersten Zwyer zusammengetreten. Letzterer hatte auf dieser
geheimen Sitzung auch bereits «über die missliche Lage der freien
Aemter und der Grafschaft Baden wie über die neuen Umtriebe von
Bern» Bericht erstattet. Es kann uns daher nicht wundern, dass Zwyer
am 17. aus Altdorf ausgerechnet an den Landvogt Samuel Tribolet in
Trachselwald schrieb: «Wenn man nicht mit gesamter Hand und zwar
so rasch wie möglich einschreite, so werde nicht mehr zu helfen sein;
denn diese Leute wollen nun einmal von ihrem nichtigen Bunde nicht
abstehen, sondern denselben immer mehr durch den Beitritt der Untertanen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 286 - arpa Themen Projekte
des Schultheissen Dachselhofer in Bern gleichzeitig auch bereits
«ein Parere über das gemeinsame Vorgehen», d. h. einen Schlachtenplan.
Am gleichen Tag schrieb auch die Luzerner Regierung an den
Vorort: «dann nun ohne Rigor und Gewalt nicht mehr zu helfen sein
werde». Und «als Luzern am 18. April den Vorort von den unbilligen
Zumutungen und Begehren der Untertanen des Landes Entlebuch und
des Willisauer Amtes verständigte» — so formuliert der Zürcher Herrenchronist
G. J. Peter —, da drang auch «beim Zürcher Rat die Meinung
durch, dass man ,disser vast durchgehenden Revolution mehrteils
eidgenössischer Underthanen gegenüber die öffentliche Gewalt
anwenden" müsse». Die Berner Herren aber, immer zu jeder Brutalität
bereit, ja, stets ungeduldig darauf erpicht, dass keine Gelegenheit dazu
verpasst werde, warfen Zürich bereits «Unmüetigkeit» und «Zögerung»
vor und verlangten «daher am 19. April kategorisch, dass der Vorort
einlade, da die ,Schwierigkeiten' bei den bernischen Untertanen immer
bedeutender würden, ,ohnzwyfelich usa antrieb der hin- und her- im
Landt gespürten Entlebuchischen bossen Betten, in suchung der erwyterung
ihres schändtlichen Pundts'»! Bereits begannen nämlich auch
die Oberaargauer, Prügel und hölzerne Kanonen anzufertigen...»
Denn nun richtete sich auch der Berner Bär wieder gefährlich
auf. Schon am 13. April, so teilt Bögli mit, «berichtete der Landvogt
von Trachselwald» (der gerade in diesen Tagen, wie wir wissen, im engsten
Kontakt mit dem Obersten Zwyer zusammenarbeitete), «dass die
Emmentaler von den Entlebuchern zu einem gemeinsamen Bundschwur
auf gereizt würden». «Aus Landshut kam schon am 14. April
die Kunde» —also gerade als Wasers und Hirzels «Ehrengesandtschaften»
ihre «Pacificationstour» durchs Bernbiet beendeten — «dass die
Untertanen die Abmachungen der Ausschüsse nicht annähmen und an
einer Lands gemeinde zu Signau, wo sich auch Simmentaler, Lenzburger
und Entlebucher gezeigt, beigewohnt hätten. Von den Brandisern
vernahm die Regierung, dass sie aufrührerischer seien als zuvor. Die
Melchnauer, Rohrbacher und Madiswiler» —stets lauter hundertprozentig
revolutionäre Gemeinden — «verlangten heftig das Reisgeld
heraus. Auch Aarwangen war unruhig, und Aarburg» (d. h. der Landvogt,
nicht die schon längst aufrührerische Bürgerschaft) «begehrte
Truppen gegen Empörungen». «An diesem Aufstande», fügt Bögli lakonisch
hinzu, «nahmen auch die benachbarten Solothurner Anteil.»
In der Tat, jetzt fielen auch zwischen den Kantonen Bern und
Solothurn, genau wie auch zwischen den Kantonen Solothurn und
Basel, die staatlichen wie die religiös-konfessionellen Schranken für die
aufständischen Bauern und Bürger vollständig und endgültig. Die von
Langenthal im Bernischen schrieben am 15., wie Vock erzählt, an die
von Kestenholz im Solothurnischen, um sie für den neuen Bund anzufeuern,
und in ihrem Schreiben nahmen sie die luzernischen Klassengenossen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 287 - arpa Themen Projekte
auch der solothurnischen, in Schutz. «Dieses Schreiben liess Urs Rohr
an der versammelten Gemeinde von Kestenholz durch den Schulmeister
verlesen und schickte es dann nach Oensingen, Niederbuchsiten und
Olten. Daraus erfolgte neuer Tumult.»
Das war die direkte Ursache dafür, dass «einige Vorsteher aus
verschiedenen Gemeinden» den Untervogt Adam Zeltner, sowie den
Altwirt Georg Baumgartner von Oensingen zur «neutralen» Erkundigung
an jene entscheidende geheime Beratung der Revolutionäre in
Willisau vom 18. April absandten — «nach Willisau zu reiten und dort
zu vernehmen, was denn nun eigentlich wieder vorgehe». Wie der
stürmische Geist der Willisauer dort den Kapitulanten Adam Zeltner
in seine (objektiv, nicht subjektiv) revolutionäre Rolle hineinriss, haben
wir bereits erfahren. Bei seiner Rückkehr wurde dieser Revolutionär
wider Willen durch die Massenstimmung auf demselben Wege um
den entscheidenden Schritt weitergestossen. «Die Willisauer gaben
ihnen (Zeltner und Baumgartner) bei der Abreise die schriftlich verfassten
Artikel mit, welche auf dem nächst abzuhaltenden Bundestage
(zu Sumiswald) beschworen werden sollten. Nach der Heimkehr der
beiden Abgeordneten wurde von den Gemeindevorstehern und andern
Aufrührern» — so erzählt Vock — am 20. April «eine Zusammenkunft
auf dem Rathause zu Olten gehalten, wo die von den Willisauern mitgeteilten
Punkte beraten, die aufgefangenen Briefe eidgenössischer Regierungen
(!) geöffnet und abgelesen und dann, auf Antrag des Färbers
Kaspar Klein von Olten, der Untervogt Adam Zeltner zum Landeshauptmann,
und zu geheimen Räten der Altwirt Georg Baumgartner
von Oensingen, der Untervogt Meyer von Dulliken, der Untervogt von
Gösgen und der Löwenwirt von Olten mit dem Auftrage gewählt wurden,
dass sie zur Verteidigung gegen fremde Truppen (!), die ins Land
kommen möchten, die nötigen Befehle erteilen sollen.» Jetzt gab es
auch für die Solothurner, das bisher schwächste Glied in der Gesamtfront
der Bauern, bezw. in der Volksfront der Bauern und Bürger,
kein Zurück mehr.
Dennoch war die Wahl Adam Zeltners zum Landeshauptmann
der Solothurner eine für die Bauernsache verhängnisvolle. Diese falsche
Wahl, und sie allein, bewirkte, dass das Solothurner Glied auch künftighin
das schwächste in der Gesamtfront blieb, trotz dem nun auch
im Solothurner Volk so prachtvoll aufgeflammten Kampfwillen für die
gemeinsame Sache. Das zeigte sich schon am nächsten Tag, am 21. April,
an dem die bereits im Zusammenhang mit den Baslern erwähnte grosse
Lands gemeinde von Oberbuchsiten stattfand, eine solothurnische Kantonallandsgemeinde
zur Vorbereitung des Bundestags von Sumiswald,
auf der denn auch die Delegation für Sumiswald gewählt wurde. «Die
Landsgemeinde war sehr zahlreich besucht; fast aus allen Vogteien
erschienen Abgeordnete», berichtet Vock. «Sie liessen» — so erzählt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 288 - arpa Themen Projekte
Sigismund von Erlach
der Bauernschlächter',
General der Berner Herren-Truppen im Bauernkrieg.
Nach einem zeitgenössischen Originalstich in der Landesbibliothek
in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 288 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 289 - arpa Themen Projekte
er weiter, ohne genauer zu sagen, wer die «sie» waren — «am gleichen
Tage die Regierung durch den Urs Borer aus Büsserach mündlich ihrer
Ergebenheit und Treue versichern.» Die «sie» aber waren vermutlich
nur die mit der Regierung einig gehenden Kapitulanten unter Adam
Zeltners Führung.
Die Regierung ihrerseits hatte vorgesorgt, dass die Kapitulanten,
mit denen sie so einig war, des Stichworts seitens der Herren nicht
ermangelten. Sie richtete ein feierliches «väterliches» Schreiben an die
Landsgemeinde. Darin versuchte sie, zu beweisen, wie überflüssig diese
Landsgemeinde bei der von ihr als vollkommen supponierten Harmonie
zwischen Volk und Regierung sei, «wie väterlich und aufrichtig Wir
gegen Euch alle insgemein gesinnt sind, und Ihr nicht weniger Euch
gegen Uns erklärt habet...» etc. Auch leugnet sie alle und jede Gefahr
«fremder Truppen», erklärt, dass sie «keine eigentliche oder nur
die wenigste Wissenschaft» davon habe und treibt ein schlaues Spiel
damit, indem sie feierlich versichert, die solothurnische Regierung sei
«nicht des Sinnes, dergleichen ins Land führen zu lassen». Dass auch
sie jedoch der von der Tagsatzung gegen die Bauern insgesamt aufgestellten
Truppenmacht ebenso feierlich zugestimmt hatte, verschweigt
sie natürlich. Und dies alles waren die von den Bauern so gefürchteten
«fremden Truppen», nicht bloss die «welschen» Söldner, die ausserdem
von den verschiedenen Herrenregierungen, unter ausdrücklicher
Billigung, ja Förderung seitens der Tagsatzungsherren, hinzugemietet
waren.
Der geschichtlich — und demagogisch — interessanteste Teil aber
dieses schlauen Rechtfertigungsschreibens der Solothurner Regierung
an das in Oberbuchsiten versammelte Volk ist ihr Versuch, den sie
darin macht, sich von der Mitschuld an dem Zwyerschen «Rechtlichen
Spruch» reinzuwaschen! Sie geht in diesem Bestreben so weit, die
Stände Uri, Unterwalden und Zug als mit dieser Schuld allein belastet
blosszustellen und davon die Stände Schwyz, Freiburg und Solothurn
ausdrücklich auszunehmen. Diese geschichtlich hochwichtige Stelle
lautet wörtlich: «Nun euch allen bösen Argwohn aus dem Grunde zu
benehmen, so haben wir rathsam befunden, euch hiemit des höchsten,
und so hoch eine Obrigkeit bezeugen kann, zu verständigen, 1. dass
Wir, vermöge beigelegter Abschrift des Wollhausischen Briefs, jederzeit
gern gesehen und gewünscht hätten, dass die Punkte, welche denen
von Willisau und Entlebuch zugesagt wurden, in den Rechts- oder gütlichen
Spruch wären eingesetzt worden, wie dass Wir schon vor diesem.
und noch dieser Tage, sowohl den drei Herren Ehrengesandten von
Uri, Unterwalden und Zug, —weil die drei übrigen, als: Schwyz, Freiburg
und Solothurn sich dessen einmündig (d. h. zu diesem Standpunkt
der Solothurner Regierung) bekennt, —als unsern Eidgenossen
der Stadt Luzern zugeschrieben haben, dass sie die Punkte, so zu Wertenstein»
(hier fehlt: und Ruswil) «versprochen worden, halten und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 290 - arpa Themen Projekte
keine Schuld tragen.»
Hut ab vor dieser Ehrlichkeit und Offenheit — die allerdings
deutlich von der Angst vor dem eigenen Volk erzwungen wurde! Aber
ist das nicht das Eingeständnis, dass der «Rechtliche Spruch» des
Herrn Zwyer wirklich eine Fälschung war? Und hatten denn die Luzerner
Bauern nicht —bei allem, was Menschen heilig ist —Recht,
sich diesem krassen Unrecht zu widersetzen? Einem Unrecht, das ihnen
im Namen einer eidgenössischen «Ehrengesandtschaft» und unter Androhung
einer (auch von der solothurnischen Regierung gebilligten!)
eidgenössischen militärischen Exekution aufoktroyiert werden sollte?
Und hatten dann nicht sowohl die Solothurner als auch die Berner,
Basler und alle übrigen Rebellen Recht, wenn sie sich in einer Frage,
die nicht ein kantonales, sondern ein eidgenössisches Unrecht betraf,
auch eidgenössisch erhoben? Das heisst als Bundesgenossen der durch
dieses eidgenössische Unrecht vergewaltigten Luzerner Bauern, ohne
Ansehen des Kantons und der Religion.
Es ist ein Ehrenzeugnis für das solothurnische Volk, für sein eidgenössisches
Rechtsbewusstsein und sein eidgenössisches Pflichtgefühl,
dass es sich von dieser Solidaritätspflicht andern Eidgenossen gegenüber
trotz dem überaus schlauen, beschränkt kantonalen Ablenkungsmanöver
seiner Regierung nicht abspenstig machen liess! Dass es auch
dem moralischen Wettern der «beiden E. E. Väter Kapuziner» standhielt,
die auf Geheiss der solothurnischen Regierung das aussprechen
mussten, was diese selbst im innersten Gemüt zwar genau so empfand,
aus demagogischen Gründen jedoch nicht selber zu sagen wagte. Sie
selber nämlich «vermahnte» in ihrem Schreiben die Landsgemeinde
nur, «ihr wollet doch Uns und euch Ruhe schaffen, still sitzen, kein
Geläuf machen», und verwahrte sich nur dagegen, dass die Schuld an
den Folgen einer andern Handlungsweise der Bauern über sie, die Regierung,
komme. Die Kapuziner dagegen, der Pater Guardian derselben,
sowie der Pater Damian, «warnten sie vor dem Besuche der Landsgemeinde
zu Sumiswald, indem sie ihnen die Folgen dieser Verbindung
mit den Untertanen anderer Kantone schilderten und das Verbrechen
des Hochverrats in seiner ganzen Abscheulichkeit darstellten»! Da also
hatten diese katholischen Geistlichen vollkommen die Rolle der Prädikanten
in den protestantischen Kantonen übernommen: die der Hetzhunde
ihrer Herren.
Trotzdem beschloss die Lands gemeinde von Oberbuchsiten vom
21. April die Teilnahme am Bundesschwur in Sumiswald! Denn dabei
wirkten ja, neben dem durch die Eröffnung im Schreiben der Herren
nur umsomehr bestärkten eidgenössischen Rechts- und Pflichtgefühl
im Volkssinne, die noch viel elementareren Gründe der sozialen Solidarität
mit ihren Klassengenossen in den anderen Kantonen umso bestimmender
mit, als es ihre wahren eigenen Gründe zur Erhebung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 291 - arpa Themen Projekte
Bauern- und Kleinbürgerklasse, die eine ebenso allgemein-schweizerische
war wie das Zwyersche Unrecht, das seine Wurzel ja auch seinerseits
nur in der Klassenunterdrückung hatte.
Dennoch kam auch hier wiederum bei der Ausschiessung der Delegierten
für die überkantonale Landsgemeinde zu Sumiswald eine falsche
Wahl zustande. Denn bei der demagogisch so geschickten Haltung der
Regierung war es für die Kapitulanten immerhin ein Leichtes, an die
Spitze zu kommen und der Delegation ihre Richtlinie aufzudrängen.
Gewählt wurden: Adam Zeltner, als Führer der Delegation, und das
war bereits eine zwangsläufige Folge der falschen Wahl desselben zum
Landeshauptmann; ferner: Veit Munzinger und Klaus Zeltner von
Olten, der Weibe! Hans Joggi Rauber von Egerkingen, sowie Joggi
Strub, der Sohn des Untervogts von Trimbach. Doch dies geschah
nicht ohne leidenschaftliche Opposition der wirklichen Revolutionäre!
Als Adam Zeltner — leider erst nach bereits erfolgter Wahl — das
Wort ergriff, um die mit der Regierung abgekartete Richtlinie zu propagieren:
«dass sie, die Landleute von Solothurn, mit ihrer Regierung
vollkommen zufrieden seien und dass, wenn sie auch nach Sumiswald
gehen, sie nichts reden oder tun werden, als was den Gnädigen Herren
und Obern zum Frieden und Besten gereiche» — da erhob sich ein
Sturm der Empörung. «Hier fielen Urs Rohr von Kestenholz und Klaus
Zeltner von Niederbuchsiten dem Untervogt Zeltner ins Wort und nannten
ihn vor allem Volke einen Landesverräter, Schelmen und Dieben,
der es heimlich mit der Regierung halte und, was er von den Bauern
und an den Lands gemeinden vernehme, sogleich wieder dem Landvogte
hinterbringe und zu Ohren trage»!
Aber es war zu spät —man hatte den Bock bereits am Tag zuvor
allzu blindgläubig zum Gärtner gemacht. Immerhin hatte dies zur
Folge, dass die echten Revolutionäre, besonders die Oltener, sich nun
als zweite, inoffizielle, aber viel stärkere Delegation organisierten und
zur Korrektur ihres Fehlers ebenfalls nach Sumiswald eilten: «Nebst
diesen Abgeordneten (den fünf offiziellen) liefen aber auch Urs von
Arx, der Färber, Hans Jakob von Arx, der Mondwirt von Olten, und
viele andere nach Sumiswald, sodass die Zahl der daselbst anwesenden
Solothurner Landleute sehr beträchtlich war, indem auch die Vogteien
Kriegstetten, Leberen und Flumental, auf ihren besonderen Landsgemeinden,
die erstere zu Subingen, die zweite zu Selzbach und die dritte
am ,Scheidewege', ihre eigenen Deputierten ernannt und nach Sumiswald
geschickt hatten.» So berichtet der Herrenchronist Vock.
Zu diesem Ergebnis hatte zweifellos die Anwesenheit einer starken
Willisauer Delegation, sowie der bedeutenden und entschlossenen Basler
Landschäftler-Gruppe unter Isaak Bowe und Uli Schad Entscheidendes
beigetragen. Und es war nur konsequent von der Solothurner
Regierung, dass sie daraufhin, um der Kapitulanten-Delegation des
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 292 - arpa Themen Projekte
am 22., ein eigenes Schreiben an diese richtete, in dem sie es zwar jetzt
noch versuchte, sie überhaupt vom Besuch Sumiswalds abzuhalten, jedoch,
da dieser nun einmal beschlossen war, Nutzen auch daraus zu
ziehen verstand, da dies ja eine glänzende Gelegenheit bot, durch die
Kapitulanten sogar in Sumiswald selbst Sabotage und Zersetzung zu
betreiben: da deren (der Delegation Adam Zeltners) «Verrichtung aber
anderes nichts sei, als dass ihr unsere getreuen Unterthanen zu bleiben
begehret... bei eurem gethanen Versprechen gegen Uns zu beharren
und euch aller obrigkeitlichen Gutmüthigkeit, wie bisher, also auch
fürbass unzweifentlich zu versehen...»
Seit der entscheidenden Beratung der revolutionären Führer der
verschiedenen Kantone in Willisau am 18. April fanden nun überall,
im. ganzen Aufstandsgebiet, derartige Landsgemeinden zur Vorbereitung
des Bundesschwures und zur Abordnung von Delegationen zu
demselben nach Sumiswald statt. Aber von keiner einzigen, hören wir,
dass auf ihr die Kapitulanten auch nur im geringsten eine ähnliche
Rolle gespielt hätten wie auf der Landsgemeinde von Oberbuchsiten.
Sie waren eben meistens direkt von Entlebuchern und Willisauern
organisiert, die ihre erstaunlich expansive Energie ganz besonders dem
Bernerland zuwandten, dem sie die Errichtung des neuen Bundes in
so weitblickender Weise anvertraut hatten. So verliefen die Landsgemeinden
in Signau, Langnau, Biglen, Konolfingen und Langenthal im
Zeichen des begeisterten Bewusstseins, einer grossen geschichtlichen
Aufgabe zu dienen. In Signau hatten sich, ausser zahlreichen Entlebuchern,
übrigens auch, wie Vock berichtet, «Solothurner aus den»
(hundertprozentig rebellischen!) «Vogteien Kriegstetten und Bucheggberg
eingefunden und sich zu gemeinschaftlichen Massregeln verabredet'
—zweifellos, um den eigenen solothurnischen Saboteuren von
vornherein das Handwerk zu legen...
Von den Herren in Bern dagegen wurden, so berichtet Bögli, «bei
der ersten Kunde von den neuen Umtrieben wieder kriegerische Anstalten
getroffen und Zürich um Einberufung der Tagsatzung ersucht.
Ein Ratsbeschluss bestimmte, dass die gesamte Bürgerschaft, die Studenten
und die fremden Handwerksburschen für die Zeit ihres Aufenthalts
beerdigt wurden'. Damit sollte einer ähnlichen Erhebung der unterdrückten
Bürger gegen die Aristokraten vorgebeugt werden, wie sie
in Luzern zur selben Zeit ständig gärte, ja selbst in Basel und Zürich.
nicht ganz ausgeschlossen schien, und wie sie in den kleineren Landstädten
faktisch fast überall in Gang gekommen war. «Auf das Land
schickte man am 19. April eine Gesandtschaft aus zur Entgegennahme
der Huldigung. Aber zur Huldigung war nicht grosse Geneigtheit vorhanden».
händen», wie Bögli bemerkt. «Aus den Aemtern Burgdorf und Wangen
kam Bericht, dass die Leute sich nicht unterwerfen wollen. Die Wiedlisbacher'
— das kleine Landstädtchen war das revolutionärste im
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 293 - arpa Themen Projekte
auf. Grosser Lärm erhob sich wegen des Gerüchts vom Anzug der
welschen Völker. Dieser Verdacht der Bauern war freilich kein unbegründeter.
Denn am 23. April» —mithin am Tag von Sumiswald selbst
— «ermahnte die Regierung von Bern die Städte Biel, Neuenburg, Neuenstadt
und Genf zur Bereithaltung ihrer Hülfstruppen. In Bern hoffte
man im Ganzen 4700 Mann aufbringen zu können...»
So sah die Bilanz der Kräfte und Gegenkräfte aus, die die ungeheure
Aktivität der Entlebucher und der Willisauer (die «pestilenzialische
Unersättlichkeit», wie die Luzerner Regierung am 21. April an
den Vorort schrieb) auf den Plan gerufen hatte —als die Ausschüsse
des zum erstenmal ohne Ansehen des Kantons und der Religion geeinten
Schweizervolkes zum Eidschwur auf den ersten und einzigen allgemeinen
«Volksbund» gegen den «Herrenbund» seiner Regierungen
aus allen Teilen des Landes gen Sumiswald hinaufeilten.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 295 - arpa Themen Projekte
XIII.
Das Fest der Freiheit in Sumiswald:
Die letzte Bauern-Verfassung der Eidgenossenschaft —
ein erster Lichtblick in die Bürgerfreiheit einer neuen
Schweiz
Jetzt war das Richtfest des Aufruhrs zur Sache der Berner Bauern
geworden. Das war keine leichte Sache für sie, trotz der Hülfe der
Entlebucher und der Willisauer. Als diese die zehn Aemter mit solchem
Erfolg zu dem geschlossenen Bau des Wolhuser Bundes zusammenschweissten,
da konnten sie ihn auf ein immer noch vorhandenes
Grundgerüst ihrer alten Volksfreiheit abstützen. Gerade dieses aber
war im Bernischen teils überhaupt nie vorhanden gewesen, teils inzwischen
längst —bis auf wenige, bedenklich angefaulte Pflöcke — aus
dem Boden gerissen. Dabei sollte auf diesem an sich schon schwankenden
Fundament jetzt ein viel grösserer Bau errichtet werden, der nicht
allein die Volksfreiheit der Berner zum Teil erst überhaupt begründen,
sondern auch die der Luzerner beschützen und dazu die der Solothurner,
der Basler und die der Freien Aemter, ja, nach Plan und Absicht
die Volksfreiheit der ganzen Schweiz umfassen sollte. Und dabei mussten
die Berner von den Solothurnern, den Baslern und den Freiämtlern
in so mancher Hinsicht grad ebenso verfaulte Fundamente der Volksfreiheit
übernehmen, wie sie sie selber hatten.
Der Ausführung dieses grossen und kühnen Planes waren die
Berner Baumeister des neuen Bundes nicht gewachsen. Das muss zum
vornherein gesagt werden. Drei mächtige Anläufe machten sie innert
drei Wochen: in Sumiswald am 23. April, in Huttwil am 30. April, und
abermals in Huttwil am 14. Mai 1653. Aber sie gelangten damit niemals
bis zum First! Nicht einmal das Grundgerüst des neuen Bundes war
fertig geworden —als es bereits von der intellektuell wie militärisch
überlegenen Gewalt des Herrenbundes mit Stumpf und Stiel aus dem
Boden gerissen wurde... Und niemand, nicht einer aus dem gesamten
herrschenden Schweizer Bürgertum, der ihm seine intellektuelle und
darum auch militärische Unterlegenheit hätte ausgleichen helfen können,
kam dem Schweizervolk dabei zuhilfe! Im Gegenteil: die Schweizer
Herrenbürger waren sämtlich Klienten und Kapitulanten des europäischen
Absolutismus, der die Schweiz rings umschloss und in dessen
Sold sie alle standen, und sie überboten sich gegenseitig darin, das
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 296 - arpa Themen Projekte
Das darf nicht vergessen werden, wenn man den so himmeltraurigen
Ausgang dieses tragisch ungleichen Ringens um den neuen Bund
gerecht beurteilen will...
Vergeblich sieht man sich übrigens während der ganzen Zeit der
fieberhaften Vorbereitungen der Entlebucher und Willisauer für den
neuen Bund nach den Berner Baumeistern desselben um. Wir konnten
nur vermuten, dass Uli Galli, der von Anfang an immer besonders innig
mit den Entlebuchern —seinen Nachbarn in Eggiwil —zusammengearbeitet
hat, unter den Bernern war, die in der Geheimversammlung
vom 18. April in Willisau den Bundesbrief mitberieten. Und nur vermutlich
ist auch Johann Konrad Brönner dabei gewesen. Ganz sicher
war derjenige nicht dabei, der zum Oberbaumeister des neuen Bundes
ausersehen war: Niklaus Leuenberger. Der bestellte während all der
Zeit friedlich sein Haus, sein Vieh, seine Felder rings um seinen Hof
in Schönholz und sass abends wohl still über die Postille gebückt, ins
Lesen der Bibel oder frommer Wiedertäufer-Gebete versunken. Auf
keiner einzigen der zahlreichen vorbereitenden Versammlungen auch
im Bernbiet war er anzutreffen. Er hatte sich als frommer Mann geschworen,
seinen Gnädigen Herren den Eid zu halten, den er ihnen
bei seinem Kniefall am 4. April zu Bern geschworen. Dies, trotzdem
die Gnädigen Herren ihrerseits bis zu diesem Sumiswalder Tag nicht
daran gedacht hatten, die dem Land feierlich gemachte Zusage zu halten,
die «Konzessionen», für die er mit so vielen anderen sich derart
gedemütigt, in Brief und Siegel herauszugeben. Dies allerdings erzürnte
ihn tief, und das Mass musste auch für ihn früher oder später voll werden.
Für das ganze Land war es schon voll, das merkte er an seinen
Nachbarn.
Denn da wurde nun im ganzen Emmental von Haus zu Haus zur
grossen Landsgemeinde nach Sumiswald aufgeboten. Auch zu Leuenberger
kamen sie. Einer seiner besten Freunde wurde ihm ins Haus
geschickt: Hans Uli Neuhus von Schwanden, in der gleichen Kirchhöri
Rüderswil, zu der Leuenbergers Weiler gehörte. Wer mag ihn geschickt
haben? Wohl sicher der Uli Galli! Denn Uli Neuhus war ein richtiger
Galli-Jünger; auf allen Landsgemeinden und geheimen Versammlungen
tauchte er auf; für sich allein mobilisierte er das ganze «Schwandenviertel»
für die Bauernsache und nun auch für den Bundschwur in
Sumiswald. Seit Leuenberger, der noch vor einem Monat so tatkräftig
mitgeholfen hatte, das ganze Emmental bis vor die Tore Berns mit
einem Netz von Bauernwachen zu überziehen, nach Bern gegangen
und dort zu einem Treueid übertölpelt worden war, war Uli Neuhus
für ihn eingesprungen. Er war, wie Uli Galli, nicht mit nach Bern gegangen;
er war es jetzt, der an Leuenbergers Stelle die Bewachung und
Sperrung der Pässe besorgte. Leuenberger hatte wohl also ein moralisches
Schuldkonto bei Uli Neuhus: war er selber inzwischen aus religiösen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 297 - arpa Themen Projekte
so war Uli Neuhus jetzt sein politisches Gewissen, das ihn
wieder zur revolutionären Solidarität antrieb.
Aber es war für Uli keine leichte Sache, Klausens tiefeingewurzelte
Skrupeln wegen des Eides zu überwinden, den er den Herren geleistet
hatte. Gewiss, auch die Herren hatten ihr Wort gebrochen; das mochte
ihm Uli in allen Tönen vorhalten. Doch ein Wort. ist ein Wort; ein
Eid aber ist ein Eid — der verpflichtet nicht gegenüber Menschen,
sondern gegenüber Gott! Mögen die Menschen, die ihn einem abgedrungen
haben, auch selbst Wortbrecher sein. Was kümmern mich
die Menschen? Ich habe meine Sache nicht auf Menschen gestellt,
sondern auf Gott... So sprach der gläubige Sektierer in Leuenberger.
Und darum, einzig darum schon, war er keine tragende Säule im Entscheidungskampf
für die menschliche Gerechtigkeit. Denn sein Gewissen
konnte in jedem Augenblick ins Jenseits ausweichen, statt in der
rauhen Wirklichkeit standzuhalten. Und ehe man sich's versehen, hat
man um des eigenen «Seelenheils» willen seine Menschenbrüder bereits
verraten. Und dies vielleicht im schwersten Augenblick, wo allein
irdisch zupackende Hilfe, wo vielleicht nur Aufopferung der eigenen
Person sie vor der immer irdisch zupackenden Ungerechtigkeit, vor
Not und Tod hätte retten können! Ist das nicht vielleicht die richtige
«Frömmigkeit» —du anderer Bruder Klaus?...
Und so rang in dem zwiespältigen Leuenberger das politische Gewissen
dem religiösen das Versprechen ab, zu kommen nach Sumiswald.
Aber «nicht in der Absicht, eine Führerrolle zu spielen»; das
nämlich war die Versuchung, der Teufel, der Asmodaj, der ihm die
Welt zeigte, in der er, der schöne, gesunde und intelligente Mann mit
seiner grossen Redegabe, doch allzugern gerade eine solche Rolle hätte
spielen mögen. Darum schützte er unentwegt seine «noch habende Jugend
und Unkönnenheit» vor —bis er auf dem aus Wirtshaustischen
errichteten Thron der Führung stand! Aber er war ja nur gekommen,
«um zu erfahren, was verhandelt wurde.. wurde...»
Schon am Abend des 22. April wimmelten die Gasthöfe und Bauerngüter
in Sumiswald und weitherum bis Trachselwald, Lützelflüh, Ramsei
und Affoltern von den zu Fuss, zu Ross und auf Wagen weither gekommenen
Gästen der Bauernsame und Kleinstadtbürger aus vier
Kantonen, sowie aus den Freien Aemtern Hitzkirch und Meyenberg.
Sumiswald liegt wunderbar frei und stolz hingelagert auf dem breiten
Rücken eines Hügelzuges, der vom Napfmassiv wie die Pranke eines
ruhenden Löwen nach dem Westen gestreckt wird. Das Dorf bedeckt
gerade das westliche Ende der fruchtbaren Hochfläche, die mit fetten
Wiesen und reichtragenden Kornäckern wohlbestellt und in weiten
Abständen von Obstbäumen bestanden ist. Ein tiefer Schachen trennt
es von dem südlich gegenüber, auf einem höheren Rücken liegenden
Trachselwald, von dem nur die Türme des Schlosses, des Sitzes des
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 298 - arpa Themen Projekte
der jenseits des Schächens steil und düster ansteigt. Die
Häuser Sumiswalds dagegen sind allseitig schon von weit her sichtbar.
Sie gehören zu den stattlichsten des Emmentals, d. h. zu den schönsten,
die man in der ganzen Welt finden kann. Ihre weit ausladenden Dächer,
die seitlich wie abwärts gespreizte Adlerflügel oft bis fast auf
den Boden streichen, ragen über mächtigen Giebelbögen dem auf sie
Zuschreitenden weit entgegen und scheinen ihn schon aus der Ferne
unter ihre schützenden Fittiche nehmen zu wollen. In der Tat machte
die unvergleichliche Gastfreundlichkeit der Emmentaler Bauern, im
Verein mit dem schönen, milden Frühlingswetter, diesen und den folgenden
Tag mitten in der Woche —der 23. war ein Mittwoch —für
jeden der tausend Hergesandten zu einem unvergesslichen Fest. Aber
auch für Ordnung hatten die Emmentaler ihren Gästen gegenüber gesorgt:
«alle, wie sie eintrafen, mussten sogleich Name, Geschlecht und
Heimat angeben, die von einem Schreiber pünktlich aufgezeichnet
wurden», so berichtet Vock.
«Am 23. April zogen die Landleute, mehr als 1000 Mann» —
andere, z. B. Liebenau, sagen zwei- bis dreitausend —, «aus Sumiswald
auf das nahe dabei liegende freie Feld, wo ein langer Tisch zur Rednerbühne
bereitet und aufgestellt war.» Bevor es jedoch zur Eröffnung
der Landsgemeinde kam, gab es ein langes Parlamentieren darüber,
wer den Vorsitz führen sollte. Im Entlebuch war diese Frage stets im
vornherein gelöst: denn die noch immer bestehende Bestellung der
Landesämter durch Volkswahl stellte für jede solche Gelegenheit den
Landespannermeister, den Landeshauptmann und Landessiegler automatisch
an die Spitze, und ausser ihnen standen immer noch alle
übrigen von den vierzig Landesgeschworenen zur Stellvertretung bereit.
Im Emmental war nichts von alledem vorhanden.
Da war aber Niklaus Leuenberger schon am frühen Morgen mit
Uli Neuhus aus Rüederswil herübergekommen, und auch sein unmittelbarer
Nachbar und Vertrauter, Hans Bieri aus Schönholz, war dabei
— sein späterer Judas, der ihn für einen silbernen Becher dem
Landvogt Tribolet in die Hände liefern wird... Nun gab es aber keinen
Emmentaler Bauernführer, der Klaus Leuenberger die reitende
Tat vergessen hätte, die er vor genau einem Monat drüben in Trachselwald
an ihnen allen vollbracht hatte, als er Samuel Tribolet in zäher
und geschickter Redeführung das obrigkeitliche Instrument aus der
Hand wand, kraft dessen sie alle inzwischen längst hinter Schloss und
Riegel hätten sitzen können. Gegen dieses Verdienst fiel der unglückselige
Gang nach Bern schon deshalb nicht ins Gewicht, weil selbst
der ärgste Feind einem Leuenberger auch nicht den Schatten einer
Verratsabsicht zugetraut hätte, ihn vielmehr dabei, wie auch alle
andern Beteiligten, ganz selbstverständlich als unschuldiges Opfer der
Infamie der Herren empfand. Ausserdem empfahl ihn für den Vorsitz
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 299 - arpa Themen Projekte
von ihm zum Staunen Aller entwickelte starke Redegabe.
So fiel es Uli Neuhus nicht schwer, alle andern Bauernführer für
Leuenbergers Vorsitz zu gewinnen, umso weniger, als sich ihm bei diesem
Werben der leidenschaftliche Daniel Ruch aus Waldhus bei Lützelflüh
zugesellte, der wie Uli auf allen Landsgemeinden und Geheimversammlungen
zu sehen und ebenfalls nicht nach Bern gegangen war
und der später einer der tätigsten Kriegsräte Leuenbergers wurde, der,
entflohen, in contumaciam zum Tode verurteilt und dessen ganzes
Vermögen als hablicher Bauer von der Regierung konfisziert wurde.
Leuenberger selbst aber musste auch hier noch —wie es in seinem
Todesurteil steht — «auf ihm gethanes Tröuwen und Hans Uli Neuhausen
Gebieten und ernsthaftes Anhalten», sowie «auch Daniel
Ruchon von Waldhaus überlästiges, offenes Begehren», «wider alle
gesuchte Ausreden und fürgewendte noch habende Jugend und Unkönnenheit»
förmlich gezwungen werden, «ihr Redner sein zu müssen»;
«worauf sie ihm versprochen, dass ihm dress nüt schaden, sondern
er vielmehr dessen von ihnen zu geniessen haben solle».
So schwer hielt es hier, den Führer an die Spitze zu stellen, der
doch von der ganzen Masse frenetisch als solcher begrüsst wurde. Mit
ihm bestiegen dann ganz selbstverständlich auch Uli Galli, der eigentliche,
aber bislang soviel wie möglich geheime Organisator der Berner
Revolution, sowie Johann Konrad Brönner, der Notar aus Münsingen
und seit der ersten Konolfinger Landsgemeinde Schreiber der Bauern,
den Rednertisch. Es ist das erstemal, dass Uli Galli öffentlich sichtbar
in Führung tritt. Dann aber —und das war das eigentliche grosse Ereignis,
das alle zu einem Beifallssturm begeisterte —bestieg den Tisch
auch Hans Emmenegger, der Pannerherr des Entlebuchs und längst
anerkannte, ja bereits sagenumwobene Führer der luzernischen nicht
nur, sondern der gesamten bisherigen Revolution; und mit ihm stieg
auch Niklaus Binder, der Landessiegler des Entlebuchs, sein Stellvertreter
und Gehilfe, hinauf. Aber auch der Führer und Verführer des
Rothenburger Amtes, der nun wieder zum Scharfmacher gewordene
Demagog und Kapitulant Kaspar Steiner, bestieg mit Emmenegger zusammen
den langen Rednertisch. Mit dem Erscheinen der Luzerner
Bauern auf der bäuerlichen Tribüne von Sumiswald aber war ein für
allemal der überkantonale und überkonfessionelle Charakter der Revolution,
ihr bäuerlicher Klassencharakter, in den Augen aller Bauern
der Schweiz öffentlich besiegelt.
Ihr allgemein schweizerischer Charakter als Erhebung des unterdrückten
und ausgebeuteten Volkes gegen den Bund der Regierungen
wurde auch durch das erste Traktandum auf das denkbar nachdrücklichste
unterstrichen. Dieses nämlich war: die Verlesung des berüchtigten
Mandats der Tagsatzung vom 22. März 1653! Man muss sich die
masslosen Beschimpfungen und zornrauchenden Drohungen in Erinnerung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 300 - arpa Themen Projekte
diesem Manifest nicht nur gegen die Luzerner Bauern, sondern —unter
dem Albdruck der eben auch im Bernischen ausgebrochenen Rebellion
—gegen das gesamte unterdrückte und ausgebeutete Volk der Schweiz,
an der Spitze die Bauernklasse, geschleudert hatte: dann begreift man
die einmütige Begeisterung, mit der bereits auf dieser ersten allgemein
schweizerischen Landsgemeinde der Volksbund gegen den Herrenbund
beschlossen und beschworen wurde.
Doch bevor es zu diesem imponierenden Abschluss kam, ergriff
je ein Hauptredner jedes beteiligten Kantons das Wort, um dessen
besondere konkrete Beschwerden gegen das Badener Mandat ins Feld
zu führen. So verlas, im Auftrag Emmeneggers, der Landessiegler
Niklaus Binder —der soeben auch das Mandat selbst vorgelesen hatte
—«gleichsam zur Widerlegung desselben» wie Vock erzählt, «die
schriftlich verfassten Klagepunkte der X Aemter des Kantons Luzern
gegen ihre Regierung, worüber er mündlich noch weiter sich verbreitete.
Nach Beendigung seines Vortrags wurden vom Notar Brönner
die ebenfalls schriftlich verfassten Klagen und Beschwerden der Berner
Bauern gegen ihre Regierung herabgelesen, und Uli Schad, der Weber
von Oberdorf setzte die Versammlung von dem in Kenntnis, was jüngster
Tage im Kanton Basel vorging und was das dortige Landvolk gegen
seine Regierung zu klagen habe».
Der einzige Mission, der in diesem Text der Einmütigkeit erklang,
kam vom Vertreter der Solothurner Bauern, den wir vielleicht besser
als Vertreter der Solothurner Regierung bezeichnen. Adam Zeltner
nämlich soll, nach seinem Lobredner, dem Herrenchronisten Vock,
erklärt haben: «Sie, die Solothurner Landleute, seien mit ihrer Regierung
zufrieden; sie haben ganz und gar nichts über dieselbe zu klagen,
und sie können daher auch keinen einzigen Klageartikel vorbringen»;
sie seien hierher nur «geschickt worden, um zu vernehmen und anzuhören»,
etc. Nach dem Luzerner Herrenchronisten Liebenau soll er
immerhin hinzugefügt haben (was Vock unterdrückt): sie «seien aber
doch bereit, fremden Truppen den Durchpass durch ihr Gebiet zu verwehren».
Aber die Solothurner Opposition gegen den Kapitulanten
Adam Zeltner —die, wie wir wissen, sehr zahlreich nach Sumiswald
geeilt war —wird bei den Führern der andern Kantone schon dafür
gesorgt haben, dass diese wussten und auch der Versammlung zu verstehen
gaben, was von Adam Zeltners Rede zu halten sei. Zwar wissen
wir nicht, wie die Versammlung selbst diese Rede aufgenommen hat, —
wie wir überhaupt von den Verhandlungen dieser grundlegenden Gesamtlandsgemeinde
im Einzelnen verdächtig wenig überliefert bekommen,
weniger als von mancher winzigen lokalen Gemeinde. Aber mag
uns auch die Wut der Herren und Herrenchronisten jener Zeit über
das Zustandekommen dieser ersten wirklichen Gegen-Tagsatzung des
Volkes die Einzelheiten unterschlagen haben — wie sie uns die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 301 - arpa Themen Projekte
der Willisauer- und Freiämtler-Führer und der Solothurner (besonders
der Oltener) Opposition, ja selbst die Reden Leuenbergers unterschlagen
hat —: die Unterschriften der zahlreichen Solothurner Aemter auf
dem nun zustandegekommenen Bundesbrief zeugen eindeutig dafür,
wo auch das Solothurner Volk in Wirklichkeit gestanden hat!
Ehe wir jedoch zu diesem Bundesbrief und zum Bundesschwur
übergehen, mag noch ein kleines Bocksspiel erzählt werden, das die
Berner Herren selbst hier einschalteten und dessen Ausgang die Wut
dieser Herren ganz besonders erklärt. Es war nämlich auch eine
Deputation der Berner Regierung auf der Sumiswalder Landsgemeinde
erschienen; ihre Namen werden uns nicht überliefert, offensichtlich
deshalb, weil dabei die Exzellenzen (wie sich die Räte in Bern betiteln
liessen) allzusehr gedemütigt wurden und dem neuen Schultheissen
die erste schwere politische Schlappe eintrügen. Die Deputation muss
aber ansehnlich gewesen sein; denn, wie Tillier berichtet, war sie «eine
Gesandtschaft von vier Mitgliedern des kleinen (der eigentlichen Regierung)
und vier Mitgliedern des grossen Rats».
Diese acht Herren waren schon seit dem Montag, dem 21. April —
an welchem Tage die Führung der Staatsgeschäfte «aus den Händen
des bisherigen Amtsschultheissen Niklaus Dachselhofer in diejenigen
des Schultheissen Anton von Grafenried», d. h. des Führers der unversöhnlichsten
Kriegspartei im Berner Herrenlager, überging —auf der
Reise «von Kirchspiel zu Kirchspiel» gewesen, wo sie «die neuen Artikelbriefe
mitteilen» (d. h. nur vorlesen, nicht etwa ausliefern!) «und
den Huldigungseid aufnehmen sollten». Gleichzeitig aber hatten sie
den Auftrag, mit allen Mitteln «die grosse Vereinigung in Sumiswald
zu hintertreiben»! Es war also auch von der bernischen Regierung —
genau gleich wie in ähnlichen Fällen von der luzernischen — eine
grosse «Diversion» gegen Sumiswald in Gang gesetzt worden. Allerdings
musste die Ratsdeputation schon von der Reise aus nach Bern
berichten, dass «weder der Huldigungseid erhältlich, noch die grosse
Vereinigung in•Sumiswald zu hintertreiben sein würde». So berichtet
ein späterer Nachfahre dieser Herren selbst, der Herrenchronist Anton
von Tillier, dessen Vorfahre, der Welschseckelmeister Johann Anton
Tillier, der mit Vorliebe für solche «Pacificationen» verwendet wurde,
mit grösster Wahrscheinlichkeit Mitglied auch dieser Diversions-Gesandtschaft
zur Verhinderung des Sumiswalder Bundesschwures war.
Vom Eingreifen dieser selben Gesandtschaft in die Verhandlungen
der Sumiswalder Landsgemeinde selbst, und zwar unmittelbar vor dem
Bundesschwur, ist nun die Rede, wenn Vock schreibt: «Die Regierung
von Bern hatte eine aus mehreren Ratsgliedern bestehende Gesandtschaft
nach Sumiswald mit dem Auftrage geschickt, die Verbindung
ihrer Angehörigen mit den Landleuten anderer Kantone auf alle Weise
zu hindern, und diese Ratsabordnung erschöpfte das mögliche Mass
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 302 - arpa Themen Projekte
zu erreichen; allein vergebens. Die Bauern achteten weder auf Bitten
noch auf ernste Zusprüche, und die Gesandtschaft der Regierung
kehrte ohne den mindesten Erfolg ihrer Sendung nach Bern zurück.»
Ja, wie der alte Herrenchronist Lauffer, den Vock in einer Fussnote
anführt, berichtet, wurden die Berner Herren besonders «von den Entlebuchern
zu Sumiswald mit Schmäh- und Lästerworten schimpflich angegriffen»!
Zwar mag dabei die besondere Anschwärzung der Entlebucher
einem tendenziösen Zweck des protestantischen Herrenchronisten
Lauffer gegen die katholischen Bauern entsprochen haben, die
ihm als die «Anstifter» der Berner Revolution besonders verhasst waren.
Dennoch ist doch wohl soviel gewiss, dass eine direkte Intervention
der Berner Herren von der geschilderten Art auf der überkantonalen
Landsgemeinde zu Sumiswald nicht ohne dramatische Zuspitzung
von Rede und Gegenrede vor sich gehen konnte. Das ist umso sicherer
anzunehmen, als auch der katholische Herrenchronist Liebenau von
den «Schmäh- und Lästerworten» der Entlebucher zu berichten weiss
und dabei die wahre Ursache dazu entschlüpfen lässt, indem er von
den Regierungsabgeordneten berichtet: «als die Güte nichts half, gingen
sie zu Drohungen über»! Die Berner Herren haben also provoziert und
dabei offensichtlich die Entlebucher als die Urheber des Bundes besonders
auf's Korn genommen. Aber auch ohnedies ist es klar, dass
dieser Sabotierungsversuch am neuen Bunde in dem Augenblick, als
er eben feierlich aus der Wiege gehoben werden sollte, den besonderen
Hass der wirklichen Urheber dieses Bundes auf die Berner Herren lenken
musste. Ja, den Hass aller der tausend Gesandten des Schweizervolkes,
die einen so weiten und gefährlichen Weg — einschliesslich so
mannigfaltig angedrohter Leibes- und Lebensstrafen wegen «Hochverrats»
— nicht gescheut hatten, um mit Hand anzulegen, wo es galt, der
wiedererstandenen eidgenössischen Volksfreiheit Bahn und Sieg zu bereiten.
Dies nämlich war wirklich die Meinung der tausend Gesandten
des Schweizervolkes, als sie die acht Gesandten der Herren, die sich
an diesem eben neu erstehenden Volksheiligtum vergriffen, aus ihrer
Gemeinschaft ausstiessen. Denn nun hörten, beschlossen und beschworen
sie —nach artikelweiser Durchberatung des in Willisau aufgestellten
Entwurfes, über welche wir leider sehr wenig wissen —in tiefster,
durch Gebet bestärkter Frömmigkeit vereinigter Katholiken und Protestanten
einmütig folgenden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 303 - arpa Themen Projekte
«Bundesbrief
der Unterthanen der vier Städte Bern, Luzern,
Solothurn und Basel,
samt andern ihren Beipflichtern,
zu Sumiswald aufgerichtet und beschworen
am 23. April 1653.
Zu Wissen und kund ist Jedermänniglich, was sich Anno 1653 in
der Herrschaft Luzern im Land Entlebuch für ein Spann und Streit
erhoben wider ihre gnädige Obrigkeit der Stadt Luzern selbst, der Ursache,
dass die ihnen viele neue Aufsätze, grosse Strafen und Beschwerden
aufgeladen und bezwungen hat wider ihre Brief und Siegel. Darum
sie gesandte Männer an ihre Obrigkeit geschickt, welche freundlich,
unterthänig und mit grosser Bitt angehalten, solcher Beschwerden sie
zu entlassen, und abzuthun; aber nicht allein nichts erlangen mögen,
sondern man hat sie noch ausgebalget. Derowegen die Bauern erzörnt
worden, und haben zusammengeschworen, Leib und Leben daran zu
setzen, und haben alsdann ihnen keine Zins oder Geldschulden mehr
lassen zukommen, bis ihre gnädige Obrigkeit ihnen ihre alten Brief'
und Rechtungen wieder zu Handen stelle, die sie ihnen genommen hat.
Darum ihre Obrigkeit ihre übrigen Unterthanen aufmahnen wollte,
sie damit zum Gehorsam zu bringen. Als sie aber die Ursachen vernommen,
haben sie sich auch mit gleichen Beschwerden beladen gefunden.
Darum sie auch zu denen im Entlebuch gestanden, und zu
Wollhausen zusammengeschworen haben, weil sie mit Bitte nichts besonderes
erlangen mochten, was ihnen gehörte. Derowegen war ihre
Obrigkeit übel zufrieden, beschrieb (liess kommen) sie Herren Abgesandten
aus den VI kathol. Orten, welche Herren gar lang mit der
Sache umgegangen sind, und wurde also der Handel je länger je böser,
also dass die Aemter vor die Stadt Luzern gezogen, weil die Herren
ihren verbündeten Bundsgenossen Kriens und Horb stark gedroht,
alles zu verderben, wenn sie nicht zur Stadt fallen und schwören wollen.
Und indem haben die der XIII und unterschiedlichen Zugesandten
Orte der Eidgenossenschaft abgesandte Herren zu Baden ein ungutes,
unwahrhaftes Mandat gemacht, des Inhalts, dass sie allerhand höchst
sträfliche Fehler und Muthwillen unverantwortlich, wie offenbar am
Tage, verübt haben sollen; und haben sie solches über die obgenannten
Anfänger im Entlebuch mehrteils und über alle, die ihnen behelfen
sein würden, geschehen und ausgehen lassen, damit sie von aller Orte
Unterthanen verhasst würden, und sie nicht auch zu ihnen fielen, also
dass sie zu den Nachbarn in allen Orten nicht mehr kommen dorften
wegen des Mandats, weil sie so hoch verkleinert und verläumdet worden,
dass sie ihres Leibs und Lebens nicht mehr sicher waren, sondern
ihnen schon thätlich und feindlich begegnet worden, auch darzwischen
fremde und heimische Kriegsvölker auf sie sollten einfallen.
Darum sie mit uns Bernerbauern zu reden gekommen und abgeredet
haben, dass wir kein Leid und Schaden einander wollen zufügen,
noch einheimisches und fremdes Volk wollen durchziehen lassen, damit
wir, als getreue, liebe Nachbarn, mit einander handeln und wandeln,
auch unsere Häuser, Höfe, Hab und Gut, Weib und Kinder in
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 304 - arpa Themen Projekte
Propagandablatt der Herren gegen die Bauern
Nach einem zeitgenössischen Einzelholzschnitt in der Landesbibliothek
in Bern.
(Identisch mit einem Zusatzblatt zu: Cysat-Wagenmann, Brevis
Retatio Discordiae, Motus et Belli ab Rusticis, aliisque Subditis
contra suos Magistratus in Helvetia.)
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 304 - arpa Themen Projekte
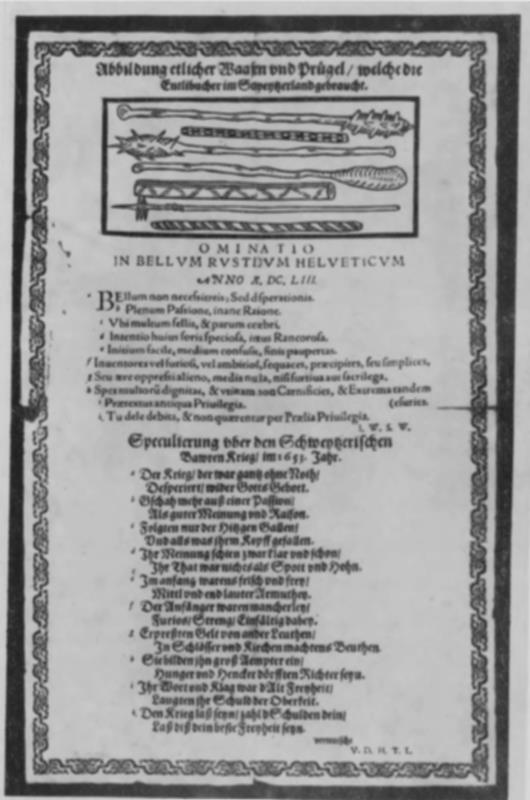
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 305 - arpa Themen Projekte
gutem friedlichem Wohlstand erhalten können. Und weil wir im Bernergebiet
oft Willens gewesen, unsere GH Herren und Obern zu bitten,
dass sie unsere Beschwerden uns nachlassen und abthun sollen, wie
denn vor Jahren im Thuner Krieg unser alter Spann auch dergleichen
hätten vereinbart sein sollen, aber schlechtlich gehalten worden, darum
haben wir abermal Gesandte vor unsere Gnädigen Herren gen Bern
geschickt, und sie unterthänig und hoch gebeten, sie sollen unsere
Beschwerden ab uns nehmen; darüber aber sie unsere Gesandten gezwungen,
dass sie in unser aller Namen haben müssen auf die Knie
fallen und um Gnade bitten und annehmen, und haben hernach dasselbige
doch nicht gehalten, was sie unsern Gesandten versprochen
haben. Darum haben wir Ursache genommen, uns in allweg zu versehen,
ist derowegen auf den 13. (23.) April im obgesetzten 1653. Jahr
zu Sumiswald eine Landsgemeinde gehalten worden wegen unserer
Klagartikel und des unguten Mandats willen, welches unsere Ehr und
guten Namen antreffen thäte, daran uns nicht wenig gelegen.
Darum wir, aus der Herrschaft Bern, Luzern, Solothurn und Basel
Gebiet, und aus hienach genannten Orten, zusammengekommen sind
wegen der Beschwerden und sonderbaren Ursachen halber, allda wir
uns freundlich ersprachet (besprochen), und darüber auf freiem Felde
einen ewigen, steifen, Staten und festen Eid und Bund zu dem wahren
und ewigen Gott zusammengeschworen haben, diese nachkommenden
Artikel treulich zu halten, wie folgt:
Im Namen der hochheiligen Dreifaltigkeit, Gott Vater's, Sohn's,
und hl. Geistes, Amen
so haben wir zusammengeschworen und zwar:
1. In diesem ersten Artikel,. dass wir den ersten Eidgenössischen
Bund, vor etlichen hundert Jahren zusammengeschworen, wollen haben
und erhalten, die Ungerechtigkeit einander helfen abthun und die
Gerechtigkeit äufnen; und alles, was den Herrn und Oberkeiten gehört,
soll ihnen bleiben und gegeben werden, und was den Bauern
und Unterthanen gehört, soll uns auch bleiben und gegeben werden.
Hiebei wollen wir einander schützen und schirmen mit Leib, Hab,
Gut und Blut; dress zu allerseits der Religion unschädlich und unvorgreiflich.
2. Wollen wir helfen einander, alle unguten neuen Aufsätze abschaffen,
und sollen aber jedes Orts Unterthanen ihre Gerechtigkeiten
von ihrer Obrigkeit selbst fordern. Wenn sie aber einen Streit gegen
ihre Obrigkeit bekommen möchten, sollen sie doch nicht ausziehen
ohne Wissen und Willen der andern Bundesgenossen, dass man vorher
sehen könne, welche Parther Recht oder Unrecht habe. Haben
unsere Bundesgenossen dann Recht, so wollen wir ihnen dazu verhelfen;
haben sie Unrecht, so wollen wir sie ab- und zur Ruhe weisen.
3. Wenn die Obrigkeiten wollten fremde oder einheimische Völker
uns Unterthanen auf den Hals legen oder richten, so wollen wir
dieselbigen gar nicht dulden, sondern, wo es vonnöthen, wollen wir einander
helfen, sie zurückweisen, und einander tröstlich und männiglich
beispringen.
4. Wenn auch die eint oder andere Person in Städten oder Landen,
durch dieses aufgelaufenen Handels willen, von einer Herrschaft
oder andern Leuten eingezogen, oder an Leib und Leben und Gut geschädigt
würde, sollen alle Bundsgenossen denselben helfen mit Leib,
Hab, Gut und Blut erledigen, als wenn es einem jeden antreffen thäte.
5. So soll dieser unser geschworene Eid und Bund alle zehn Jahre
vorgelesen und erneuert werden von den Bundsgenossen, und so dann
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 306 - arpa Themen Projekte
anderes, hätte, so will man allzeit demselben zum Rechten helfen, damit
unsern Nachkommen keine Neuerungen und ungebührliche Beschwerden
mehr aufgeladen werden können.
6. Soll auch keiner unter uns so frech und vermessen sein, der
wider diesen Bundschwur reden solle, oder Rath noch That geben
wolle, weder davon zu stehen und zu nichten zu machen. Welcher
aber dieses übersehen würde, soll ein solcher für einen meineidigen,
treulosen Mann gehalten, und nach seinem Verdienen abgestraft
werden.
7. Es sollen auch keines Orts Bundsgenossen mit ihrer Obrigkeit
diesen Handel völlig vergleichen und beschliessen, bis die andern unsere
Bundsgenossen auch an allen Orten den Beschluss machen können,
also dass zu allen Theilen und gleich mit einander der Beschluss
und Frieden solle gemacht werden.
Folgen nun die Orte und Vogteien, so in diesem Bundbrief begriffen
sind und geschworen haben. Aus der Herrschaft Luzern: Allererst
das Land Entlebuch, sammt den IX übrigen Aemtern, welche zu
Wollhausen geschworen haben. —Aus der Herrschaft Bern: Die Vogtei
Trachselwald, —Brandis, —Sumiswald, —Hutwyl, —das ganze Land
Emmenthal, —Signau, —die Landschaft und das Freigericht Steffisburg,
—Hilfterfingen, — Hans Büeler zu Sigriswil für sich und seine
Nachkommen, —die Vogtei Interlaken und Brienz, —Frutigen, —das
Landgericht Sternenberg, — Zollikofen, Konolfingen, Seftigen, — die
Grafschaft Nidau, Büren, — die Vogteien Fraubrunnen, Aarberg,
Landshut —die Grafschaft Burgdorf, ausgenommen die Stadt, —Stadt
und Amt Aarburg, —die Vogteien Wangen, Aarwangen und Bipp, —
Stadt und Grafschaft Lenzburg, —nebst der Vogtei Schenkenberg. —
Aus der Herrschaft Solothurn: die Grafschaft Gösgen, — Stadt und
Amt Olten, — die Vogteien Bechburg, Falkenstein, Kriegstetten, Flumenthal,
Leberen, Bucheggberg, Dorneck, Thierstein und Gilgenberg.
—Aus der Herrschaft Basel: die Stadt Liestal sammt ihren Dörfern, —
die Grafschaft Farnsburg, —die Vogtei Waldenburg, Homburg und
Ramstein. —Die freien Aemter, die Vogteien unter den alten Orten der
Eidgenossenschaft.»
Dies also, war die definitive Basis, welche durch die zähe und ausdauernde
Werbearbeit der Entlebucher und der Willisauer für den
neuen, grösseren Bund erkämpft worden war, der nun an Stelle des
Wolhuser Bundes trat. Zwar ist der Wortlaut des Bundesbriefs, wie er
hier —nach Vock —wiedergegeben ist, erst durch einige Bereinigungen
auf der nachfolgenden Huttwiler Landsgemeinde in diese endgültige
Form gebracht worden. Was jedoch in Sumiswald beschworen
wurde, war in allem Wesentlichen bereits genau dasselbe. Was die
geographische Ausbreitung der in den Unterschriften auf dem Sumiswalder
Brief erscheinenden Aemter, Vogteien, Landgerichts und Ortschaften
betrifft, so umschreibt auch sie im Wesentlichen bereits die
endgültige Ausbreitung des Bundes durch vier Kantone und die Freien
Aemter. Er ist in der Folge nur noch durch unbedeutende Zunahmen
ergänzt worden, meist nur noch durch vollständigere Erfassung
der hier bereits durch Ausschüsse vertretenen Landesteile. So waren
beispielsweise die Freien Aemter nur durch ihren oberen Teil, die Aemter
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 307 - arpa Themen Projekte
Erfolg der Sumiswalder Landsgemeinde revolutionierte auch den unteren
Teil endgültig, sodass dessen Aemter insgesamt den Bund dann
in Huttwil begeistert mitbeschworen. Aehnliches gilt von Stadt und
Grafschaft Lenzburg.
«Nach Verlesung des Bundesbriefs» — so berichtet Tillier —
«sprach Leuenberger die Worte der Eidesformel laut vor; die Versammlung
wiederholte sie, und der Bund wurde geschworen.» Und zwar
wurde, wie Heusler berichtet, «weil ein Gelübde nicht genüge, mit gebogenem
Knie und aufgehobenem Finger der Eid geleistet». Man kann
sich den religiösen Ernst und die tiefe Erschütterung leicht vorstellen,
womit Leuenberger die Formel dieses neuen Eides versprach und beschwor,
der seinem zu Beginn des Monats in Bern geschworenen Eid
so schnurstracks zuwiderlief.
Der Eindruck der Persönlichkeit Niklaus Leuenbergers auf alle
tausend Hergesandte muss wohl eben deswegen ein gewaltiger gewesen
sein. Denn unmittelbar nach dem Schwur wurde dieser bislang allen
Nichtbernern völlig unbekannte Mann, der nicht bei einer einzigen
Vorberatung des neuen Bundes anwesend gewesen war, einmütig zum
«Obmann» des Bundes gewählt. Dies geschah nicht, wie manche Geschichtschreiber
es darstellen, erst in Huttwil, sondern bereits hier in
Sumiswald: das beweisen die zahlreichen Aktionen, denen Leuenberger
sich nun sofort und mit restloser Hingabe widmete und die er nur als
bestellter Bundesführer durchführen konnte. Mit Recht, und mit berechtigtem
Stolz, haben deshalb spätere Sumiswalder zum Gedächtnis
dieses Ereignisses einen Gedenkstein in ihre Kirchhofmauer eingelassen,
der dort, wo man auf der Hauptstrasse vom Tal heraufkommend das
Dorf betritt, jeden mit der Inschrift begrüsst: «Klaus Leuenberger
wurde in Sumiswald zum Obmann des Bauernbundes gewählt
23. April 1653.»
Was aber die Entschlossenheit der Landsgemeinde zu Sumiswald
ganz besonders beweist und was ihr auch abgesehen von Bundesbrief
und Bundesschwur höchsten geschichtlichen Rang verleiht, das sind
die ebenfalls bereits dort gefassten Beschlüsse über die «Konstituierung
eines Kriegsrates», sowie über «die Verteilung der von den Angehörigen
des Bundes aufzubringenden Kriegsmacht». Ueber diese Verteilung der
Kriegsleistungen auf die einzelnen aufständischen Gebiete besitzen wir
zwar keine Dokumente mehr, und wir müssen sie in den Hauptlinien
aus den nachfolgenden Ereignissen selbst erschliessen. Ueber das Ergebnis
der Wahlen zum Kriegsrat aber sind wir bis zu den einzelnen Namen
schon deshalb genauer unterrichtet, weil die Zugehörigkeit zum Kriegsrat
bei den späteren Aburteilungen der «Rädelsführer» des Aufstandes
in jedem einzelnen Fall ein sehr strafverschärfendes Argument bildete
und vielen der Besten den Kopf gekostet hat.
Etwa an die hundert «Kriegsräte» haben schliesslich den Kriegsrat
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 308 - arpa Themen Projekte
sicher bei weitem nicht alle bereits in Sumiswald gewählt; vielmehr
steht es fest, dass viele von ihnen erst im Lauf der Ereignisse ad Hec
und in Rücksicht auf lokale Bedürfnisse und Eitelkeiten nachträglich
hinzugewählt wurden, sodass schliesslich allzuviele Köche den Brei
verdarben So gelangten beispielsweise allein im bernischen Sektor ihrer
dreizehn erst während der Belagerung von Bern in den Kriegsrat, der
bereits vorher an die 60 Berner umfasste. Luzerner waren verhältnismässig
viel weniger, nicht mehr als 20, im Kriegsrat. Dafür aber stellten
sie die gesamte Oberleitung desselben (mit Ausnahme eines Solothurners).
Als «General-Oberster» nämlich wurde in Sumiswald der
Entlebucher Pannermeister Hans Emmenegger bezeichnet, womit man
offensichtlich den gerechten Ausgleich zu der Wahl des Berners Leuenberger
zum Obmann des Bundes herstellen wollte. Als «Oberst-Wachtmeister'
stellte man Emmenegger Stephan Bislig aus Ruswil zur
Seite, als «Obersten» den Fridolin Bucher, jetzt Richter und Landesseckelmeister
des Amtes Willisau. Wohl mehr aus propagandistischer
Rücksicht auf die Beteiligung Solothurns am Aufstand setzte man den
sonst nirgends hervortretenden Solothurner Hauptmann Urs Lack,
einen in fremden Kriegsdiensten erfahrenen Mann, zum Stellvertreter
Emmeneggers, als «Oberst-Lieutenant», ein. Daneben verfügte Emmenegger
über einen Stab von je zwei Kriegsräten der Aemter Entlebuch,
Willisau, Ruswil, Rothenburg, sowie von je einem aus den Aemtern
Malters, Triengen, Knutwil und dem Michelsamt. Auch in dieser gleichmässiger
und auf wenige Leute verteilten Verantwortung zeigt sich die
straffere und erfahrenere Organisation der an ein gewisses Mass von
Volksfreiheiten noch gewöhnten Luzerner. Aber, merkwürdig —keiner
der uns, aus den bisherigen Kämpfen so vertrauten Namen ist darunter,
nicht einmal der Kriegsmann Pat excellence Schybi! Auch Käspi Unternährer
nicht, der doch, wie wir aus einer Anwesendenliste der Sumiswalder
Landsgemeinde wissen, an dieser teilnahm.
«Aber', wie Liebenau mit Recht betont, «die Rechte und Kompetenzen
des General-Obersten wurden, so weit bis jetzt bekannt, nie
streng ausgeschieden. Dieser Dualismus hemmte unstreitig die Entwicklung
des Bauernbundes.» Eine Folge dieser Unklarheit mag es gewesen
sein, dass gerade von da an Hans Emmenegger im Bund merkwürdig
wenig öffentlich führend hervortritt und dass an seiner Stelle Leuenberger
— von einer fast mystischen Volkssympathie getragen — erstaunlich
schnell in die vorderste Linie, ja an die Spitze der Führung
des ganzen Aufstands rückt.
Als Folge davon wiederum gleitet auch der Kriegsrat unter die
Leitung Leuenbergers und wird zu einer überwiegend bernischen Angelegenheit.
Eben dies drückt sich in der Tatsache aus, dass die grosse
Mehrzahl seiner Mitglieder schliesslich Berner sind. Unter ihnen gehören
die drei alten Kämpfer aus dem «Thuner Handel», Uli Galli,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 309 - arpa Themen Projekte
der mutige «Schmied von Grosshöchstetten», zu den Hauptstützen —-
und Hauptantreibern — Leuenbergers, auch ohne besondere Titel.
Ebenso seine nahen Freunde Lienhart Glanz mann, der Wirt von Ranflüh,
und Daniel Ruch, der ihn nach Sumiswald gebracht hatte und
der erst im Feldlager vor Bern in den Kriegsrat eintrat. Mancher andere
unter den über 70 Kriegsräten Leuenbergers machte ihm nicht wenig
zu schaffen; so vor allem der tolle Heissporn Michel Aeschlimann, genannt
«der Bergmichel», ein Berner Schybi jugendlichen Alters. Und
schliesslich wurde der Notar Johann Konrad Brönner in Sumiswald
nicht nur zum Schreiber des neuen Bundes, sondern auch zum «Kriegsrats-Schreiber»
ernannt — und auch er drängt von da ab seinen Entlebucher
Kollegen, den Schulmeister Müller, den sonst so eifrig tätigen
«Ratsschreiber» des Wolhuser Bundes, von dem wir im Zusammenhang
mit Sumiswald überhaupt nichts hören, merkwürdig schnell in den
Hintergrund.
Wenn man die positiven Ergebnisse der Sumiswalder Landsgemeinde
überblickt, so staunt man nicht nur über den reichen Umfang
der dort an einem einzigen Tag erledigten Geschäfte, sondern auch
über die Tragweite und die fast systematisch zu nennende Planmässigkeit
derselben. Erstens gaben sich die Bauern hier nichts weniger als
ein neues Grundgesetz, eine von Kantons- und Religionszugehörigkeit
unabhängige, wenn auch noch sehr einfache und lückenhafte Verfassung,
samt einer bereits persönlich designierten Exekutive (dem Obmann).
Zweitens errichteten sie im Inhalt dieses Bundesbriefes eine
eigene Rechtsprechung samt eigener Rechtsexekutive, unabhängig von
jeder sowohl in den Einzelstaaten (Kantonen) wie in der Föderation
(Tagsatzung) geltenden Jurisdiktion, obschon auch dies nur in den
primitivsten Grundzügen. Drittens schufen sie eine eigene Heeresorganisation,
auch dies unabhängig von jeder anderen, in der Eidgenossenschaft
bereits bestehenden, und sie designierten auch bereits persönlich
einen Oberbefehlshaber samt einem ganzen Generalstab (Kriegsrat);
obzwar auch dieses, unter dem Druck einer zu raschem Handeln zwingenden
geschichtlichen Situation, ebenfalls in höchst primitiver und
provisorischer Weise.
Wir wollen hier nur im Vorübergehen darauf hinweisen, dass
solch erstaunlich umfassende positive Ergebnisse, die eine zum erstenmal
tagende Landsgemeinde von politisch weitgehend entrechteten
und darum unerfahrenen Bauern und Kleinbürgern an einem einzigen
Verhandlungstag unter Dach brachte, eine ganz ausserordentlich
gründliche und gewissenhafte Vorarbeit voraussetzt. Wer sie geleistet
hat, ist niemals gründlich untersucht worden und ist — wenn nicht
etwa glückliche Aktenfunde sich einstellen —über das bereits Berichtete
hinaus vielleicht niemals im Einzelnen nachzuweisen; und dies
zwar hauptsächlich deshalb, weil wohl alle wirklichen Urheber dem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 310 - arpa Themen Projekte
Elend verschollen sind, das keine schriftliche oder auch nur mündliche
Kunde mehr zuliess, da solche fortan stets mit Lebensgefahr verbunden
war. Und die Herrenchronisten der Zeit wären die letzten gewesen,
aus Wahrheitseifer nach solcher Kunde zu fahnden, viel eher die
ersten, einen aufgespürten Urheber und Mitwisser an den Galgen zu
liefern.
Die Beschlüsse der Sumiswalder Landsgemeinde — und sinngemäss
auch die der nachfolgenden beiden Landsgemeinden zu Huttwil
— werden jedoch grundsätzlich dadurch gewiss nicht weniger wichtig,
weil ihre Urheber und Verfechter kurz hernach unters Rad der Geschichte
kamen und daher keine Gelegenheit mehr hatten, die grossartigen
Entwicklungskeime auszureifen, die sie in der Sumiswalder
Verfassung und Organisation ihrer Sache gegeben hatten. Und doch
scheinen unsere sämtlichen Schweizergeschichtschreiber, fast ohne
Ausnahme, gerade dieser Meinung zu sein. Einzig Dändliker fasste —
ohne näher darauf einzugehen — die Sumiswalder Landsgemeinde als
so etwas wie das erste schweizerische Volksparlament auf. Jawohl, das
war sie. Und zwar als solche etwas, wie es dies auch in der ganzen,
von den Bauern selbst stets rückblickend als Vorbild und Rechtfertigung
beschworenen Ur-Eidgenossenschaft nicht gab! Auch das Stanserverkommnis,
auf das sich die Bauern mit Vorliebe beriefen, ist ja
nichts als das Produkt eines Herrenparlaments (das noch dazu gerade
die Landsgemeinde-Bauern der Urschweiz mittels des «heiligen» Niklaus
von der Flüe zugunsten der Städte-Aristokratie hereinlegte).
Aber die drei oben hervorgehobenen Hauptbeschlüsse der Sumiswalder
Landsgemeinde machen aus dieser grundsätzlich noch bedeutend
mehr. Sie stellen im Prinzip nichts weniger als den ersten Geburtskeim
eines neuen, einheitlichen Staatswesens dar: es sind die
Grundgeschäfte einer konstituierenden Nationalversammlung! Und
zwar zeigen diese Beschlüsse die Grundzüge eines Staatswesens von
besonderer, in der Schweizergeschichte durchaus einmaliger Art: eines
bäuerlichen Klassenstaats, der sich aus allen Fesseln der damaligen
Staats-, Rechts- und Religionsgrenzen heraus — gewissermassen unter
ihnen hindurch — ans Licht ringen will. Und sowohl die im Bundesbrief
erstrebte Rechtsordnung wie die in Sumiswald faktisch aufgerichtete
Heeresorganisation sind hundertprozentige, naiv offen als
solche bekannte Instrumente des Klassenkampfs der Bauern gegen ihre
Herren. So naiv rückschrittlich die ständige Berufung der Bauern auf
einmal, weit hinten in der Geschichte, gehabte (und oft nur vermeintlich
gehabte!) spezifisch bäuerliche Klassenrechte auch ist —- so revolutionär
ist ihr ganzes Vorgehen, ist die Vorbereitung und die Durchführung
der Sumiswalder Beschlüsse! So revolutionär ist vor allem
auch die Gesinnung der Urheber dieser Beschlüsse, die sie hiess, die
Vorkämpfer für die Freiheitsrechte des ganzen Volkes zu sein, was
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 311 - arpa Themen Projekte
Sumiswald vorhergegangenen Propaganda —selber als «Volksbund»
gegen den «Herrenbund» bezeichneten. Wenn irgendwo, so kommt
darin der revolutionierende Einfluss der entrechteten Bürger, besonders
der Willisauer, zum Ausdruck, die von den Bauern in ihren Bund
aufgenommen worden waren.
Wie immer bei Umwälzungen, die sich auf die Geschichte berufen,
war zwar wohl, das Bewusstsein der Schweizer Bauern von 1653 an
Dinge der Vergangenheit gefesselt und wurde dadurch immer aufs
neue unheilvoll von der Gegenwart abgelenkt. Dennoch war der instinkt,
der sie zur Umwälzung der bestehenden Ordnung trieb, von den
realen Nöten der Gegenwart, d. h. von den Folgen dieser Ordnung,
inspiriert und aufgepeitscht, und dieser Instinkt trieb sie auch gegen
ihr Bewusstsein zu einer neuen Ordnung, zu neuen Rechten und Gesetzen.
«Die Bauern... errichteten in Sumiswald am 23. April eine
neue Eidgenossenschaft», wie wiederum als beinahe Einziger Carl
Hilty mit Nachdruck hervorhebt. Wir dürfen nicht die subjektive
Täuschung der Bauern, ihre eigene, rückschrittliche Geschichtsillusion,
zur objektiven Ursache dieser Revolution machen, wie es beispielsweise
Bögli —stellvertretend für jeden andern unserer Herrenchronisten
—tut, wenn er schreibt: «Man sieht aus dem angeführten Bundesbrief,
dass die Bauern sich als die Vertreter der Stände und Inhaber
der Souveränität betrachteten, da sie die Bestimmungen der alten eidgenössischen
Bünde und des Stanserverkommnisses zu erneuern und
zu bestätigen erklärten.» Das ist Aktenweisheit, die über die historische
Wirklichkeit der Schweizer Bauern von 1653 blind hinwegschreitet.
Nur wenn man sich den von Bögli —im Gegensatz zu andern Geschichtschreibern
—wenigstens ahnungsweise richtig herausgefühlten
Willen der Bauern, «Vertreter der Stände» und «Inhaber der Souveränität»
zu werden, in die historische Realität der damaligen Eidgenossenschaft
wirklich eingedrungen denkt, wenn man sich gar vorstellt,
diesem Willen wäre der militärische Sieg zugefallen: dann erst erkennt
man seinen objektiv revolutionären Charakter, der ganz unabhängig
von dem historisch-rückschrittlichen Bewusstsein der Bauern ist. Dann
nämlich wäre es wohl unausbleiblich gewesen,. dass auf der Woge
eines solchen Sieges sämtliche unterdrückten Burgerschaften der
Schweizerstädte, unter denen es ständig rumorte, insbesondere die der
Hauptstädte Zürich, Basel, Bern und Luzern, sich gegen die absolutistische
Oligarchie der «regierungsfähigen» Familien, d. h. gegen die
Willkürherrschaft und Privilegienwirtschaft einer winzigen aristokratischen
Minderheit, erhoben hätte. Wäre aber einmal die Bürgerschaft
durch einen Sieg der Bauern zur Entscheidung für die Revolution gedrängt
worden, dann hätten die Bürger die Führung der Bauern übernommen,
und sie hätten sich bestimmt weniger auf Briefe und Siegel
der alten Eidgenossenschaft (deren Gründer sie ja nicht waren), als
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 312 - arpa Themen Projekte
und sein Parlament, berufen. Damit wäre der Anschluss der Schweiz
an die progressive Menschheit jener Zeit vollzogen gewesen — und die
Bürger hätten die Bauern aus ihrem Traum der Vergangenheit mit auf
die Bahn der Zukunft gerissen, wie Cromwell es zur selben Zeit wirklich
tat und wie es die Schweizerbürger schliesslich, wenn auch erst
150 bis 200 Jahre später, ebenfalls tun mussten. Dann allerdings ohne
noch eine überhaupt revolutionäre Bauernschaft vorzufinden...
Erst eine solche Eingliederung in die Entwicklungsmöglichkeiten
der Klassenlage des ganzen Zeitalters macht die geschichtliche Bedeutung
des Sumiswalder Bundes und des schweizerischen Bauernkriegs
überhaupt in ihrem vollen Umfang klar. Diese Erhebung der Bauernklasse
enthüllt sich im Lichte des Klassenkampfes in der Tat als eine
Vorstufe zur allgemeinen bürgerlichen Revolution, die auf den Sturz des
gesamten aristokratisch-absolutistischen Systems hinzielte.
Selbstverständlich blieben die Bauern, solange sie im wesentlichen
auf sich selbst angewiesen waren, auf ihre spezifisch bäuerlichen Mittel
beschränkt: auf das Ausspielen des uralten Gegensatzes von Stadt
und Land, auf historische Erinnerungen an ihre, auf einer früheren
Entwicklungsstufe der menschlichen Gesellschaft gespielte ausschlaggebende
Rolle, auf Vieh- und Fruchtsperren gegenüber den Städten,
auf Steuer- und Zinsstreiks, und auf allerlei andere lokale Forderungen
und Verweigerungen, und diese vorwiegend defensiven Mittel des
Kampfes blieben —leider —auch im neuen Bunde grundlegend. Aber
bereits die Beteiligung der unterdrückten Burgerschaften der Kleinstädte
Willisau, Olten, Lenzburg, Aarburg und Liestal veranlasste die
Bauern, ihren Bund zum allgemeinen Volksbund zu proklamieren.
Dies hatte zwangsläufig zur Folge, dass der Bund zur richterlichen
Oberinstanz für alle Streitigkeiten seiner Glieder nicht nur untereinander,
sondern auch mit ihren verschiedenen Regierungen ausgestaltet
werden musste. Eine weitere Zwangsfolge war die Organisierung und
Zentralisierung einer gemeinsamen Militärmacht, so keim- und bruchstückhaft
sowohl diese wie die Rechtsorganisation vorläufig auch in
Erscheinung treten mochten.
Der Eintritt der paar —auch in ihrem Wesen stark bäuerlich gebliebenen
— Landstädte konnte jedoch den bäuerlichen Klassencharakter
des ganzen Bundes nicht wesentlich verschieben. Dazu waren
ihre progressiv bürgerlichen Kräfte im Verhältnis zu der grossen konservativen
Bauernmasse zu gering; sie mussten sich vielmehr dieser
einfügen und konnten innerhalb derselben lediglich als Sauerteig wirken,
der die Organisationskraft steigerte, aber immer noch nur in dem
Sinne der Steigerung der Schlagkraft im Kampf für das spezifische
Klasseninteresse der Bauern.
Nun muss man sich aber vorstellen, was aus dem Bund geworden
wäre, wenn sich nicht nur ein relativ —wirtschaftlich und allgemein
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 313 - arpa Themen Projekte
die Bewohner der paar ländlichen Kleinstädte sich an ihm beteiligt
hätte: wenn vielmehr die in den Zunftfesseln der Obrigkeiten sich windenden
Produktivkräfte des Kaufmanns-, Handwerks- und stellenweise
bereits Manufaktur-Bürgertums der grossen Hauptstädte des Landes
unter dem Eindruck auch nur eines ersten Sieges des Volksbundes
über den Herrenbund ihre Fesseln gesprengt und mit voller Kraft auf
die Seite des Volksbundes getreten wären! Dann nämlich wäre das
bürgerliche Element durch das Eigengewicht seiner grösseren wirtschaftlichen
Bedeutung, seiner grösseren Welterfahrung, seiner höheren
Bildung und der aus alledem erfliessenden tieferen Einsicht in die
zeitgenössischen Weltzusammenhänge, notwendig führend geworden
in diesem Bund; ja, der Bund selbst, samt seiner bäuerlichen Massengrundlage,
wäre zu dem entscheidenden Kampfinstrument der bürgerlichen
Klasse für ihre Rechte und Freiheiten geworden, an denen die
der Bauern natürlich beteiligt, in die sie mit eingeschlossen worden
wären, wie dies fast zweihundert Jahre später endlich geschah.
Jedoch gerade die geschichtliche Tatsache, dass das unterdrückte
Bürgertum der Hauptstädte nicht in den grossen Kampf eingriff, sondern
sich mit den Herren nur um die Beteiligung an deren lokalen
Privilegien stritt, beweist eindeutig, dass auch das Bürgertum der
Hauptstädte —nicht nur dasjenige der kleinen Landstädte —in seiner
wirtschaftlichen wie in seiner kulturellen Entwicklung noch zu rückständig
war, um ein genügend klares politisches Bewusstsein von seiner
Rolle in der Geschichte entwickeln können. Dies ganz im Gegensatz
zum englischen Bürgertum der gleichen Epoche, dessen Produktivkraft
und damit sein politisches Bewusstsein durch die aktive Teilnahme
am neuerschlossenen Ueberseehandel revolutionär entwickelt
wurden. Dennoch können wir es als tragisch für die gesamtschweizerische
politische und kulturelle Entwicklung empfinden, dass die Kraftentfaltung
des Sumiswalder Bundes nicht bis zur Entfesselung des
damals allüberall in der Schweiz wenigstens lokal gärenden Bürgertums
der Hauptstädte gelang.
Das zeigen die geschichtlichen Folgen der brutalen Niederschlagung
dieses Bundes: als anno 1798, infolge der Französischen Revolution und
ausgelöst durch die napoleonische Invasion, nicht aus eigener Kraft,
das schweizerische Bürgertum der Hauptstädte sich erhob, um die verrotteten
Fesseln der feudalen Zunftwirtschaft der aristokratischen Obrigkeiten
endlich abzuwerfen —da gab es in der Schweiz keine überhaupt
noch organisierbare, geschweige revolutionierbare Bauernklasse
mehr: ihr war durch die Vernichtung des Sumiswalder Rundes das geschichtlich-politische
Rückgrat für immer zerbrochen worden! Sie
tauchte vielmehr, wenn auch nur in ihren traurigsten Teilen, auf der
Seite der schwärzesten aristokratischen Reaktion wieder auf, die den
stinkenden Leichnam ihrer an innerer Fäulnis zusammengebrochenen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 314 - arpa Themen Projekte
und in der Schlacht bei Zürich mit Hülfe ausländischer Fürsten,
Pfaffen, Gelder und Truppen wiederaufzurichten versuchte. Die
ganze Helvetik, ein Versuch des Schweizer Bürgertums, seine immerhin
kühne und progressive Revolution auch seinerseits auf fremden Bajonetten
aufzurichten, ist an der sturen Verweigerung des Schweizer
Bauerntums gescheitert, in dem jeder Funke des stolzen Rebellengeistes
des Sumiswalder und Huttwiler Bundes längst in den Staub getreten
war. Und erst nach vielen inneren Kämpfen und Gewittern gelang
es 1847 dem schweizerischen Bürgertum, seine durchschlagende
Revolution, den Sonderbundskrieg, mit erfrischender Unbedenklichkeit
vom Zaun zu reissen —und auch dabei war es wiederum nur gegen
den sturen Widerstand wenigstens eines Teils des schweizerischen Bauernturns,
nämlich desjenigen gerade der Urschweiz, möglich, endlich
dem Fortschritt in unserem Lande freie Bahn zu schaffen, der dann
auch dem Bauerntum wieder einen menschlichen Aufschwung ermöglichte,
wenn auch seine selbständige geschichtliche Bedeutung ausgespielt
war...
Im Lichte der hier nur angedeuteten geschichtlichen Folgen der
Niederschlagung des Bauernaufstandes vom Jahre 1653 — durch die
der Sumiswalder Bund bereits in der Wiege erstickt wurde —, nehmen
sich die Beurteilungen der geschichtlichen Bedeutung dieses Bundes
seitens unserer modernen Herrenchronisten höchst merkwürdig aus.
Alle unsere Geschichtschreiber des Bauernkriegs nämlich — mit einer
einzigen Ausnahme, die wir gesondert behandeln müssen — werfen
dem Sumiswalder (bezw. Huttwiler) Bund unisono vor: ihm habe jede
«staatsrechtlich» in die Zukunft weisende Bedeutung gefehlt; und dies
zwar deshalb, weil die Bauern darin, wie Bögli formuliert, «nicht auf
das einfache Mittel verfielen, für sich selbst einen verfassungsmässigen
Anteil an der Regierung anzustreben». Auch Dierauer wirft ihnen ja
vor, dass sie in diesem Bund nicht den Versuch gemacht hätten, «sich
einen Anteil an der Ausübung der obrigkeitlichen Gewalt zu sichern».
G. J. Peter treibt das Argument auf die Spitze, in dem er fettgedruckt
schreibt: «Dem grossen Bauernbund mangelt gänzlich, was ein produktives
Ergebnis hätte zeitigen können: Das Postulat der politischen
Gleichberechtigung der ländlichen Bevölkerung mit der aristokratischen
der Städte»! Das klingt erzdemokratisch und scheint «staatsrechtlich»
sehr fortschrittlich im Sinne der späteren, radikal-demokratischen
Eidgenossenschaft —ist aber trotzdem nichts als barer Unsinn.
Was allerdings nicht verhinderte, dass er auch von den nachfolgenden
Bearbeitern des Stoffs immer aufs neue abgeschrieben wurde. Wie —
Absolutismus und Demokratie, Feuer und Wasser, Wölfe und Schafe,
Ausbeuter und Ausgebeutete.. . sollten zusammen kutschieren? Das
ist echte Herrenweisheit; denn wer dabei den Kürzeren zöge, ist ja
nicht zweifelhaft.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 315 - arpa Themen Projekte
Da loben wir uns den aufrechten Instinkt der Bauern von 1653:
für sie, die Ausgebeuteten und bis aufs Blut Gepeinigten, gab es gar
keine Gemeinschaft mit ihren Ausbeutern und Peinigern —sie konnten
also einen «Anteil» an dieser Regierung, an diesem Staate ehrlicherweise
überhaupt nicht ins Auge fassen! Für sie gab es nur eine Möglichkeit:
dieser Staat musste weichen, gänzlich. Was sie an seine Stelle setzen
wollten, das konnte, solange sie auf sich allein gestellt waren — d. h.
solange kein progressives Bürgertum da war, das sie in eine neue Demokratie
hätte führen können —, gar nichts anderes sein, als die alte,
primitive Demokratie der Bauernfreiheit, auf der die echte alte Eidgenossenschaft
gegründet war und auf die sich die Bauern daher im
Artikel 1 ihres Bundesbriefes mit Recht berufen.
Vielleicht noch peinlicher berührt ein anderes, auch von den Demokraten
unter den Geschichtschreibern des Bauernkriegs stereotyp
wiederholtes Argument gegen den Bund der Bauern von 1653; ein Argument,
das sie den Herren von 1653 selber immer aufs neue gedankenlos
nachschreiben. Es läuft darauf hinaus, dass man um Gotteswillen
den bestehenden Staat —gleichgültig welchen —nicht angreifen soll!
G. J. Peter z. B. wirft dem Sumiswalder Bund, der die Demokratie der
Bauern der Aristokratie der Herren entgegenstellte, direkt vor, dass er
«eine mittelalterliche Auffassung» des Staats «der Idee vom kräftigen
modernen (!) Staat» entgegenstelle, «indem er auf eine Schwächung
der Staatsgewalt ausgeht». «Ja», so fährt Peter fort, «der Bauernbund
verfolgte mit seiner Verweigerung der Steuerzahlung und der Heeresfolge
entschieden anarchische Tendenzen und eben dadurch» (mithin
wegen mangelnder Subordination unter die Willkür einer rechtlosen
totalitären Gewaltherrschaft!) «benahm er sich selbst Lebensfähigkeit
und Existenzberechtigung»! Faschistischer kann man gar nicht mehr
sein als dieser «gute Demokrat», obschon G. J. Peter dies bereits im
Jahre 1909 publiziert hat. Der noch bessere «Demokrat» Johannes
Dierauer wiederholt in seiner Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft
(IV. Band, 1912) dieses Argument unbedenklich, indem
er, unter ausdrücklicher Berufung auf diese Stelle bei Peter, gegen die
Verfasser des Sumiswalder Bundesbriefes schreibt: «Sie bedachten nicht,
dass, wie sie ihre Föderation als kontrollierende Instanz dem ,Herrenbund'
zur Seite stellten, die Staatsgewalt gelähmt und untergraben
werden musste»; ja, Dierauer identifiziert die «nationalen Interessen»
und das «eidgenössische Wesen» derart mit der «Staatsgewalt» der
absolutistischen Herren von 1653, dass er unmittelbar fortfahren kann:
«... und dass ihr Vorgehen überhaupt den nationalen Interessen, dem
eidgenössischen Wesen zuwiderlief»! Da hätten die Bauern von 1653
sich allerdings nicht auf die alten Schweizerbunde berufen dürfen —
die waren ja bekanntlich von Aristokraten vom Kaliber Wasers und
Wettsteins, Werdmüller und Erlachs, oder auch des «alten Raubgeiers»
Fleckenstein gemacht! Und überhaupt: wie wäre die alte Eidgenossenschaft
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 316 - arpa Themen Projekte
der Habsburger?... Ueberhaupt hätten die Bauern von 1653
eben auf der Ofenbank sitzen bleiben sollen, wenn sie sich nicht just
ihrer «Pflicht» hingaben, aus ihrem Hunger die Zinsen für die Gülten
dieser Herren herauszuschinden, um deren «moderne Staatsgewalt» zu
starken... Sie hätten damit den «demokratischen» Herrenchronisten
des 20. Jahrhunderts die Mühe erspart, ihrem «staatsrechtlich» zermarterten
Gehirn so ungereimtes Zeug — von ein- und denselben Herren
im gleichen Atemzug behauptetes Zeug —über den Sumiswalder
Bund abpressen zu müssen wie dies: dieser Bund sei zu wenig demokratisch
im Sinne einer «Beteiligung» an der (aristokratischen) Regierung
von damals, mithin zu reaktionär in Bezug auf die spätere bürgerliche
Revolution, gewesen —zugleich aber sei er zu revolutionär in
Bezug auf die damalige absolutistische «Staatsgewalt» gewesen, indem
er «rein destruktiv» (sagt Peter) «die Staatsgewalt gelähmt und untergraben»
habe (sagt Dierauer Peter nach). Wobei nicht vergessen werden
darf, dass die ganze Staatsgewalt von damals, bei ihrer antidemokratischen
Strenge und Unbedingtheit, hätte in die Luft gehen müssen,
wenn auch nur der geringste Fortschritt im Sinne der Demokratie
überhaupt hätte erzielt werden sollen. Was dann den «nationalen
Interessen« und dem «eidgenössischen Wesen» fraglos förderlicher
gewesen wäre als die 155 Jahre absolutistischer Pestilenz, die nun
folgten und dem Schweizer Volk das Mark aus den Knochen
sogen...
Ausserdem aber gab es in diesem Sumiswalder Bund, besonders
in der Tatsache seiner überkantonalen und überkonfessionellen Organisation,
Elemente, die trotz der rückschauenden Ideologie der Bauern
faktisch höchst fortschrittlich waren. Gerade diese Elemente haben
nicht die (angeblichen) Erz demokraten unter den Bauernkriegs-Chronisten
entdeckt —sie haben vorgezogen, vom hohen Ross ihrer «staatsrechtlichen»
Bildung herab dieses urlebendige Stück schweizerischen
Volksleben formal juristisch und rechtsgeschichtlich (und dies noch
verkehrt) in Grund und Boden zu stechen. Kein Wunder — sind es
doch diese selben «Demokraten», die die erzreaktionäre Rolle der
späteren, erbarmungswürdig heruntergekommenen Bauern bei Neuenegg,
im Grauholz und in Nidwalden zum unantastbaren «nationalen
Heiligtum» erhoben haben!
Nein, die progressiv-revolutionären Elemente im Sumiswalder
Bund entdeckte einzig und allein der katholisch-konservative Erzreaktionär
Theodor von Liebenau. Nicht aus Sympathie und Liebe, versteht
sich, und noch weniger aus tieferer Erkenntnis der Klassenbedingtheit
der Geschichte; wohl aber aus einem richtigen Klasseninstinkt, der ihm
die Gefahr beim Gegner richtig anzeigt. Im Spiegel dieses eindeutig antidemokratischen
Klasseninstinktes —mithin nur sehr getrübt (denn Instinkt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 317 - arpa Themen Projekte
nämlich negativ bewertet — spiegeln sich wenigstens
ahnungsweise die Umrisse einer grossen Wahrheit über den urdemokratischen
Sumiswalder Bund; einer Wahrheit die wir nicht zufällig
an den Schluss dieser Auseinandersetzung über seine geschichtliche
Bedeutung stellen.
Liebenaus Herz hing ganz und gar an der aristokratischen Herren-Eidgenossenschaft,
wie sie das Stanserverkommnis begründete, gegen
die sich die Bauern von 1653 erhoben hatten und die durch die Niederwerfung
dieser Bauern derart in «Blüte» kann, dass sie ihre absolutistische
Unterdrückungspolitik, fortan von keinem Volksrecht mehr geschmälert,
bis ins Jahr 1798 fortsetzen konnte. Diese «alte» Eidgenossenschaft
meint Herr von Liebenau, wenn er im übrigen völlig richtig
schreibt: «Wäre der in Sumiswald geschworene Bund lebensfähig geworden,
so hätte die alte schweizerische Eidgenossenschaft ihm weichen
müssen, obwohl der Bauern-Bund sich nur als eine Erneuerung des
Schweizer-Bundes hinstellte.»
Das ist Liebenaus erste Entdeckung: unabhängig von der rückschauenden
Ideologie der Bauern, hätte der Sumiswalder Bund, wenn
er Zeit gehabt hätte, richtig auszuwachsen, eine völlig neue geschichtliche
Wirklichkeit geschaffen, die weder mit der Herren-Eidgenossenschaft
von 1481-1798 vereinbar, noch eine Neuauflage des echten
Volksbundes der Bundesgründer von 1273 beziehungsweise von 1291
gewesen wäre, wie die Bauern selbst meinten. Hätte er sich in dem
oben von uns angedeuteten Sinn entwickeln können, dann wäre er,
über seinen anfänglichen bäuerlichen Klassencharakter hinaus, eine
Uebergangs form oder Vorstufe des Bundesstaates von 1848 geworden
— welche Schlussfolgerung Herrn von Liebenau durchaus nicht fern
liegt, wie wir noch sehen werden, die er jedoch negativ bewerten
muss, da sie die Bejahung einer echt revolutionären Entwicklung zur
Voraussetzung hat.
Gerade darum aber, weil ihn sein gut funktionierender Klasseninstinkt
darin nicht täuscht, macht Liebenau seine zweite Entdeckung.
Zwar kleidet er sie zunächst in die vage moralisierende Form eines
Zitats nach dem Berner Staatsrechtslehrer Hilty, eines Zeitgenossen
Liebenaus, der einstmals ragenden protestantisch-konservativen Säule
der modernen Herren-Eidgenossenschaft, eines typischen Repräsentanten
des längst wieder reaktionär gewordenen Bürgertums. In folgender
Weise wittert und denunziert Liebenau die versteckt revolutionäre
Tendenz des Sumiswalder Bundes: «Denn der Sumiswalder-Bund beruhte,
wie Dr. Hilty bemerkt, nicht mehr auf der von Gott gegebenen
Basis, er schützt nicht mehr Recht und Gerechtigkeit» (d. h. nicht mehr
das Profitinteresse der Herrenklasse, nämlich:) «nicht das wohlerworbene
Privatrecht» (der «regierungsfähigen» Familien), «nicht die historische
Entwicklung der Schweiz» (die es nur für die Herrenklasse gab),
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 318 - arpa Themen Projekte
ist es schief, hier von «Sozialismus» zu reden; das ist nur die Redeweise
eines konservativen Reaktionärs, der damit gerade das Antisozialistische,
nämlich alles lediglich Auflösend-Anarchische meint, das mit
einem Umsturz unvermeidlich verbunden ist. Was nun aber Liebenau
— nach einer einfältigen Charakterisierung der Wahl Leuenbergers
zum Obmann als «Verletzung des demokratischen Prinzips» (!) als
wirklich innewohnendes revolutionierendes Prinzip des Sumiswalder
Bundes entlarvt, das hat, abgesehen von der negativen Tendenz-Formulierung,
seine tiefere Richtigkeit, Liebenau schreibt: «Der Bund
von Sumiswald vernichtete, was seine Urheber nicht einsehen wollten,
die Kantonalsouveränität wie alle Landeshoheit» (natürlich nicht alle,
sondern nur die aristokratisch-absolutistische der Herren-Eidgenossenschaft!)
«indem er bestimmte, dass die Bundesbrüder die Streitigkeiten
zwischen Obrigkeit und Untertanen entscheiden sollten, mochten diese
über Gesetzgebung oder Verwaltung sich entspinnen. Der Wolhuser
Bund war damit durch einen weit über die Kompetenzen der Tagsatzung
hinausreichenden Bund verdrängt»!
Mit diesem Prinzip sollte der Sumiswalder Bund «die historische
Entwicklung der Schweiz» — zwar nicht die der Herren, aber umsomehr
die des Volkes wirklich nicht gefördert haben? Von uns aus —
ja, doch! und zwar gewaltig! Gerade in dieser — wenn auch subjektiv
negierend vorgetragenen —Feststellung des katholisch-konservativen
Herrenchronisten liegt für uns objektiv die allergrösste Anerkennung
des eminent progressiven Charakters und damit der wahrhaft geschichtlichen
Bedeutung des Sumiswalder Bundes: dass in ihm nämlich -—
widerspruchsvoll wie in allem Lebendigen —bereits der Keim der Entwicklung
vom Staatenbund zum Bundesstaat lag, die staatsrechtlich
fruchtbarste und stärkste fortschrittliche Idee der Eidgenossenschaft,
die erst anno 1847/48, dann aber als Kraft der wirtschaftlich befreiten
Bürgerklasse, nicht mehr der wirtschaftlich ruinierten Bauernklasse,
geschichtlich siegte!
Unsere positive Auffassung des Sumiswalder und des Huttwiler
Bundes gilt es umso nachdrücklicher auszusprechen, als sie allein steht
und als es sich hierbei um eine der originalsten und stärksten Lebensäusserungen
des Schweizervolkes und um einen der volkstümlichsten
Stoffe unserer Geschichte handelt, über dessen lebendige Wirklichkeit
man allzulange mit kaltherziger Aktenweisheit hochmütig hinweggeschritten
ist.
Die lebendige Wirklichkeit der Bauern von 1653 aber, die notgedrungen
den Sumiswalder Bund hervorbringen und ihn ebenfalls notgedrungen
zum Träger einer eminent fortschrittlichen Idee machen
musste, selbst unabhängig von dem wie auch immer beschaffenen Bewusstsein
seiner Schöpfer, das war die folgende:
Was da aufbrach im tiefsten Schosse der absolutistisch bis in ihr
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 319 - arpa Themen Projekte
Druck schon fast betäubte Masse der Unterdrückten und Ausgebeuteten
gegen ihre Ausbeuter und Unterdrücker. Was da nun in den schweizerischen
Volksmassen gegen die generationenalte Erstarrung in kantonalen
und konfessionellen Abschnürungen, gegen alle traditionellen
und politischen und sozialen Fesseln durchzubrechen begann, das war
überall derselbe soziale Instinkt der Zusammengehörigkeit aller Unterdrückten
und Ausgebeuteten gegen die unterdrückende und ausbeutende
Klasse. Gleich welcher Herkunft, ob Bauer oder Bürger, gleich welchen
Kantons oder welcher Konfession: jetzt suchte der Ausgebeutete und
Unterdrückte nicht mehr allein seiner eigenen lokalen Regierung zu
widerstehen, sondern wagte es, der übergeordneten, interkantonalen
Organisation des Klassenfeindes, der Tagsatzung und ihrer Militärmacht,
die Stirn zu bieten. Denn das war das Instrument der damaligen ausbeutenden
und unterdrückenden Klasse in der Eidgenossenschaft.
Darum begegnen wir fortan überall der leidenschaftlichen Forderung,
das «Gemeine Mandat» der Tagsatzung zu widerrufen, sowie der bewaffneten
Auflehnung gegen jeden Versuch, das «Defensional» in die
Tat umzusetzen.
Es ist also die geschichtliche Grösse des nun aus dem Schosse
des Schweizervolkes mit grosser Wucht empordrängenden Volksbundes,
dass er eine echte soziale Solidaritätsaktion der Ausgebeuteten und Unterdrückten,
ohne Ansehen ihrer Kantons- oder Religionszugehörigkeit,
gegen die ausbeutende und unterdrückende Klasse war. Und zwar war
dies seit der Gründungsaktion der Eidgenossenschaft das erste und bis
ins 19. Jahrhundert das letzte Mal in der Geschichte der Eidgenossenschaft,
dass das Bedürfnis der sozialen Solidarität einer Klasse alle bestehenden
politischen und konfessionellen Schranken durchbrach und
auf eine Klassenabrechnung auf allgemein gesellschaftlicher Basis hinsteuerte.
Es war also schon ein ahnungsvoller Engel, der protestantische
Geistliche aus dem Wallis, der da einmal während des Bauernkriegs
in einem anonymen Schreiben an den Schultheissen von Graffenried
in Bern, das sonst dem edlen Bestreben rabenschwärzester Religionshetze
oblag, schrieb: «Das schweizerische Bauerngift» (nämlich: die
Erhebung des Volks ohne Ansehen der Religion!) «spreitet sich auch
unter unser Volk aus und so plötzlich, dass es zu verwundern ist...
Nach Inhalt alter Historien ist keine Veränderung plötzlicher, verderblicher,
als wenn durch böse Anschläge die Aristokratien in Demokratien
verwandelt werden, die gewöhnlich den dritten Stand nach sich gezogen
haben»!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 320 - arpa Themen Projekte
Eine Sitzung der Tagsatzung in Baden
Nach einem Originalstich in der Graphischen Sammlung der
Zentralbibliothek in Zürich.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 320 - arpa Themen Projekte
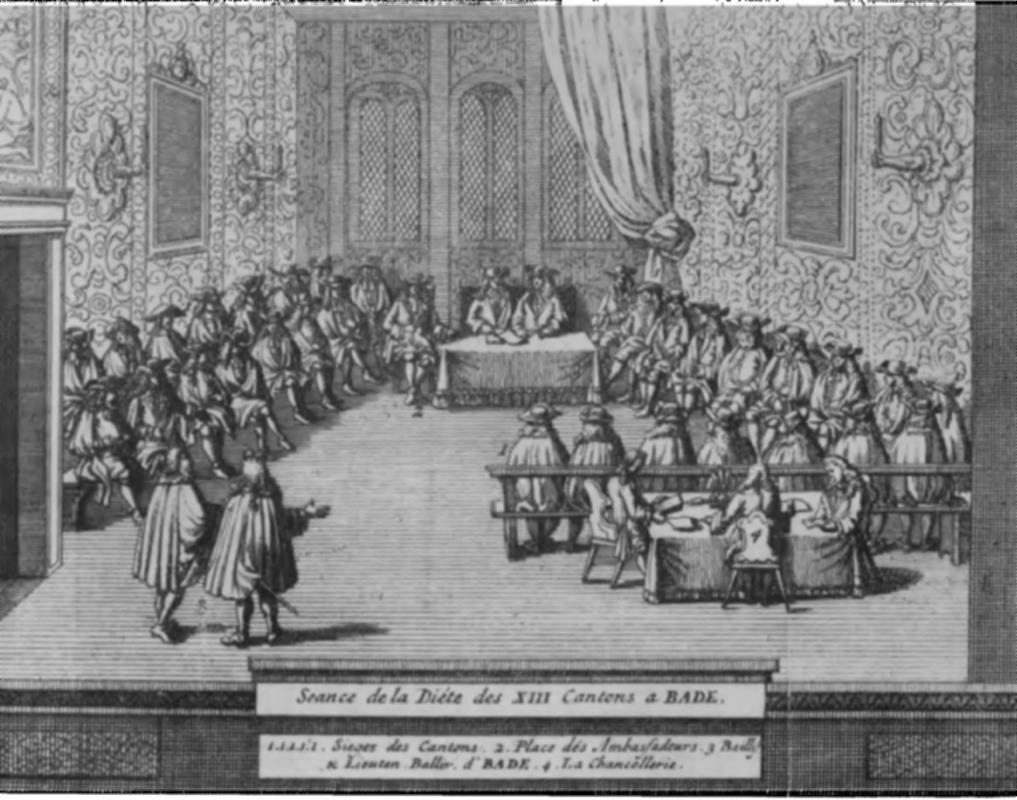
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 321 - arpa Themen Projekte
XIV.
Der «Zunder der zu besorgenden mehrern Unruhen in
der ganzen Eydtgenossenschaft»
Nun waren also nicht mehr nur die Untertanen der Luzerner Herren
«als herren- und vernunftlose Menschen mit den allerbösesten Exzessen
in alle Wege vertieft» —wie die Luzerner Regierung einmal die Bundesbrüder
des Wolhuser Bundes den Tagsatzungsherren denunzierte.
Kaspar Steiner, der immer obenauf schwamm, wenn die Flut der Revolution
hoch ging und immer zu Füssen der Herren strandete, wenn
sie ebbte, Kaspar Steiner verkündete nun: «jetzt dürfen die Bauern sich
nicht mehr fürchten; denn durch den Sumiswalder Bund seien sie stark
genug». Und die Bauern in vier Kantonen und darüber hinaus redeten:
«wir wollen 200 000 Mann zusammenbringen und Sturm laufen». «Mit
diesem Bunde», sagt Heusler, «war nun der Knoten geschürzt, und eine
neue Frage war aufgeworfen, welche alle Kantonalfragen an Bedeutung
weit überragte.»
Nach dem Fest der Bauernfreiheit in Sumiswald kam in der Tat
alles ins Brodeln, bei den Herren wie bei den Bauern in der gesamten
Eidgenossenschaft. Die Herren betrieben fieberhaft die Vorbereitungen
zur neuen Tagsatzung in Baden, die ausschliesslich der Beratung über
die Niederwerfung der Bauern gewidmet sein sollte. Die Bauern, von
Sumiswald heimgekehrt, betrieben nicht weniger fieberhaft die Annahme
des Bundes in den Gemeinden, sowie die Wahl von Ausschüssen
für ihre Gegen-Tagsatzung, für die schon in Sumiswald beschlossene
zweite überkantonale Landsgemeinde in Huttwil. «Immer mehr», sagt
Heusler, «gestaltete sich die Sache zur grossen offenen Verschwörung.
die für niemand ein Geheimnis sein sollte, als für die Oberbeamten.
Denn an offener Gemeinde, unter der Linde, oder am Brunnen oder im
Wirtshause kam man zusammen, die Untervögte und Geschworenen
übernahmen die Leitung und gaben dadurch der Sache ein amtliches
Ansehen. Aber Anzeigen an die Obrigkeit wurden mit dem Tode bedroht.
» Diese Schilderung des Basler Herrenchronisten gilt nicht nur
für die Basler Landschaft, sondern für alle aufständischen Gebiete der
Schweiz. Im Basellandschäftler Volk sprach man sogar bereits —wie
der Homburger Landvogt Brand am 27. April an den Basler Rat berichtete
— «von einem Bunde nicht nur mit den Schweizern, sondern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 322 - arpa Themen Projekte
wie sehr die Sache der Bauern eine Klassensache war, die sie in
ihren Augen ganz selbstverständlicherweise auch mit den Leidensgenossen
ihrer Klasse jenseits der eidgenössischen Grenzen, mit Untertanen
fremder Fürstengewalt, verband.
Sogar die unterdrückten Burgerschaften einiger Hauptstädte der
Eidgenossenschaft regten sich, als ob der Lärm der Bauern sie aus
ihrem Schlaf geweckt hätte. So in Luzern, so in Basel; aber auch in
Zürich und Bern hörte man jetzt die Bürger ziemlich vernehmlich gegen
ihre Herren brummen. Erneute Beerdigungen der Zünfte oder der
ganzen Bürgerschaft, sowie besondere Mahnungen und Ratsbeschlüsse
erwiesen sich als notwendig. «In der Stadt Basel», berichtet Vock, «fingen
die Bürger an, sich sehr freimütige Reden über die obwaltenden
Unruhen der Bauern zu erlauben; viele lobten die Landleute und zeigten
sich nicht ungeneigt, das nämliche Spiel in der Stadt zu beginnen.
Diese Gärung und Räsonniersucht (!) nahm besonders unter den Metzgern
überhand; zwei derselben liess die Regierung verhaften und ihr
freches Maul (!) bestrafen.» Unter diesen Umständen beschloss, nach
dem Bericht Häuslers, der Basler Rat am 30. April «eine Abordnung
auf alle Zünfte, an die Gesellschaften der mindern Stadt und die Aufenthalter».
Jedoch «soll dabei keine Gegenrede zugelassen werden, sondern
der Meister der Zunft soll einfach die Zunftbrüder ermahnen, dem
Gehörten nachzukommen». «Wettstein und Hummel wurden mit dieser
Ansprache an die Zünfte beauftragt.» Wettstein, ein ebenso schreib-
und redseliger Mann wie sein Zürcher Kollege Waser, hat seine Rede
hinterlassen. Darin sagt er (nach Heuslers Referat) unter anderem:
«Durch die Unruhen in den andern Kantonen seien nun die Untertanen»
(d. h. auch die Basler Bürger) «veranlasst worden, auf ungewohnte und
verbotene Weise den Nachlass des Soldatengeldes und Anderes zu begehren»;
jedoch habe «man bald verspüren müssen, dass es ihnen nur
darum zu tun sei, die Obrigkeit allerseits so weit einzutun, dass Alles in
ihrer» (der Untertanen!) «Gewalt stehe, wozu sie sich durch hochsträfliche
Eidespflicht zu einander verbunden hätten. Das sei aber dem obrigkeitlichen
Stand und gemeinem Wesen höchst präjudicirlich, und es
liege daher demselben ob, sich, wenn gütliche Mittel nicht zum Ziele
führen, durch alle erdenklichen Mittel dagegen zu schirmen. Die Bürgerschaft
werde daher vor ungleichen Reden gewarnt und aufgefordert,
gehörigen Ortes Anzeige von solchen zu machen.» Das war Erziehung
zum Angeber- und Spitzeltum, getreu im Geiste des Badener Mandats.
Gleichzeitig baute man vor, indem man, nach Vock, ernsthaft rüstete:
«Es wurden 800 Mann Fussvolk und eine Kompanie Reiter angeworben,
und der Rat liess beim französischen Gouverneur zu Breisach (!)
für den Notfall um Hilfstruppen ansuchen, die, wenigstens 300 Mann
Fussvolk und 100 Reiter, auf erstes Verlangen zugesichert wurden.» (Das
waren also auch im strengsten, landsfremden Sinne die «fremden»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 323 - arpa Themen Projekte
und bezüglich derer sämtliche Tagsatzungsherren ganz gleichzeitig
die Bauernausschüsse und die Huttwiler Landsgemeinde direkt
hoch und heilig beschworen, doch nicht an solche Ammenmärchen und
Verleumdungen zu glauben!) «So rüstete sich die Regierung von Basel
tätig zu Bekämpfung des Volksaufstands mit Waffengewalt.»
In Luzern war dieses System längst eingeführt. Aber auch dort,
und dort ganz besonders, erhob die Bürgerschaft nach der Stiftung des
Sumiswalder Bundes erneut ihr Haupt. Alle ansehnlichsten Räte nämlich
waren in den Tagen seit dem Sumiswalder Schwur aufs Land geschickt
worden, um mit aller Kraft die Annahme des Bundes in den
Aemtern und Gemeinden zu hintertreiben. Da fühlten sich die Bürger
unkontrolliert, um sich beinahe täglich zu versammeln, obwohl darauf
die Todesstrafe stand. «Die Abwesenheit so vieler der einflussreichsten
Ratsherrn», berichtet Liebenau, «benutzten die Bürger zu Besprechungen
unter sich und mit den Bauern... Der Rat war daher gezwungen,
auf den 30. April den Grossen Rat einzuberufen.» «Hier wurde zunächst
referiert, wie sich die Lage des Streithandels» (zwischen den Bürgern
und der Regierung) «seit dem Abschlüsse des Sumiswalder Bundes verändert
habe, wie die Bauern immer arroganter und gewalttätiger auftreten,
wie sie mit neuen Begehren auftreten...» Etc.
Der Grund für diese neue Bewegung der Luzerner Stadtbürger war
also ganz gewiss die grosse, allgemeine Bauernfrage. Liebenau gibt jedoch
dafür noch einen speziellen Grund an: «Die Kunde von den Vorschlägen
der Zuger auf der Konferenz in Gersau brachte (gemeint ist:
bei den Luzerner Bürgern) alles in Konfusion.» Was war diese «Konferenz»,
was enthielten die Zuger Vorschläge?
Die «Konferenz» von Gersau war eine richtige katholische Sonder-Tagsatzung
der Urkantone, die am 25. April zusammengerufen wurde,
um womöglich eine gemeinsame innerschweizerische Richtlinie für die
auf den 29. einberufene gesamteidgenössische Tagsatzung, d. h. für die
Behandlung der gesamten Bauernfrage auf eidgenössischem Boden, zustandezubringen.
Die Abgeordneten an diese Sonder-Tagsatzung von
Gersau waren «meist jene Landammänner, die den rechtlichen Spruch
erlassen hatten, daneben aber auch, als Vertreter von Zug, Ammann
Georg Sidler und alt Ammann Peter Trinkler». Die wahren Einpeitscher
dieser Versammlung waren aber Zwyer und Dulliker.
Dulliker besonders hatte das brennendste Interesse, einen einmütig
bauernfeindlichen Beschluss zustandezubringen; denn dieser sollte die
Plattform für die grosse Aktion der Luzerner Ratsherren werden, die
damit am Tag darauf, am 26., in allen Richtungen über die zehn Aemter
herfallen und sie auf diese Weise demoralisieren und von der Beschwörung
des neuen Bundes abhalten sollten. Diese Plattform sollte natürlich
unter der schönen Flagge der «Versöhnung», des «Friedens», des
«Ausgleichs» zwischen den Herren und den Bauern segeln. Auf Grund
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 324 - arpa Themen Projekte
geschlossen werden: «Wenn die 10 Aemter auf den Wolhuser
Bund verzichten» (den Sumiswalder Bund ignorierte man absichtlich)
«und keine Zusammenkünfte mehr halten, so sei der Rat von Luzern
seinerseits bereit, das Manifest» (gemeint war lediglich das Luzerner
Schimpfmanifest, nicht das der Tagsatzung) «rückgängig zu machen.»
Also: für die blosse Aufhebung gemeiner Beschimpfungen, aus denen
die Luzerner Manifeste — es war inzwischen noch ein weiteres hinzugekommen
—bestanden, sollten die Bauern feierlich auf ihre Grundrechte
verzichten!
Das fanden selbst diese für den «Rechtlichen Spruch» verantwortlichen
Landammänner —natürlich mit Ausschluss Zwyers —zuviel.
«Die Gesandten der fünf Orte» nämlich, so berichtet Liebenau, «teilten
diese Ansicht nicht, vielmehr erklärten sie, dass ihre Regierungen aus den
Verträgen der Delegierten der 10 Aemter die Ueberzeugung gewonnen
haben, dass ein Ausgleich nicht möglich sei, da die Aemter nun auch die
Angelegenheiten der Untertanen der (andern) eidgenössischen Orte mit
in den Streit hineinziehen und die Gültigkeit des Bundes in den Vordergrund
stellen.» Ja, noch mehr: die Gesandten von Nidwalden und Zug
teilten mit, dass sie aus Protest gegen die Behandlung der Luzerner Bauern
durch die Luzerner Regierung die eidgenössische Tagsatzung nicht
besuchen werden! (Richtiger wäre natürlich gewesen, sie wären nach
Baden gegangen und hätten dort protestiert!) Und damit noch nicht
genug: die Zuger und die Nidwalder machten der Luzerner Regierung
die Hölle heiss, indem sie in Gersau erklärten, dass die Gesandten der
zehn Aemter «in der Stadt mehr Anhang haben als die Herren», und
diese Gesandten «hätten gedroht, wenn ihrem Begehren betreffend
Aenderung der Sprüche und Mandate nicht entsprochen werde, so wollen
sie ,ansehnliche Landvogteien an sich bringen'...» Zwyer aber
provozierte unentwegt und schlug in Gersau vor,. man solle den «Rechtlichen
Spruch» (sein «gefälschtes Machwerk») «von der ganzen Tagsatzung»
(d. h. der gesamteidgenössischen in Baden) »besiegeln lassen
und den Bauern keine Kopien der Urkunden aushändigen»! Kurzum,
bereits in Gersau geriet «alles in Konfusion», aus der für die Herrensache
nicht das mindeste Kapital zu schlagen war.
Was war denn passiert, dass es —diesmal unter den Herren — soweit
kommen konnte? Wer waren jene «Delegierten der 10 Aemter»,
aus deren «Vorträgen» die Regierungen der fünf Orte die Ueberzeugung
gewonnen hatten, «dass ein .Ausgleich nicht möglich sei»?
Das war ein Meisterstück der Entlebucher! Schon am 23. April,
mithin genau am gleichen Tag, an dem sie in Sumiswald mit den Berner,
Solothurner und Basler Bauern den neuen Bund aufrichteten, hatten
sie eine Gruppe von sechs Entlebucher Führern an die Landsgemeinde
in Schwyz, eine andere Gruppe an den Landrat von Uri, und
andere Emissäre in die anderen Orte geschickt, mit dem Begehren,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 325 - arpa Themen Projekte
zu bringen. Zwar wurden sie hierin von den regierenden Herren
in Schwyz und Uri abgewiesen; ja in Schwyz wurden die sechs
Entlebucher «hierauf von der Regierung eingekerkert». Die Reaktion
der dortigen Bauern, insbesondere in Zug und Nidwalden, fiel indessen
eindeutig zugunsten der Entlebucher aus. In Stans und Zug wurden
ihre Boten mit Beifall angehört und erwirkten den Beschluss, die
Tagsatzung zu Baden nicht zu besuchen. Der Zuger Rat gab seinen
Gesandten für Gersau die Instruktion mit: «Damit die luzernischen
Untertanen von den Beamten nicht wieder so erbärmlich tribuliert werden,
so soll man ihnen eine Urkunde geben, dass sie wieder zu den
katholischen Orten ihre Zuflucht haben mögen, wenn sie von der Obrigkeit
nicht geschirmt würden»; ausserdem sollen sie in Gersau «die
Aufhebung des Mandats von Baden» beantragen. (Im Protokoll der
Gersauer Konferenz sind allerdings diese «Zuger Vorschläge», die wir
nur aus den Zuger Akten kennen, offensichtlich unterschlagen worden!
Kein Wunder, wo ein Zwyer dabei ist...)
Die bauernfreundliche Partei war also in Zug völlig obenauf gekommen
—dank der unermüdlichen Arbeit der Entlebucher und Willisauer
Boten und dank der entschlossenen Mitarbeit des senkrechten
Volkstribunen Peter Trinkler, der der Bauernsache unentwegt treu
blieb und sie auch nach der Niederlage nicht verleugnete. Sein Bild als
aufrechter Charakter kann auch dadurch kaum getrübt werden, dass
er auf derselben Gersauer Konferenz auch als katholischer Religionsfanatiker
erscheint. «Landammann Trinkler», sagt Liebenau —und
hier ist Trinkler für den katholischen Herrenchronisten auf einmal
nicht mehr der «Demagog» und «Händelstifter», als den er ihn früher
denunziert hat —, «machte dann auf die bedenkliche Lage der eidgenössischen
Vogteien aufmerksam, wo neben der politischen auch eine
religiöse Bewegung sich Bahn breche, indem die Bauern nach der
Bibel verlangen und die Freistellung der Religion begehren.» Die Ueberwertung
der angestammten Religion in politischen Dingen, die darin
zum. Ausdruck kam, teilte er mit dem allgemeinen Vorurteil der höchst-'
gestellten Herren seiner Zeit, auch im protestantischen Lager (und
wie!). Dass er aber die Religion nicht nur als Vorwand, vielmehr fanatisch
ernst nahm, ist ja nur die Kehrseite seines mutigen und intransigenten
Charakters und dessen konsequente Anwendung auf den allgemeinen
Zeitirrtum. So witterte er denn in der eben bevorstehenden
Visitationsreise des Zürcher Seckelmeisters — und designierten Oberbefehlshabers
der Tagsatzungsarmee — Johann Konrad Werdmüller
in die hauptsächlich den katholischen Orten unterstellten Freien Aemter,
in Begleitung des ebenfalls protestantischen Landammanns Martin
von Glarus, eine Benachteiligung der katholischen Religion durch den
protestantischen Vorort Zürich. Das war übrigens der Standpunkt aller
Vertreter der fünf katholischen Orte. «Deshalb sollte man», wie Trinkler
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 326 - arpa Themen Projekte
hintertreiben.» Und in der Tat sind die Vertreter von Uri, Unterwalden
und Zug, die von Tagsatzungs wegen die Visitation der Freien
Aemter hätten mitmachen und an eben diesem 25. April dort hätten
eintreffen sollen, gar nicht abgereist, ohne Werdmüller und Martin das
auch nur mitzuteilen. Aber Peter Trinkler wird auch seine Bauerngründe
gehabt haben, um gegen diese, ihm von Werthenstein und Ruswil
her bekannte Art der Herrenbefriedungspolitik gegenüber Bauern
aufzutreten. Dort waren es ja katholische Herren gewesen, denen er
wahrlich nicht weniger scharf entgegengetreten war.
Aber nicht nur Zug, sondern auch die andern Regierungen der
Landsgemeinde-Kantone standen in Gersau unter dem Druck ihrer
Bauern; so sehr, dass ein auf der Gersauer Konferenz gestelltes Begehren
Luzerns, «zur Widerlegung der von den Bauern ausgestreuten
Verleumdungen» Delegierte an deren Landsgemeinden senden zu dürfen,
von den Gesandten in Gersau «als überflüssig abgelehnt» werden
musste. Luzerner Herren vor ihre Landsgemeinden von Bauern zu
rufen, um diesen die Sache des Bauernbundes schlecht zu machen —
das wagte selbst ein Zwyer seinen «Untertanen» nicht zu bieten! Kurzum,
all diese Widersprüche im Herrenlager der Urkantone spiegeln
sich in der «Konfusion» der Verhandlungen in Gersau auf das getreueste
wieder. Sie sind ein Erfolg der Bauernpropaganda.
Die Entlebucher, nun längst Meister in der Propaganda, waren also
der Herrenpropaganda, wie sie in Gersau gegen den Sumiswalder Bund
aufgezogen werden sollte, mit erstaunlicher Präzision zuvorgekommen.
Wie genau dies alles im voraus überlegt war, geht schon aus den
mitgeteilten Daten hervor. Vielleicht aber auch aus einem Brief Hans
Emmeneggers, den dieser, mitsamt allen in Sumiswald anwesenden
Entlebucher Führern, aus Sumiswald am 23. April an die Luzerner
Regierung richtete und mit dem er einen schon vorher von dieser gemachten
Versuch, durch Verhandlungsvorschläge störend einzugreifen,
ironisch auf die lange Bank schob. Darin nämlich lud Emmenegger
die Luzerner Regierung zu einer grossen Landsgemeinde beim Heiligen
Kreuz im Entlebuch auf den 3. Mai ein, zu einer autonomen Versammlung
von der Art also, wie sie die Regierung als Hochverrat unter Todesstrafe
gestellt hatte; eine Landsgemeinde, die mithin vorsorglich
bereits vor der Stiftung des Sumiswalder Bundes beschlossen und angesetzt
worden war. Begreiflich, dass ein Herrenchronist wie Liebenau
berichtet: «Mit schamloser Unverfrorenheit (!) schrieben am 23. April
Landespannerherr — der damals in Sumiswald war — Fähnrich und
Geschworene von Entlebuch an Schultheiss Dulliker, sie wollten gerne,
dem Ansuchen des Rates entsprechend, zu den Verhandlungen nach
Luzern kommen; allein der gemeine Mann sei unwillig und wolle es
nicht mehr dulden, dass man Gesandte nach Luzern schicke und dem
Rat entgegenlaufe.» (Schon am 19. April hatten die Willisauer den
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 327 - arpa Themen Projekte
so können sie uns nachreiten und uns an bestimmten Orten finden».)
«Wenn die gnädigen Herren etwas Fruchtbares ausrichten wollen, so
sollen sie am 3. Mai ins Heilig Kreuz —einen bekannten Wallfahrtsort
—im Entlebuch kommen.» (Vorher war also «Fruchtbares» keinesfalls
auszurichten!) «Man wolle dort ihnen ,alles Lieba und Guts,
Fried und Geleit erzeigen'. Dann brachten sie wieder ihre vier Begehren
wegen Aenderung des rechtlichen Spruches vor. Bevor dies arrogante
(!) Schreiben eintraf, berief der Rat die Tagsatzung der Urkantone
auf künftigen Freitag (25. April) nach Gersau.»
Mit der Art und Weise, wie die Entlebucher zur «Vorbereitung»
dieser «Tagsatzung der Urkantone» beitrugen, schlugen sie also zum
vornherein auch der grossen Diversions-Aktion der Luzerner Räte in
den zehn Aemtern, die am 26. gestartet wurde, den Boden aus dem
Fass. Schon am 25. —also am Tag selbst der Gersauer «Konferenz» —
nahmen die Entlebucher Gemeinden den neuen Bund feierlich an und
wählten bereits ihre Delegierten für die Landsgemeinde in Huttwil,
auf den 30. April, und zwar, als Führer der Delegation, Hans Emmenegger,
den Landessiegler Binder, den Landesweibel Lymacher und den
Schulmeister und Bundesschreiber Müller. «Gleich trotzig benahmen
sich die Ruswiler, indem sie am 25. April dem Rate schrieben, wenn
die Regierung ihre Versprechungen nicht halte, so müssten die Bauern
auf andere Mittel denken und sich miteinander verbinden.» Wozu
Liebenau bemerkt: «Das sollte wohl heissen: wir haben bereits den
Sumiswalder-Bund ratifiziert.» Das Amt Willisau genehmigte den Sumiswalder
Bund ebenfalls bereits am 26., und zwar in zahlreichen, zu
diesem Zweck einberufenen Gemeinden, an denen keine männliche
Person, die über 14 Jahre alt war, fehlen durfte. Das Amt Rothenburg
nahm am 28., im Beisein dreier Deputierter des Luzerner Rates, statt
mit diesen einen «Vergleich» zu schliessen (sie wurden «gar schlechtlich
respectiert»!), «trotz ernstlichen Abmahnens», die verbotene Aemterbesetzung
vor; der regierungstreue Amtsfähnrich, sowie andere Anhänger
der Regierung wurden weggewählt und dafür der Bruder Kaspar
Steiners, Sebastian Steiner, zum Amtsfähnrich bestellt. Ebenfalls
am 28. versuchte eine besonders ansehnliche Ratsdeputation, an der
Spitze der Schultheiss Dulliker persönlich, abermals, die Stadtbürger
von Willisau, mit dem Köder, man wolle «ihre Begehren der Tagsatzung
unterbreiten», aus dem neuen und soeben beschworenen Bund
herauszubrechen. «Aber die Leute beharrten bei den weitgehendsten
Forderungen, welche eine Vereinbarung unmöglich machten.»
Kurz, für die Luzerner Herren war ihre grosse Diversions-Aktion
abermals nichts anderes als eine Kette von Niederlagen. Begreiflich,
dass die militärischen Hitzköpfe unter ihnen über das ewige, nutzlose
Verhandeln mit den Bauern schier aus der Haut fuhren. So Kaspar
Pfyffer, der sich am 1. Mai mit den Worten Luft machte: «Alles ist
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 328 - arpa Themen Projekte
sollen doch einmal eine Resolution fassen, dass die Stadt nicht
von aller 'Welt — der Herrenwelt — verhasst und verspottet werde»!
Aber die Entlebucher und Willisauer begnügten sich nicht mit
ihren Erfolgen in den zehn Aemtern und in der Innerschweiz. Sie griffen
in erstaunlicher Voraussicht noch viel weiter aus. So sandten sie
dieselben fünf Delegierten, die sie zum Landrat von Uri geschickt
hatten, gleich weiter «über das Gebirge..., um die italienischen Vogteien
von der Sendung von Hilfstruppen abzumahnen»! Ja, sie sandten
sogar eine Delegation an den Rat von Zürich, um den Vorort, im Hinblick
auf die bevorstehende Tagsatzung, von der Gerechtigkeit ihrer
Sache zu überzeugen und ihn in seiner Bauernfeindlichkeit wankend
zu machen! Ein gewiss kühnes Unterfangen —und doch hatte es, so
unwahrscheinlich dies scheint, einen gewissen, wenn auch naturgemäss
nur vorübergehenden Erfolg. Das Schönste daran aber ist die strahlend
reine Gesinnung der Solidarität der Entlebucher und Willisauer gegenüber
ihren Berner Bundesbrüdern, die in diesen Verhandlungen zum
Ausdruck kommt. Doch hören wir!
Sie hatten das Mahnschreiben des Vororts an sie vom 19. April, sich
in Erwartung der Tagsatzung ruhig zu verhalten, sowie auch wohl ein
«Erinnerungsschreiben», das der Vorort in demselben Sinne direkt an die
Sumiswalder Landsgemeinde gerichtet hatte, als Anknüpfung benutzt.
Nach vorangegangener Korrespondenz über freies Geleit, das ihnen
Zürich — jedoch gemeint für eine Delegation an die Tagsatzung in
Baden —zusagte, entschlossen sich die Willisauer und Entlebucher
zu einer sofortigen Delegation nach Zürich, noch vorgängig der Tagsatzung.
Sie sandten Leodegar Theiler, den Weibel von Escholzmatt,
den Zeugen der betrügerischen Verlesung des «Rechtlichen Spruchs» auf
dem Kriensfeld am 19. März, Hans Roth von Schüpfheim, über den
wir nichts Näheres wissen, sowie Hans Ulrich Amstein, den Sternenwirt
von Willisau, einen der ersten Anknüpfer der Unterhandlungen
mit den Entlebuchern über die Stiftung des Wolhuser Bundes.
Am 26. April war Audienz vor dem Zürcher Rat. Dieser wies die
«dreifache» Gesandtschaft an eine eigens dafür bestellte Ratskommission,
die darauf einige Stunden lang mit den Bauern Sitzung hielt. An
deren Spitze stand der Bürgermeister Waser selbst; die übrigen Mitglieder
waren die Statthalter Hirzel, Leu und Landolt, sowie der Bannerherr
Bräm, der Landvogt Escher und der Bergherr Lochmann. Diesen
überreichten die drei Bauern eine Reihe von Dokumenten zur Einsicht,
die die Herren in der Rechenstube sofort kopieren liessen, darunter
den Wolhuser Brief und (nach Liebenau) auch den Sumiswalder
Brief. Als Hauptgegenstände des denkwürdigen Gesprächs — das das
einzige dieser Art zwischen Bauern und Herren im ganzen Bauernkrieg
ist —gehen aus den Verhandlungsberichten Peters und Liebenaus
folgende hervor: Die Bauern fragten:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 329 - arpa Themen Projekte
1. «ob man nit schuldig seie, Ire Freiheiten zu schirmen»; nach
Liebenau: «ob die Regierung von Luzern nicht verpflichtet sei, ihnen
Auskunft über die urkundlich festgesetzten Rechte und Pflichten der
Untertanen zu erteilen?»
2. «ob ess nit billig, dass die Obrigkeit im ,Friden' (d. h. im
«Rechtlichen Spruch») das Wort ,fehler' auskratze»; nach Liebenau:
«ob nicht im Rechtsspruche das Wort ,Fehler' getilgt werden könnte,
da durch eine etwas moderirte Form das sonst tief eingewurzelte Misstrauen
und die hieraus erwachsenen Unruhen wieder beseitigt werden
könnten, wie denn überhaupt die Untertanen sonst keinen bösen Willen
gegen die Obrigkeit hätten.» (Zum Verständnis muss bemerkt werden,
dass das Wort «Fehler» eine höchst schwerwiegende rechtliche
Folge hatte: wer dreimal sich eines «Fehlers», nach der völlig beliebigen
Auffassung der Herren, schuldig machte, war diesen unwiderruflich
mit Leib und Gut verfallen! Mindestens dreier «Fehler» beschuldigt
zu werden, hatten aber zu diesem Zeitpunkt schon Tausende zu
befürchten!)
3. «ob es fit zu erlangen, dass das Badener Mandat aufgehoben,
das sie verderbte Leute schelle»; nach Liebenau: «ob nicht das Mandat
der Tagsatzung, welches die Bauern an ihrer Ehre angreife, durch
ein anderes ersetzt werden könnte, welches ihre Ehre wahre?»
4. «ob es nit zu erlangen, dass man Iren in Wolhusen geschworenen
Bund Alsa zu Recht bestehend anerkenne»; nach Liebenau: «ob
der Bund zu Wolhusen wirklich gegen Vernunft und Ordnung sich
verstosse. »
Diese Fragen der Bauern unterbreitete die Kommission sofort
dem versammelten Rat, der, «nachdem man Inen (den Bauern) gehörig
zugesprochen», folgenden «Recess» beschloss: «der ersten drei
Wünsche halber könne man Jnen wo! Hoffnung auf Erfüllung machen;
niemals aber würden die Obrigkeiten Iren Wolhuser Bund annemmen».
Im übrigen «möchten sie ihre Angelegenheiten bei der Tagsatzung
anhängig machen». Ausserdem beschloss der Rat: «der Entlebucheren
Fürbringen Bern und Luzern zu communicieren».
Dies nun war entschieden kein Erfolg! Schon die kategorische
Aberkennung des Wolhuser Bundes musste in den Augen der Bauern
die —ohnehin zu nichts verpflichtende —freundliche Geste der gemachten
«Hoffnung auf Erfüllung» bezüglich der drei ersten Punkte
vollends entwerten. Dies trotz den nichts weniger als wohlwollenden
Worten, mit denen Liebenau den Zürcher Herren die ernsthafte Absicht
unterschiebt, aus ihrer gemachten «Hoffnung auf Erfüllung» bezüglich
der drei ersten Punkte Konsequenzen zu ziehen. Liebenau
schreibt: «Die Deputierten des Rates von Zürich glaubten den einschmeichelnden
Worten der Demagogen (!) und gaben ihnen über die
drei ersten Punkte ganz beruhigende Auskunft, in der Meinung, es
liesse sich durch eine Erläuterung des ersten eine Beruhigung des Volkes
erzielen.» Im übrigen war ja alles der Tagsatzung zur Entscheidung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 330 - arpa Themen Projekte
die Bauern! Sie müssen ihre Niederlage in Zürich durchaus als
solche empfunden haben. Denn sie haben von sich aus weder die
Sache an die Tagsatzung weitergezogen, noch haben sie sich, nach der
Zürcher Erfahrung, in Huttwil dazu entschliessen können, eine direkte
Delegation mit Verhandlungsvollmacht an die Tagsatzung zu schicken.
Aber es gab noch einen 5. Punkt —und der führte, objektiv geschichtlich,
tatsächlich zu einem gewissen Erfolg, wenn die Bauern
ihn auch nicht in Zürich zu spüren bekamen. Dieser Punkt betrifft den
Sumiswalder Bund, und von diesem Punkt berichtet allein Liebenau
als von einem Gegenstand des Zürcher Gesprächs: «Als dann aber die
Rede auf den in Sumiswald geschlossenen Bund kam, legten die drei
Delegierten selbst eine Abschrift desselben vor und erläuterten denselben
in einer Weise, dass die Deputierten von Zürich sich dem
Wahne (!) hingaben, es sei ,kein böser Wille wider den Stand Bern
nicht vorhanden, sondern wenn die Untertanen Brief und Siegel über
die Konzessionen mit etwas Moderation im Eingang und Ende des
ihnen vorgelesenen Conceptes empfangen haben und wenn die Besatzungen
aus den Schlössern abgeführt seien, werde sich das Misstrauen
und der grosse Schrecken der Landleute legen, der durch die
Verstärkung der Besatzungen, Transport von Munition auf der Aare.
und vielfache Drohungen entstanden sei' . . . Bürgermeister und Rat von
Zürich boten daher am 16.126. April den Rat von Bern, in diesem Sinne
ihren Untertanen entgegenzukommen.»
Das nun war ein Erfolg der Entlebucher und Willisauer in Zürich!
Und zwar — wenn die Darstellung Liebenaus stimmt — ein Erfolg
ausgesprochen zugunsten ihrer Berner Bundesgenossen! Sie müssen
deren Sache wirklich mit Kraft und Feuer vertreten haben, wenn es
ihnen gelang, eine Herrenregierung wie den Zürcher Rat unter der
Führung Wasers zu einem Staatsakt zu bringen, der seiner Substanz
nach gegen eine andere Herrenregierung, gegen den aggressivsten und
gefährlichsten Feind der Bauern, gerichtet war. Das bleibt ein Erfolg,
und sogar ein einigermassen erstaunlicher, auch wenn anzunehmen
ist, dass die Berner Junker sich nicht viel aus dieser Moralpauke der
Zürcher gemacht haben werden. Auch die Zürcher Herren sind ja dann
übrigens wenige Tage darauf, auf der Tagsatzung in Baden, von ihrem
erstaunlichen Milde-Anfall gründlich zurückgekommen! Auch muss
bei diesem Staatsakt der stets unter der Decke glimmende Eifersuchtskomplex
zwischen den beiden Aristokratenmächten mit in Anschlag
gebracht werden, der die Zürcher Regierung ja auch früher schon —
und auch in der Folge noch —veranlasst hat, ihre Oberstellung als
Vorort nicht ungerne zu einer sanften Demütigung ihres stolzen Rivalen
zu verwenden. Möglich ist auch, dass eine allerdings nicht sehr ansehnliche
Zweier-Delegation aus dem bernischen Aargau, aus der Grafschaft
Lenzburg, die am selben Tag von Waser und Hirzel empfangen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 331 - arpa Themen Projekte
dem Entschluss der Zürcher Herren zu dem Staatsbrief an Bern gehabt
hat. Allerdings machen diese beiden Bauernvertreter, die Untervögte
Hans Lüscher von Schöftland und Albrecht Kuli von Niederlenz,
nach dem was Peter von ihnen berichtet — «dass sie aber sonst gegen
die Regierung nichts zu klagen hätten und jedermann gerne in aller
Untertänigkeit verharrte» —, durchaus nicht den Eindruck, dass sie,
jedenfalls nicht allein, die Kraft gehabt hätten, die Zürcher Herren zu
der Aktion gegen Bern zu bestimmen.
Uebrigens liess man in Zürich die Abgeordneten der Luzerner
Bauern vor ihrer Abreise noch freundlich «auf Staatskosten bewirten»,
wie Peter berichtet; «ja, sie wurden, zum lebhaften Bedauern des Rates,
von den Gesellschaftern ins Obmannamt und ins Zeughaus geführt,
wo man ihnen die grossen Vorräte an Getreide, Munition und
Waffen zeigte, was zu scharfem Tadel gegenüber Zürich Anlass gab»
(womit besonders Bern den Zürchern gern heimzahlte!). Peter fügt hinzu:
«Die Gesandtschaft verliess das Gebiet des Kantons Zürich nicht,
ohne den übrigens unbegründeten Verdacht erweckt zu haben, sie hätten
versucht, auch zürcherische Untertanen ,ufflüpfisch' zu machen.»
Ob dieser Verdacht so unbegründet war, ist allerdings nicht sicher.
Jedenfalls weist Liebenau aus echten Quellen nach, dass am Tag nach
dem Besuch der Entlebucher und Willisauer, am 27. April, «in Zürich
vier Entlebucher, zwei Berner und ein Solothurner wegen Aufwiegelung
eingesteckt» worden sind! Oder war dies nur die echt herrenmässige
Schlussfolgerung der Zürcher Herren aus dem Eindruck der
Stärke und «Gefährlichkeit», den ihnen die «dreifache» Gesandtschaft
der Entlebucher und Willisauer eingeflösst hatte?
Die «löbliche Gesandtschaft von den würdigen, rebellischen und
aller Vernunft beraubten Bauern» —wie der Landsgemeinde-Gewaltige
von Uri, der Altlandammann Emanuel von Roll, in einem unterwürfigen
Brief an den Schultheissen Fleckenstein, die Bauerndelegation
dieser Tage an die eidgenössischen Orte bezeichnete —begnügte
sich in der Tat nicht mit der Mission beim Zürcher Vorort. Die Entlebucher
und Willisauer sandten ihre Boten bis ins Toggenburg und an
den Bodensee. Nach Liebenau wären es dieselben gewesen, die nach
Zürich abgeordnet waren: «Der Rat von Luzern hatte inzwischen in
Erfahrung gebracht, dass die Abgeordneten von Willisau und Entlebuch
nach Vollendung ihrer Mission in Zürich sich ins Thurgau und
Toggenburg gewendet haben, um dort das Volk aufzuwiegeln; deshalb
erliess er am 29. April ein Mahnschreiben an den Abt von St. Gallen.»
Wer nun auch die Boten gewesen seien, Tatsache ist, dass die Thurtaler
kurz nach dieser Zeit Schritte unternahmen, die nicht gut anders
zu erklären sind, als durch eine geheime Abmachung zwischen ihnen
und den Luzerner Bauern, Solidarität zu üben: «Die Thurtaler machten
zweimal dem Abte von St. Gallen Vorstellungen wegen der Hilfeleistung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 332 - arpa Themen Projekte
bemerkt dazu mit Recht: «Die Folgen dieser gegen den Volkswillen
versprochenen Hilfeleistung blieben nicht aus.» Bei der späteren Aushebung
der Truppen für die Herrenarmee gegen die Bauern nämlich
meuterten viele Thurgauer und Toggenburger, der Rest rückte missmutig
ein, und viele suchten noch während des Kampfes das Weite.
Inzwischen war auch im Bernischen alles wieder in hellen Aufruhr
geraten. Mit Recht behauptet der Zürcher Herrenchronist G. J.
Peter, «dass die Erbitterung der bernischen Bauern hauptsächlich wieder
zum Ausbruch gekommen war, weil ihnen der Berner Rat die
mündlich eröffneten ,Concessions-Artikel' nicht rechtzeitig urkundlich
bestätigte». Aber es muss hinzugefügt werden, dass dies nur einer der
Grunde war und dass die Berner Regierung in einem Schreiben dieser
Tage an die Zürcher Regierung sicherlich mit Recht behauptete, die
Berner Bauern hätten in Sumiswald «auch sonderlich das letzte Badische
Edikt mit sinnlich widrigem gmüt eingesogen, ein früsche starke
Zusammenverbindnuss der oberkeiten gegen den underthanen betitlet
undt zu einer Ursach der gegen Verbindtnus genommen...» Und die
Berner Regierung beschreibt in demselben Schreiben den Gang der
Dinge ganz richtig und gewissermassen mit dem Scharfsinn der Angst
für die kommenden Dinge, wenn sie darin sagt, «dass bereits eine Zusammenverbindung
ihren vortgang genommen und eine früsche Zusammenrottung
uff nechstkünftigen Mittwochen (30. April) angestellt
worden, bei welcher die noch mehreren Artickel und ungereimbten anmutungen
neben anderem herfürbrechen werdend...» Sicher ist, dass
nur der ungeheure Aufschwung der ganzen Volksstimmung, den schon
die Propaganda für Sumiswald, geschweige die Beschwörung des Bundes
selbst und dann dessen Hinaustragung bis in den hintersten Winkel
des Landes bewirkt hatten, eine genügende Erklärung dafür abgibt,
was sich nun. im Bernerland abspielte.
Als Auftakt dazu möge hier erwähnt sein, dass schon am Tag des
Bundesschwures selbst, am 23. April, ein einfacher Emmentaler Bauer
den für jene Zeit halsbrecherischen Mut fand, an den Zürcher Bürgermeister
Waser selbst zu schreiben und ihm ins Gesicht zu sagen, man
sage im Emmental, er «habe in Langnau die Unwahrheit und mehr gesagt,
als die evangelischen Gesandten von der Bernischen Regierung erlangt»!
Es war der Schaffner Jakob Peter zu Trueb im Emmental, der
dies schrieb und damit Waser zwar nicht des gleichen, aber eines ähnlichen
Volkstäuschungsbetruges bezichtigte, wie ihn Zwyer an den Luzerner
Bauern beging. Worauf übrigens der hohe Herr am 26. höchst
eigenhändig antwortete! Und zwar in einem ellenlangen Schreiben,
das von Versicherungen seiner moralischen Integrität, sowie seiner
«Mühe und Arbeit» mit der Vermittlung in Bern übertrieft, im übrigen
aber ein Musterbeispiel für die aristokratische Arroganz ist, mit der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 333 - arpa Themen Projekte
in Anspruch nahmen. «Man muss aber», heisst es
da, «eine hochansehnliche Obrigkeit nicht immer mit beharrlichen
neuen verdächtigen Zusammenkünften und Bundesmahnungen beleidigen...:
es verlautet, dass nächstkünftige Woche zu Huttwil ein
Bund sollte geschworen werden, was ich aber keineswegs weder glauben
kann, noch will, in Anbetracht, dass bei Euch, als christlichen Untertanen,
diese gottselige Beherzigung stark sein und Platz finden
werde, dass der höchste Regent des obrigkeitlichen Ansehens seiner Statthalter
allhier auf Erden jederzeit eine gar hohe, besondere Rechnung hat,
und wo das verletzt wird, es nicht ungestraft abgehen lässt... dass
man sich dadurch an der hohen Majestät Gottes vergreifen und versündigen
könnte... So habe ich hiermit alles aus wohlmeinendem
Herzen und vaterländischem Gemüt andeuten wollen...»
Wie hoffnungslos volksfremd und volksfeindlich dieser Herrengeist
war, das geht aus nichts deutlicher hervor als daraus, wie das
Berner Volk auf die arroganten Ansprüche der Herren jetzt allgemein
reagierte. Vock berichtet: «Niklaus Leuenberger, früher wankend und
unentschlossen, widmete sich nun der Leitung des Aufruhrs mit entschiedener
Gesinnung und Tätigkeit. Das obere und niedere Simmental,
wohin die Volksbewegung noch nicht gedrungen war, wurden
durch eigene Zuschriften zur Teilnahme aufgefordert, in allen Dörfern,
auf allen Landstrassen und an den Ufern der Aare zahlreiche
Wachen, in so geringer Entfernung, dass sie sich einander zurufen
konnten, aufgestellt und durch dieselben alle Reisenden untersucht,
Boten und Briefe aufgefangen. Und in diesem kriegerischen Feuer und
Mute wetteiferten die Weiber der Bauern mit ihren Männern. Sie bewachten
die Wälder, ermunterten die Männer und liefen umher, ihnen
Waffen aufzusuchen und herbeizuschaffen.»
Am 24. April, also unmittelbar nach dem Sumiswalder Tag, war
von der Regierung im Kanton Bern —und gleichzeitig, auf Betreiben
Berns, auch im Kanton Basel —ein allgemeiner Buss- und Bettag an
geordnet worden, «um mit vereinten Bitten Gott anzurufen, dass er
die verblendeten Gemüter erleuchte». Aber — «wer sollte es glauben»,
sagt der fromme Dekan Vock, «dass die Bauern auch in dieser frommen
Gesinnung nur Hinterlist und Tücke und in der Feier des Busstags
einen Fallstrick erblickten?». «Also schickten die Bauern des Kantons
Bern am 24. April ihre Weiber in die Kirche; sie selbst gingen
nicht hin, sondern standen in den Waffen, und eine Wache löste die
andere ab.» Und vom Kanton Basel berichtet der nicht minder fromme
Heusler: «Aber so gross war bereits das Misstrauen, dass die Bauern
besorgten, es sei auf einen hinterlistigen Ueberfall in der Kirche
abgesehen. Sie ordneten also Wachen und Lärmzeichen an und fanden
sich mit Ober- und Untergewehr zum Gottesdienste ein. Mit welcher
Andacht hörten wohl diese, gegen vermeinte Mordanschläge ihrer väterlichen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 334 - arpa Themen Projekte
Predigten über den Gehorsam gegen die an Gottes Statt gesetzte Obrigkeit
an?» Das also war der Zweck dieses Buss- und Bettags, was Heusler
in diesen Worten mit anerkennenswerter Offenheit kundgibt.
In der Nacht dieses selben Tages sollten die Berner Bauern einen
schlagenden Beweis für die Richtigkeit ihres Misstrauens gegen Anschläge
seitens ihrer «an Gottes Statt gesetzten Obrigkeit' erfahren.
Da fuhr nämlich im Schutze der Nacht ein Warenschiff der Zürcher
Firma Heidegger die Aare hinab. Es hatte, nebst «Eisenwaren», auch
200 Handgranaten geladen, die die Berner Regierung an ihre Besatzung
im Schloss zu Aarburg schickte. Sie waren in Fässchen verpackt, die
zur Tarnung die Aufschrift getragen zu haben scheinen: Süsser
Wein»! Das Schiff aber «wurde von der zu Berken am Ufer der Aare
aufgestellten Wache bemerkt; diese machte Lärm und die Bauern
liefen zusammen. Das Schiff ward angehalten, und die Schiffleute
wurden sogleich als Gefangene erklärt.» Als die Bauern unter der
Schiffsladung auch die getarnten Handgranaten entdeckten, da schrien
sie: «Das sind also die süssen Weinbeeren, womit man uns tränken
will!» Jetz gseht me, was mer für ne schöni Obrigkeit hei!» Eine
Obrigkeit nämlich, «die solches Unheil dem Vaterlande bereitet und
so den Friedensschluss verletzt'. So berichtet Vock nach Markus Huber,
dem Hauslehrer des Landvogts Willading in Aarwangen, einem
Zürcher Kandidaten der Theologie, der als Augenzeuge vieler Vorgänge
des Bauernkriegs eine besonders herrenfromme lateinische Chronik
darüber verfasst hat, in der, mitten im lateinischen Text, auch der
mitgeteilte Satz in echtem bernischem Dialekt steht. «Die Wut und
Raserei der Bauern», so berichtet Vock weiter, «war auf's höchste gestiegen.
Die gefangenen Schiffsleute wurden samt den Eisenwaren,
auf Leuenbergers Befehl, nach Langnau geführt, um vor die nächste
Landsgemeinde zu Huttwil gestellt und beurteilt zu werden.» Am Tag
darauf fingen dieselben Bauern übrigens auch den Hauptmann Rümmelt
aus Bern, der von der Berner Regierung zur Leitung der Besatzung
nach dem damals bereits belagerten Schloss Aarwangen geschickt
worden war. Auch er wurde auf Befehl Leuenbergers nach
Langnau geführt, um vor die Huttwiler Landsgemeinde gestellt zu
werden. Die Folge der Schiffsgeschichte war übrigens, dass die Solothurner
Regierung, von dem «Geschrei über das Schiff' und von den
möglichen Folgen ähnlicher heimlicher Kriegssendungen der Berner
Regierung für die Aufwiegelung ihrer eigenen solothurnischen Untertanen
geängstigt, die Aare bei der Brücke in Solothurn mit einer
dicken Kette Tag und Nacht sperren liess. Auch reklamierte sie über
den Vorfall bei der Berner Regierung, woraus, ein langwieriger Zwist
zwischen diesen beiden Herrenregierungen erwuchs. Schon diese Folge
also hatte die Wachsamkeit der Oberaargauer Bauern reichlich gelohnt.
Wieviel mehr noch das «Geschrei über das Schiff» und über
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 335 - arpa Themen Projekte
mehr verstummte.
Am Tag danach, am 28., wurde die Basler Regierung durch eine
von Isaak Bowe und Uli Schad in aller Stille offenbar gut vorbereitete,
allgemeine bewaffnete Lands gemeinde der Landschäftler in Liestal
derart überrascht, dass sie nicht die geringsten polizeilichen oder militärischen
Vorbeugungsmassnahmen mehr zu treffen vermochte. Der
Basler Rat konnte nur noch durch Eilpost dem Rat und den Schultheissen
von Liestal, sowie einigen Landvögten, befehlen, sich sofort
an die Landsgemeinde zu begeben, «sie zu versichern, dass keine gefährlichen
Anschläge vorhanden seien, auf die jüngsten gnädigen Resolutionen
hinzuweisen und mit den Strafen Gottes und der Obrigkeit
zu drohen». Aber nur einer der beiden Schultheissen, der offene Parteigänger
der Basler Herren, Imhoff, sowie nur ganz wenige Räte gehorchten
dem Befehl. Als sie, in Begleitung der Landvögte Eckenstein
von Farnsburg und Pfannenschmied von Waldenburg, auf dem alten
Markt zu Liestal erschienen, wimmelte alles von schwerbewaffneten
Männern, «mit Ober- und Untergewehr». Sie konnten sich angesichts
der drohenden Haltung der Menge nur eiligst ihres Auftrags entledigen
und nahmen dann Reissaus.
Dann erst wurde, nach Heuslers Bericht «mit kniefälligem Gebet»,
die Landsgemeinde eröffnet. «Hauptredner waren Isaak Bowe und Uli
Schad. Ersterer begründete den Abschluss des Bundes (von Sumiswald)
unter grossem Beifall des Volkes: die Anwerbung fremder Völker,
die Verbindung der Regierungen gegen die Untertanen, der Zug
nach Aarau, die darauf erfolgten schweren Drohungen der Nachbarn
gegen die Landschaft, der Zug nach Liestal, als sie infolge der Zugeständnisse
die Waffen niedergelegt und sich zu christlicher Begehung
der heiligen Zeit und des evangelischen Bettags rüsteten, die Besetzung
der Tore von Liestal durch die Basler, das Alles wurde zur Rechtfertigung
des Bundes angeführt.» «Von Uli Schads Rede wird erwähnt,
dass er das Volk durch das Vorgehen aufzureizen versucht habe, es
seien falsche Briefe der Obrigkeit gefunden worden, wodurch sie das
Volk gänzlich zu unterdrücken suche; diese Briefe werde er nach Beschwörung
des Bundes zeigen.»
Was unter diesen «falschen Briefen» zu verstehen sei, ist nie aufgeklärt
worden, obschon sie bei den späteren Verhören eine grosse
Rolle spielten. Vermutlich handelte es sich nicht um «gefälschte»
Briefe im eigentlichen Sinn, sondern um aufgefangene Korrespondenzen
der Herren untereinander, deren Inhalt —wie der so mancher
anderer, von den Berner und Luzerner Bauern aufgefangener Briefe —
das Aufgebot der Herrentruppen betraf; ein solcher Inhalt aber bewies
den Bauern die Falschheit und Hinterlist, die in der ständigen Versicherung
der Herren lag, «dass keine gefährlichen Anschläge vorhanden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 336 - arpa Themen Projekte
Der Bundesschwur in Huttwil am 30. April 1653
Volkstümliche Darstellung aus dem Schweizerischen Bilderkalender
des Jahres 1840 von Martin Disteli.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 336 - arpa Themen Projekte
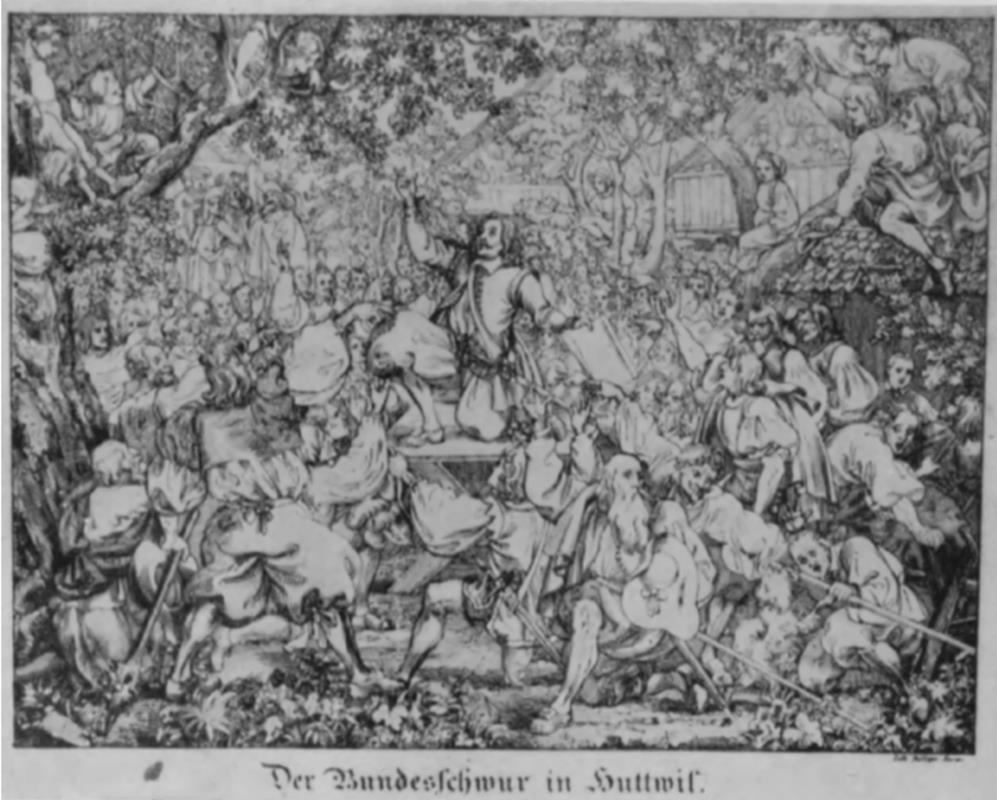
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 337 - arpa Themen Projekte
seien», — eine Versicherung, die ja soeben wieder vom Basler
Rat durch den Mund Imhoffs der Landsgemeinde selbst abgegeben
worden war. Nach der Aussage einer Wirtin in Niederbuchsiten habe
Uli Schad «einmal vier Tage in ihrem Wirtshaus in einer absonderlichen
Kammer geschrieben, welche Schreiben er hernach bei der Landsgemeinde
herausgezogen und gesagt, da sehe man, was sie für eine
Oberkeit haben, sie wollen Alles verderben mit fremden Völkern». Das
ist ein ziemlich klarer Hinweis auf den Inhalt dieser «falschen Briefe».
Und das viele Schreiben Uli Schads in der «absonderlichen» (d. h. einfach
abgesonderten) Kammer wird ein Abschreiben der ihm in Niederbuchsiten
von den Luzernern und Oltenern zu diesem Zweck überlassenen
erbeuteten Originalschreiben der Herren gewesen sein; denn
es ist in den späteren Verhören auch von «dergleichen Briefen 7 zu
Olten», sowie davon die Rede, es sei bei «Aufsetzung» eines der erwähnten
Briefe «nichts gethan» (d. h. nichts hinzugetan) worden,
«sondern es sei derselbe, seines Behalts, von einem Luzerner aufgesetzt
worden». Und jedenfalls beweist diese Bemühung Uli Schads,
dokumentarische Beweise für die immer verstärkt auftretenden Gerüchte
wegen «Ueberfalls fremder Truppen» in die Hände zu bekommen,
nichts anderes als die Ernsthaftigkeit seiner revolutionären Gesinnung.
Nun schritten die Basellandschäftler in Liestal zur Beschwörung
des Sumiswalder Bundes. Zunächst verlas niemand anderes als der
heimliche Spion des Basler Rates, der Stadtschreibergehilfe J. J. Stähelin,
den Sumiswalder Bundesbrief. Als man aber zur Beschwörung
schreiten wollte, machten die verwirrten und unschlüssigen Liestaler.
Bürger solche Schwierigkeiten, dass es zu Drohungen seitens der Bauern
und zu einer höchst ergötzlichen Szene kam. Heusler berichtet:
«Sowie aber die Liestaler keinen Abgeordneten nach Sumiswald geschickt,
so wollten sie auch jetzt noch von Beschwörung des Bundes
nichts wissen. Sie kehrten vor Ableistung des Eides in das Städtlein
zurück. Die Waldenburger aber begehrten ihren Beitritt unter Drohung,
Alles zu verheeren. Vergeblich verlangten die Bürger einen Tag
Bedenkzeit; sie versammelten sich dann mit Ausschluss des Rates auf
dem Rathaus und liefen bald darauf ,wie die Schweine'» — so erzählte
es der Schlüsselwirt Samuel Merian von Liestal, einer der Führer des
Aufstandes in der Stadt — «zum Tore hinaus und schwuren den Eid
zu den Waldenburgern»! Was die Bürger in der Versammlung auf
dem Rathaus «mit Ausschluss des Rates» so erschüttert hat, dass
sie alsbald «wie die Schweine» zur Eidesleistung liefen, das ist das
Geheimnis der Geschichte geblieben. Vielleicht hat ihnen dort der
Schultheissensohn Hans Gysin die nötigen Beine gemacht.
Aber auch ein weiteres Bocksspiel bei dieser Eidesleistung können
wir uns nicht mitzuteilen versagen, weil es eine der traurigsten Figuren
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 338 - arpa Themen Projekte
ergötzlich in den Vordergrund stellt. Es betrifft den «getreuen Beamten»
Untervogt Jakob Wirz von Buus, der uns bereits als Hauptsaboteur
der bäuerlichen Begehren bei Gelegenheit der ersten «Supplication»
in Basel am 9. April, sowie als tapferer Ausreisser vor der Volksstrafe
beim Landsturm in der Nacht vom 16./17. April begegnet ist.
Jakob Wirz war mit der Gruppe Imhoffs und der Landvögte, die den
Auftrag der Regierung ausrichtete, bei der Landsgemeinde vor dem
Tor erschienen. «Er war», wie Heusler nach dem eigenen Bericht des
tapferen Herrendieners erzählt, «um Misshandlungen zu entgehen, mit
den Landvögten in das Städtlein zurückgekehrt, wo er, weil auch die
Bürger (!) über ihn ergrimmt waren, Todesangst ausstand (!). Dann
kam sein Tochtermann, mit der Kunde, es seien schon 30 Musquetiere
als Vortrab bestellt, Andere würden folgen und ihm sein Haus plündern,
oder gar verbrennen, wenn er sich nicht einstelle, um zu Gnaden
angenommen werden. Er fragte die Landvögte (!), was er tun solle,
und diese rieten ihm zu gehen, ein gezwungener Eid sei Gott leid. Mit
weinenden Augen (!) nahm er von den Herren Abschied und kam unter
Bedeckung (!) nach dem alten Markt. Er wurde vor den Tisch geführt,
auf dem Uli Schad stand, und nachdem er auf denselben gestiegen,
erklärte ihm Schad die Bedeutung des Bundes, ,zu dem sie
niemand zwingen wollen'. Wirz erklärte seine Zustimmung, bat um
Verzeihung und leistete den Eid.» (!)
Auf diese Weise wurde noch eine ganze Reihe anderer «getreuer
Beamter» ins echt bäuerlich-spöttische und handgreifliche Gebet genommen.
«Der Eid wurde knieend geleistet, der Amtspfleger Gysin von
Höllstein erteilte ihn den Beamten, der 75 jährige Amtspfleger Heinrich
Giegelmann, Arxmeyer (Meyer auf dem Arxhof), dem Volke;
neben ihnen und den schon Genannten stand als Redner für Liestal
Hans Brödtlin auf dem Tische. Hierauf wurden die Ausschüsse zur
Versammlung nach Huttwil gewählt. Nochmals fiel das Volk auf die
Kniee, Gott um seinen Segen anzurufen, und trat dann den Heimweg
an.»
Am Tag darauf setzten die entschlossensten Führer der aufständischen
Bürgerschaft in Liestal, der Schultheissensohn Hans Gysin,
Heinrich Stutz und der Seilermeister Konrad Schuler, den Liestaler
Rat unter Druck, den Bundeseid auch seinerseits zu leisten: «die Untervögte,
die doch von der Obrigkeit gewählt seien, hätten es ja auch
getan, wie vielmehr der Rat, der freier dastehe und sich selbst ergänze.
Der Rat brachte es dahin, dass ihm der Eid erlassen wurde, doch
musste er versprechen, wenn es das Vaterland antreffe, wolle er bei
ihnen leben und sterben.» Dafür aber brachte in diesen Tagen Hans
Gysin, als «Rottmeister der Frenkendörfer», die sieben Dorfschaften,
die der Hoheit der Stadt Liestal unterstanden, an den Bund.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 339 - arpa Themen Projekte
Inzwischen brachten die Luzerner, und zwar «die von Rothenburg
und Hochdorf», mit Hülfe derer von den oberen Freien Aemtern,
auch die unteren Freien Aemter an den Bund. «Uli Ineichen, Ammann
Lüscher von Gelfingen und der Schuster Brunner von Aesch gingen
nach Samenstorf,. Wohlen, Villmergen, Dottikon und in die übrigen
untern freien Aemter, und» — so berichtet der Herrenchronist Vock —
«sie sparten weder Vorspiegelungen und Verheissungen, noch Drohungen
und Scheltworte, um die Gemeindevorsteher zur Teilnahme an
dem Aufruhre zu bereden oder zu zwingen. Sie schilderten die Herrlichkeit
des neuen Bundes der Bauern, die Schwäche der Regierungen,
was jene, die es mit den Bauern halten, zu gewinnen, und was die,
welche dem Bunde nicht beitreten, zu befürchten haben werden...»
Damit war nun auch das künftige Schlachtfeld des Bauernkriegs in
die Revolution einbezogen.
Kurzum: «der Stolz und Hochmut» der Bauern war, wie Vock
meint, «durch den Bund von Sumiswald» so «ausserordentlich gesteigert
worden», dass sie glaubten, «nicht nur ihrer Obrigkeit, den Kantonen
und Städten der Eidgenossenschaft und den Zugewandten Orten,
sondern auch den Fürsten und Königen, dem römischen und türkischen
Kaiser und der Macht der ganzen Welt Trotz bieten zu können».
Doch damit zeichnet Vock nur die Karikatur nach, die der zeitgenössische
luzernische Landvogt Cysat, unterstützt vom zeitgenössischen
Kaplan Wagenmann von Willisau, in seiner Herrenchronik von den
Bauern in der Zeit nach der Stiftung des Sumiswalder Bundes entworfen
hat.
Gewiss aber ist, dass es nie seit der Gründerzeit der Eidgenossenschaft
eine so stolze, selbstbewusste und tatkräftige Bauernsame in
der Schweiz gegeben hat, wie die vom Sumiswalder Bund befeuerte,
die nun zur zweiten und zur dritten, immer begeisterteren, immer entschlosseneren
Bekräftigung dieses Bundes in Huttwil schritt.
Das war —wie die angeblich bauernfreundliche Solothurner Regierung
am Tag des Bundesabschlusses selbst an die Luzerner Regierung
schrieb —der «Zunder der zu besorgenden mehreren Unruhen
in der ganzen Eydtgenossenschaft», den die Herrentagsatzung zu gleicher
Zeit «aus der Wurzel zu exstirpieren» (auszurotten) sich anschickte.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 341 - arpa Themen Projekte
XV.
Zweites Stück vom eidgenössischen Zwischenspiel —
und das Gegenspiel der Bauern in Huttwil
Am 29. April trat der Herrenbund zu seiner Tagsatzung in Baden
zusammen und tagte bis zum 10. Mai. Am 30. versammelte der Volksbund
seine 2 bis 3000 —nach Vock «ungefähr 5000» -—Ausgeschossenen
und Parteigänger aus zahllosen Gemeinden für einen Tag in
Huttwil. Aber Leuenberger und sein zahlreicher Stab von Schreibern,
Boten, Räten und Kriegsräten stellten in der ganzen Zwischen- und
Folgezeit eine Art von ständigem Bauernparlament dar — ein fliegendes
Parlament gewissermassen, das immer da seinen Platz hatte, wo
der Obmann sich gerade aufhielt. Und so bildete sich für mehr als
einen vollen Monat —d. h. für den ganzen Rest der Zeit, in der die Bauernfreiheit
sich so gewaltig wie nie vorher entfalten konnte, bis zur
Katastrophe —ein Verhältnis zwischen Herrenbund und Volksbund
heraus, das dem zwischen zwei souveränen Mächten zum Verwechseln
ähnlich sah. Mehr und mehr wurde dabei Leuenbergers Person von seiten
der Herren gewissermassen als Vorort des Volksbundes anerkannt,
an den sich jede Regierung zu wenden hatte, wenn sie beim Bund als
Ganzem oder bei seinen Einzelgliedern etwas erreichen wollte, ja, an
den sich sogar die Vertreter einer ausländischen Macht direkt wandten.
Daneben behielt jedoch Hans Emmenegger, mit seinem Entlebucher
und Willisauer Stab, seine bisherige Stellung an der Spitze der zehn
Aemter im Verkehr mit der Luzerner Regierung bei, ohne im übrigen
als «General-Oberster» des Gesamtkriegsrats der Bauern von vier Kantonen
irgendwie hervorzutreten; ja es scheint fast, als habe er diese
Funktion Leuenberger stillschweigend und neidlos überlassen.
Bereits am 28. beschloss der Rat von Zürich als Vorort der Herrentagsatzung,
«usa anlaass der Purenzusammenkunfft in Huttwil an
sie ein Schryben abgahn ze lassen» — und also gewissermassen die
offiziellen diplomatischen Beziehungen mit dem als «hochverräterisch»
verfemten Bauernbund aufzunehmen! Damit wurde ein Doppelspiel
hochoffiziell auf eidgenössischen Boden verpflanzt, das bisher nur von
den einzelnen Regierungen ihren direkten »Untertanen» gegenüber geübt
worden war; etwa auch zwischen dem Vorort und einzelnen Personen
oder lokalen Ausschüssen, wie soeben zwei Tage zuvor in dem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 342 - arpa Themen Projekte
Man machte zähneknirschend viele fromme Sprüche, gab Ermahnungen
zu Treue und Gehorsam, die man mit versteckten Drohungen
spickte, schrieb freundliche Briefe und machte darin halbe Zusagen,
beteuerte die väterliche und vaterländische Wohlmeinendheit
und Fürsorge für das gemeine Volk und stellte vor allem jedes «Ueberziehen
mit fremden Truppen» hochheilig in Abrede —während man
zu derselben Zeit fieberhaft rüstete und militärische Pläne schmiedete,
zu dem einzigen Zweck, die so mächtig wieder aufgestandene Bauernfreiheit
diesmal völlig und für immer mit dem Schwerte auszurotten!
Gewiss hat man dabei anfänglich gehofft —schon weil das billiger
und bequemer war —, die Bauernfront durch «friedliche» Mittel korrumpieren
und zersetzen und das Endziel schliesslich auch ohne Einsatz
wirklich kriegerischer Mittel erreichen zu können. Aber sehr bald,
schon während der nun folgenden Tagsatzung, wurden die «friedlichen»
Mittel auch auf eidgenössischem Boden bewusst und schamlos
nur noch als Nebelwand verwendet, um die Bauern zu täuschen, Zeit
zu gewinnen und Absicht und Stärke des militärischen Einsatzes so
lange wie möglich zu tarnen. Kurz, man hat gegen das eigene Volk
wie gegen erklärte auswärtige «Landesfeinde» gehandelt —ein Ausdruck,
der in dem am 7.-10. Mai von dieser Tagsatzung geheim beschlossenen
«Defensionalwerk», so wie es Peter aus Werdmüllers Papieren
referiert, in der Tat auf die Bauern angewendet worden ist.
Allein gerade der Umstand, dass jetzt nicht nur eine militärisch
so schwache Einzelregierung wie etwa die luzernische oder gar die
solothurnische, sondern die zentrale Instanz der gesamten Herren-«Eidgenossenschaft»
sich genötigt sah, die Maske des «Friedens» und
der rührseligsten «Wohlmeinendheit» aufzusetzen, zeigt wie nichts
anderes den Umfang und die Stärke des Umschwungs aller Verhältnisse
zugunsten der Bauern, wie er sich zwischen der März- und der
Mai-Tagsatzung durchgesetzt hatte. Man darf gar nicht an die zornwetternde
Dreh- und Einschüchterungssprache des Mandats vom
22. März, die man damals noch für möglich und wirksam hielt, zurückdenken,
wenn man jetzt den ersten Brief des Vororts an den Bauernbund
liest! Da heisst es jetzt: «Wir müssen mit besonderem herzlichen
Bedauern vernehmen, welch grosses Misstrauen ihr habet und
dass Ihr glaubet, Eure gnädigen Herren und Oberen wären allseitig
gesonnen, wider Euch fremde Truppen ins Land zu lassen...» (Wobei
übrigens auch mit dem Begriff «fremde Truppen» ein. täuschendes
Spiel getrieben wird, als ob es sich dabei nur um ausländische Truppen
gehandelt hätte; während die Bauern, wie die Herren genau wussten,
in allen gegen sie durch gegenseitige Verabredung der Herren aufgebotenen
Truppen «freunde Truppen» sahen, wie die Auswirkung des
Aarauer Zuges der Basler Truppen auf die Bauern zur Genüge bewiesen
hatte!) Da wird nun nicht mehr gewagt, den Bannstrahl des göttlichen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 343 - arpa Themen Projekte
gegen die hochverräterische und malefizische «Zusammenrottung»
in einem Bauernbunde zu schleudern — sondern nur noch
schüchtern bemerkt, dass wegen der «verluthenden verbüntlichen Unterredung
allersiths oberkeiten in unglyche Gedanken wachsind»
«Weil aber aus solchen ,misstrauwischen' Veranstaltungen leicht in
unserem allgemeinen Vaterland ein grosser Jammer und unwiederbringlicher
Schaden entstehen möchte, hat die uns obliegende hohe
Sorgfalt für das gemeine Ruhwesen den treuherzigen Eifer in uns erweckt,
Euch durch dieses unser mit eigenem Läuferboten abgefertigte
Schreiben, um Euer Aller und Eurer lieben Weiber und Kinder Heils
und um Eurer Wohlfahrt willen ganz wohlmeinend und freundlich zu
ersuchen, Ihr möget dem ,ungleichen Geschrei, dass frömdes Volck
wider Euch ins Land komme' (sic!), keinen Glauben schenken...,
sondern uns sicher zutrauen wolle!, dass wir gesinnt, vermittelst der
Hilf und Gnade Gottes auf der künftigen Dienstag beginnenden eidgenössischen
Tagleistung (Tagsatzung) mit Euern allerseits Gnädigen
Herren und Oberen in aller Gebühr und Freundlichkeit ,dahin ze reden
und ze handeln, dass sie Euch mit würcklicher Zustellung Brieff und
Siglen umb dassjenige, das sie Euch albereit zu danckbarem vernügen
bewilligt', und auch durch anderweitige gnädige Versicherungen alles
Misstrauen und unbegründete Sorgen frömbder Truppen und anderer
Dinge halber, gäntzlich stillen und benommen werden...» Usw. Aber
eine Einladung an die Huttwiler Landsgemeinde, eine Abordnung an
die Tagsatzung zu senden, enthielt der Brief nicht.
Der «eigene Läufersbote», durch den der Rat des Vororts dieses
Schreiben an die Huttwiler Landsgemeinde sandte, war übrigens ein
notorischer Spion der Zürcher Regierung, «Meister Rudolf Berner,
Metzger». «Dieser Rudolf Berner», sagt Peter, «wurde vom Zürcher
Rat wiederholt als Kundschafter verwendet...» «Kundschafter» heisst
er bei diesem Herrenchronisten deshalb, weil er ein Spion der Herren
war. Auch diesmal wurde er «mit dem Auftrag bestellt: ,im Land und
in der Landtsgemeind allerley ze fragen'...»; natürlich gegen Bezahlung,
die Peter aus der Zürcher Seckelamtsrechnung genau errechnet
hat. Und diesem Spion und «Läufersboten» gab der Rat einen Geleitbrief
seitens der willigen beiden Untervögte Lüscher und Kuli aus der
Grafschaft Lenzburg mit, die sich wie wir gesehen haben, eben in
Zürich aufhielten.
Es ist höchst charakteristisch für den Grad der Verachtung, den
die Herren trotz allem zugesicherten «treuherzigen Eifer» gegen die
Bauern im Busen hegten, dass die hohe Tagsatzung sich ihr Wissen
über den Verlauf der Huttwiler Landsgemeinde und über den Inhalt
ihrer Beschlüsse ausgerechnet durch diesen bezahlten Spion vermitteln
liess! «In der Sitzung vom 1. Mai», so berichtet Peter nach den Zürcher
Akten, «teilte Bürgermeister Waser mit, was ihm der Zürcher
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 344 - arpa Themen Projekte
war, über die Landsgemeinde zu Huttwil berichtet hatte.» Das Bild,
das Waser der Herrentagsatzung auf dieser Grundlage von der Bauerntagsatzung
in Huttwil entworfen hat, ist darum entsprechend dürftig
und höchst lückenhaft. Dennoch enthält der Bericht des Metzgers
Berner Einzelheiten, die umso aufschlussreicher sind, als sie ein Herrendiener
berichtet. Ihn selbst, erzählt Berner, «hätten die Bauern mit
grosser Zuvorkommenheit behandelt», hätten ihn «allzeit darby sitzen
lassen, damit er ire Procedur sehen und referieren könne»; «auch
habe ihm Notar Brenner eine Skizze der Hauptbestimmungen des Huttwilerbundes,
die im wesentlichen mit dem Tenor des Bundesbriefes
übereinstimmen, zuhanden des Zürcher Rates übergeben». Die Bauern
waren also die wahren Gentlemen!
Die erste Huttwiler Lands gemeinde vom 30. April war in Sumiswald
zweifellos in erster Linie als Gegenkundgebung gegen die bevorstehende
Herrentagsatzung beschlossen worden. Denn schon seit dem
16. lagen die Einladungsschreiben zu dieser letzteren bereit, und am
21. waren sie versandt worden; man kannte das Datum in Sumiswald
also bereits genau. Den Bauernführern lag daran, die Bauernmassen
gegen die von allen Seiten auf sie lauernden Zersetzungsversuche der
Herren fest zu machen, ihnen das Rückgrat zu stärken, ihr Selbstbewusstsein
und ihr Selbstvertrauen zu steigern. Wie hätten sie das
besser gekonnt als dadurch, dass sie den Bauern deren eigene, in Sumiswald
beschlossenen Organe in öffentlicher Funktion vorführten!
Zwar konnten nach so kurzer Zeit und nach einem einzigen Verhandlungstag
auf der ersten Huttwiler Gemeinde naturgemäss noch
nicht alle Organe und noch nicht alle Funktionen derselben in Erscheinung
treten. Aber zweierlei machte sie zum spezifischen — bewusst
gewollten — Gegenbild der eidgenössischen Tagsatzung. Einerseits
betonte man den gemein-eidgenössischen Charakter der Landsgemeinde
dadurch aufs schärfste, dass man die spezifisch bernischen
Traktanden klar ausschied und dem, allerdings am stärksten vertretenen,
bernischen Teil der Landsgemeinde — «ihre allgemeine Stellung
in eine Kantonallandsgemeinde verändernd», sagt Vock —-zur Sonderbehandlung
überwies; ein charakteristischer Unterschied zu Sumiswald.
Zweitens aber «verwandelte sich die Versammlung», zur richterlichen
Erledigung ganz konkreter Fälle, «das Beispiel der Eidgenossen
zu Baden nachahmend, in ein Syndikat und Bussengericht». Damit
demonstrierte man eindrucksvoll zum erstenmal praktisch die eigene
Gerichtshoheit, die der Bauernbund in Sumiswald theoretisch proklamiert
und der Gerichtshoheit der Einzelregierungen wie derjenigen der
Tagsatzung aus eigener Machtvollkommenheit, als Recht der Bauernklasse
auf eigene Rechtsprechung, entgegengestellt hatte. Das war
darum der revolutionärste Akt der ersten Huttwiler Landsgemeinde, war
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 345 - arpa Themen Projekte
der Bauern zu heben und gleichzeitig die eigene Souveränität
der Tagsatzung gegenüber vor dem ganzen Land in helles Licht
zu stellen. Sie sprechen Recht —und keine Macht der Herren kann
sie daran hindern! Also sind sie die wahren Herren! Das musste die
Schlussfolgerung weitester Kreise des Schweizervolkes sein.
«Ueber Erwarten schwach an Zahl» sollen nach Liebenau die
Bauern in Huttwil zusammengetreten sein — «man zählte nur (!) 2000
bis 3000 Mann.» Also «nur» zwei- bis dreimal soviele — und zwar
grossenteils Ausgeschossene, d. h. spezifische Willensträger der Bauern
—wie erst acht Tage vorher in Sumiswald! Das genügt uns, um gerade
umgekehrt den gewaltigen Fortschritt zu erkennen, den die Bauernbewegung
in bloss acht Tagen gemacht hatte. Sie strömten aus vier
Kantonen in dem schön auf den Nordausläufern des Napfmassivs gelegenen
kleinen Landstädtchen zusammen, das das natürliche Bindeglied
zwischen Willisau und Sumiswald ist; es liegt von beiden Orten
ziemlich genau gleich weit, d. h. nicht mehr als zwei bis drei Fussstunden
entfernt. Ein tapferes Städtchen, dieses Huttwil — es hatte
bereits am meisten Berner zum Bundesschwur nach Wolhusen geschickt,
und seither hatte es seinem Bürgermeister Friedrich Blau,
einem ausgepichten Herrenspion, die Hölle so heiss gemacht, dass er
längst seine Zuflucht bei den Junkern in Bern selbst hatte nehmen
müssen, die ihn ja auch sofort zum Stadtbürger machten.
In diesem Passtädtchen erschienen am 30. früh viele von der
Bauern- und Bürgerelite, die bereits in Sumiswald gewesen waren,
wieder; manche von ihnen freilich, besonders Entlebucher und Willisauer,
waren, wie wir sahen, gerade in diesen Tagen auf grosse Werbereisen
in die Urkantone und bis an den Bodensee und in den Tessin
geschickt worden. Aber Hans Emmenegger, und Niklaus Binder und
der Schulmeister Müller waren wieder da. Dazu sehr viele neue Ausschüsse
und neugewonnene Parteigänger. Zahlreiche erschienen zu
Wagen oder hoch zu Ross, z. B. die Basler: «Bei dieser Gemeinde», berichtet
Heusler, «erschienen auch zwanzig Basler, alle zu Pferd, an
ihrer Spitze Uli Schad und Isaak Bowe, aus Liestal erschienen Feldmüller
Senn und Jakob Singeisen, Schmied.» Die Elite der Berner Bauernführer
war umso vollzähliger, als auch eine bernische Kantonallandsgemeinde
mit diesem Tag verknüpft werden sollte.
Zum erstenmal erschienen auch Ausschüsse aus dem Oberland,
jedoch bloss als Beobachter und als «Vermittler». Gern wüsste man
mehr darüber, wer das gewesen ist und wer sie zu «Vermittlern» bestellt
hat. Bögli sagt nur: «Die oberländischen Abgeordneten aber,
welche sich zur Beschwichtigung ihrer Nachbarn eingefunden hatten,
richteten nichts aus, was der Castellan von Wimmis, Hans Jakob Dübelbeis,
am 5. Mai der Regierung anzeigte.» Diese Nachricht lässt Zweifel
zu, ob es sich bei diesen Oberländern nicht um von der Regierung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 346 - arpa Themen Projekte
Gewissheit, wenn wir näher zusehen, wie die Bauernbündler in Huttwil
selber auf diese Leute reagiert haben. Liebenau erzählt über deren
Empfang —übrigens nach derselben Relation des Wimmiser Castellans,
der wohl der von der Berner Regierung zur Organisierung dieser
Diversion Beauftragte war —: «Obwohl sie sich den Anschein gaben (!),
sie seien geneigt, dem Bunde beizutreten» (das ist ganz das Benehmen
von Lockspitzeln!), «fragte man sie spöttisch, warum sie nicht
früher gekommen seien?... Von Musketieren bewacht, wurden sie
barsch angeredet», ja «höhnisch behandelt». Die Bauern haben sie also
als Klassenverräter erkannt! Und was ihre «Vermittlung» betrifft:
«Man sagte ihnen, zuerst müssen sie eidlich zum Beitritt zum Bauernbunde
sich verpflichten, dann erst könnten sie zu den Verhandlungen
zugelassen werden. Von Vermittlung wollten die Bauern nichts wissen:
,sie wollen keine Schidungslüt, weder Herren noch Buren ganz
Nut in der Eidgenossschaft darzu nit gebruchen'.»
Es scheint, dass die Bundesurkunde auf diesem ersten Huttwiler
Tag nicht nochmals beschworen, sondern «bloss abgelesen und durch
offenes Handmehr abermals bestätigt» wurde. Allerdings geschah dies,
nach dem Bericht des Metzgers Berner an die Tagsatzung, in religiös
gehobener Form: «weilen man in dissem einhellig war», so «seien um
drei Uhr nachmittag alle von Leuenberger ermahnt worden, auf die
Knie niederzufallen und ein Vaterunser zu beten». «Nachdem solches
erfolget, der bundt mit grossem yffer und Solemnitet beschechen.» Ferner
scheint es —Sicheres wissen wir darüber sehr wenig —, dass erst
hier die zwei Artikel abgemehrt und hinzugefügt wurden, nach denen
1. alle zehn Jahre der ewige Bund neu bechworen, 2. bei dieser Gelegenheit
über die Amtsführung aller Amtsverwalter (Landvögte) in der
Zwischenzeit Gericht gehalten werden sollte. Diese Artikel sollen, nach
Liebenau, von Emmentalern aus Arch und Leuzingen vorgeschlagen
worden sein. Dabei soll ein dritter, «allzu sozialistischer» Artikel abgelehnt
worden sein, der bestimmte: «bis zu Austrag des Handels sollen
Zehnten, Boden- und Geld zinse nicht entrichtet, nachher aber auf die
Hälfte reduziert werden». Wenn dem so ist, so trägt dieser «allzu sozialistische»
Artikel echt eritlebuchisches Gepräge. .Jedenfalls haben sich
die Entlebucher diesen Artikel gemerkt und auf ihrer drei Tage später
abgehaltenen Landsgemeinde einstimmig zur Annahme gebracht. Sie
marschierten also der Sache nach unentwegt an der Spitze der Bewegung,
obwohl der Form nach Leuenberger führte.
Die Verlesung des oben mitgeteilten Schreibens des Vororts vom
28. an die Huttwiler Landsgemeinde hat zweifellos wesentlich dazu
beigetragen, das Bewusstsein der Bauern von der gemeineidgenössischen
Bedeutung ihres Unterfangens zu stärken. Die Antwort gab man
dem Metzger-Spion gleich mit. Sie war nichts als eine höfliche, aber
entschiedene Bestätigung eben des verfemten Bundes, von dem der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 347 - arpa Themen Projekte
abgemahnt hatte. Diese Antwort war übrigens nicht an die Tagsatzung,
sondern an den Zürcher Rat gerichtet. In diesem Zusammenhang ist
von Interesse, was der Metzger Berner tags darauf der Tagsatzung berichtete:
«Zuerst wurde eine Umfrage gehalten, ob man Delegierte an
die Tagsatzung abordnen wolle oder nicht; man fasste darüber keine
Resolution.» Die Bauern wollten also zweifellos nicht mehr von sich
aus an die Tagsatzung herantreten und niemandem dafür Vollmacht
erteilen.
Noch schmeichelhafter für die von den Bauern nunmehr erkämpfte
gesamteidgenössische Bedeutung ihres Bundes war die Tatsache,
dass der französische Botschafter De la Barde — der bereits inoffizielle
Beobachter zum Spionieren an die Sumiswalder Landsgemeinde
geschickt hatte —sich nun in einem Schreiben offiziell an die
Huttwiler Landsgemeinde wandte. «Der Gesandtschaftssekretär und
Dolmetscher Baron» — so berichtet Vock — «überbrachte der Landsgemeinde
ein vom 29. April datiertes Schreiben des französischen Botschafters
de la Barde.» Noch «ein anderer vornehmer Herr» war, nach
Peter, dabei, namens Vigier. Damit mischte sich Frankreichs Gesandter
— durchaus im Interesse der Schweizer Herrenpartei und ganz und
gar nicht aus der ihm von unseren Geschichtschreibern (mit ihrem
Heros Waser) immer wieder angedichteten «Sympathie für die Bauern»
— in die grosse Auseinandersetzung zwischen Volksbund und
Herrenbund. Das geht schon aus dem Hauptanliegen seines Schreibens
hervor, das nach Vock darin bestand, dass der Gesandte «die Landleute
zum Frieden und Gehorsam gegen die Regierungen ermahnte»
und sie «beschwor, ihr Vaterland, ihre Weiber und Kinder vor Verderben
zu bewahren...» Er suchte sie dabei durch den Hinweis auf
«alle Greuel und Schrecknisse bürgerlicher Unruhen und Zwistigkeiten
aus Frankreichs neuesten Leiden und Erfahrungen», ja sogar
durch ein richtiges Greuelmärchen einzuschüchtern: durch die aus der
Luft gegriffene Behauptung, dass zum Zweck des Ueberfalls über die
«durch inneren Zwist geschwächte» Schweiz «wirklich schon der Erzherzog
Leopold, Feldherr des spanischen Heers und Spaniens Statthalter
in den Niederlanden, auf der Post in Saverne (also nahe der
Schweizergrenze) eingetroffen sei».
Durch diesen Hieb auf Spanien-Oesterreich, den Hauptrivalen
Frankreichs bei der ewigen Erpressung der Schweiz zu «Bündnissen»,
d. h. Söldnerverträgen, zog sich De Ja Barde zwar die Wut der kaiserlich-spanischen
Partei in der schweizerischen Herrenklasse zu, und
die war zur Zeit durchaus die mächtigere und wusste den Abschluss
eines neuen Soldbündnisses mit Frankreich in der Tagsatzung schon
seit zwei Jahren, seit Ablauf des alten Bündnisses anno 1651, immer
auf's neue zu hintertreiben — und dies auch fernerhin, bis ins Jahr
1663. Andererseits aber durfte De la Barde hoffen, wenn ihm die «Vermittlung»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 348 - arpa Themen Projekte
grosses Verdienst um die Herrenklasse der Eidgenossenschaft insgesamt
zu erwerben, dass dann die französische Partei in dieser obenauf
gekommen und es ein Leichtes gewesen wäre, ein neues Soldbündnis
mit den jetzt fortwährend vergeblich bestochenen Schweizerherren
abzuschliessen!
Der französische Gesandte hat dieses raffinierte Interessenspiel
mit dem Brief an die Huttwiler Landsgemeinde in vollem Einverständnis
mit dem Berner Rat eingefädelt, in dem die französische Partei ausschlaggebend
war, an der Spitze Sigmund von Erlach, zu dieser Zeit
der bestbezahlte Hauptspion Frankreichs in der Schweiz. Die Zuschrift
De la Barde's vom 29. April an die Huttwiler Landsgemeinde nämlich
ist, nach Peter, «laut Bericht des Berner Rates an seine Gesandten in
Basel» (soll wohl heissen: in Baden) «auf eine Anregung des Berner
Rates selbst erfolgt, der den französischen Gesandten zur ,weiteren
Einschlachung disponiert' hatte.., und wohl auch seine spätem Beziehungen
zu den Bauern führern beruhen einzig auf diesem Gesuch
um Vermittlung»!
Zu gleicher Zeit war im Zürcher Rat die kaiserlich-spanische Partei
ausschlaggebend, und das war einer der geheimen Hauptgründe
der ewigen Rivalitäten zwischen Zürich und Bern, die trotz des gemeinsamen
Herreninteresses beider Stände sogar während dieses Bauernkriegs
nicht aufhörten. Das erklärt, warum selbst der Bürgermeister
Waser, der sich so viel auf seine Freundschaftsdienste für die Berner
Herren zugute tat, ganz im Gegensatz zu deren Einverständnis mit
dem französischen Gesandten der Meinung Vorschub leistete — wie
Liebenau formuliert —, «die Bauern seien durch den französischen
Ambassador heimlich aufgehetzt worden und der Bauernkrieg bilde
nur eine Episode in dem Streite der französischen und spanischen
Partei»! Bis es schliesslich — und zwar eben durch solchen Druck, den
Frankreich nur durch Gold aufwiegen konnte diesem selben Herrn
Waser im Verlauf weniger Jahre gelang, seinerseits der Favorit und
bestbezahlte Spion Frankreichs zu werden! Womit dann endlich das
seitens Frankreichs so zäh erpresste neue Soldbündnis (1663) auf Kosten
des Schweizervolkes zustandekam; während allerdings Waser,
an der Spitze einer riesigen Gesandtschaft von lauter Fürstendienern,
auf Kosten des Königs von Frankreich nach Paris reisen durfte, um
dort seinen Verrat am Schweizervolk in einem Delirium von Festivitäten
ersäufen und seinen Kniefall vor Ludwig XIV. durch Berge von
Gold belohnen zu lassen...
Zum allerersten Anfangsstadium dieses für die Schweiz so ehrlos
verlaufenen Intrigenspiels gehört die vom französischen Gesandten
De Ja Barde mit den Berner Herren abgekartete Intervention bei der
Huttwiler Landsgemeinde vom 30. April 1653. Dessen Warnung vor
dem angeblich unmittelbar drohenden Einfall einer ausländischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 349 - arpa Themen Projekte
machte tiefen Eindruck auf die Bauern. Sie konnten ja nicht wissen,
auf welch verschlungenem Intrigenkampf diese Panikmacherei mit
nun wirklich total landfremden Truppen beruhte. Sie konnten nicht
einmal wissen, dass derselbe Herr Ambassador, der ihnen eben mit
spanischen Truppen die Hölle heiss machte, bereits versprochen hatte,
«der Regierung von Bern...» französische «Kavallerie aus dem Pays
de Gex zur Verfügung zu stellen», wie Peter berichtet. Die Bauern
dachten und fühlten eben echt patriotisch, sie nahmen die Gefahr für
ihr Vaterland ernst, und ein jeder von ihnen, bis zum letzten Mann,
war bereit, Leib und Leben daran zu setzen, solche «fremden Truppen»,
woher sie auch kommen mochten, erst recht aus dem Lande zu
schlagen. So ist ein Wort der Bauern aufzufassen, das die Herrenchronisten
mit Cysat-Wagenmann und Vock immer nur als Beleg für
die grössenwähnerische Prahlerei der Bauern zitieren: «Sie hätten genug
Soldaten, um die ganze Schweiz dergestalt einzuschliessen, dass
keine Maus hineinbringen könne!»
Dennoch krochen die Bauern den Herren nicht auf den Leim der
«nationalen Eintracht», dazu ausgelegt, um von diesen umso ruhiger
verspiesen werden zu können. Sie wollten ihren «Span» mit den Herren
austragen, ehrlich und gründlich —aber schneller sollte es damit
jetzt gehen, damit die Sache zuende gebracht werde, bevor der äussere
Landesfeind Zeit hätte, über sie herzufallen! Das haben die Entlebucher
schon drei Tage nach Huttwil, auf ihrer Landsgemeinde beim
Heiligen Kreuz, eindeutig zum Ausdruck gebracht.
Ja, Leuenberger drehte in dieser Frage schon nach wenigen Tagen
sogar den Spiess um; er schrieb, wie Peter berichtet, an De la Barde:
«Wenn er das Bündnis mit der Eidgenossenschaft erneuern wolle, so
solle er jetzt mit den Bauern unterhandeln, denn bei ihnen liege die
Macht.» Dieses Ansinnen an den französischen Gesandten zeigt auf das
klarste, dass die Bauern erkannten, worum es diesem Diplomaten mit
dem Druck auf die Bauern in Wirklichkeit ging; nur dass sie ihm damit
bedeuteten, es habe keinen Zweck mehr, seine Spekulationen darauf
zu setzen, dass die Herren ihm das Bündnis als Dank für die Hülfe
bei der Unterwerfung der Bauern gewähren würden —vielmehr seien
sie nun die Macht, die anstelle der Herren getreten sei und mit der
man inskünftig Bündnisse abzuschliessen habe! So deutlich wie in diesem
kühnen Brief Leuenbergers tritt wohl kaum in einem anderen
Dokument das Bewusstsein und die heilige Ueberzeugung der Bauern
zutage, dass ihr Bund die wieder geborene Eidgenossenschaft sei.
Dasselbe Bewusstsein tritt auch in der Gerichtsszene in Erscheinung,
die in den Huttwiler Verhandlungen nun folgte. Denn, wenn es
sich dabei auch um eine ausdrückliche «Veränderung» der überkantonalen
Landsgemeinde in eine kantonalbernische handelte, so doch nur
deshalb, weil die abzuhandelnden konkreten Fälle sich auf bernischem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 350 - arpa Themen Projekte
sitzen, ist eindeutig aus dem Sumiswalder Bundesbrief abgeleitet. Womit
zugleich klargestellt ist, dass die Bauern dieses zentrale Recht des
Bundes in konkreter Anpassung an die schweizerischen Realitäten föderalistisch
anzuwenden gedachten.
Diese Gerichtsszene trug sich nach Vocks Bericht folgendermassen
zu: «Zuerst wurde Hauptmann Rummelt von Bern, um dessen Loslassung
die nach Baden reisenden Gesandten der Regierung einige Tage
vorher umsonst gebeten hatten, mit seinen Begleitern vor die Landsgemeinde
geführt, von Leuenberger befragt und verhört, und endlich
Rummelt mit den andern losgesprochen und freigelassen; nur Einer
wurde zurückgehalten, der gedroht haben sollte, seine Herren von
Bern werden die Emmentaler für diese Gefangennehmung gebührend
züchtigen. Diesem banden die Bauern einen Strick um den Hals, und
fragten den Leuenberger, ob sie ihn aufhängen sollen; Leuenberger
aber befahl, man solle ihn bis zur künftigen Landsgemeinde gut bewachen.
Er ward erst am 29. Mai, nach Abschluss des Vergleichs mit
der Regierung, wieder in Freiheit gesetzt. Nun kam die Reihe an die
berühmtgewordenen Schiffleute, die ebenfalls von Leuenberg examiniert,
und da sie sich mit gänzlicher Unwissenheit dieser Angelegenheit
entschuldigen konnten, sogleich auf freien Fuss gestellt wurden.
Leuenberger gab ihnen sogar zu sicherer Fortreise einen Geleitbrief,
der ihnen aber wenig half; sie wurden auf der Reise von acht Bauern
angefallen, die sie durchprügelten und ihnen ihre prachtvollen Bärte
so boshaft wegschnitten, dass sie wie Affen aussahen; so misshandelt,
mussten sie froh sein, lebendig dem Grimme der Bauern entronnen zu
sein.»
Dem wäre noch hinzuzufügen, was der Zürcher Metzger-Spion
Rudolf Berner (nach Peter) tags darauf der Badener Tagsatzung über
die Beurteilung der Schiffsgeschichte in Huttwil berichtete: er sei
«unter anderem noch Zeuge davon gewesen, wie ein Entlebucher Bauer
eine solche Kugel» (d. h. eine der 200 Handgranaten, die von der Berner
Regierung auf der Aare nach Aarburg geschickt werden sollten)
«auf einer Stange in die Höhe streckte und dabei, unter Anspielung
auf die Bezeichnung der Fässer..., mit lauter Stimme rief: ,Das ist
der süesse wyn, der unss von Bärn zuegeschickt worden'.» Die Entlebucher
sind also auch beim bernischen Teil der Huttwiler Landsgemeinde
zugegen gewesen; eine der dort vorgewiesenen Handgranaten
haben sie dann nach Heilig Kreuz mitgenommen und sie dort der
Landsgemeinde in derselben Weise vorgewiesen.
Die Wirkung der von den 3000 Huttwiler Boten im ganzen Land
verbreiteten Kunde von den Vorgängen auf der Landsgemeinde muss
eine sofortige und ausserordentliche gewesen sein. Denn schon am
1. Mai liefen bei der Tagsatzung in Baden Nachrichten von einer gefährlichen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 351 - arpa Themen Projekte
Dulliker klagte über die Zustände im Kanton Luzern. Die Gesandten
Basels, die Ratsherren Falkner und Beck, berichteten, «die Verhältnisse
auf der Landschaft hätten sich sehr verschlimmert». Von Solothurn
gaben der Venner Johann Jakob vom Staal und der Gemeinmann
Urs Gugger ein unerwartet düsteres Bild: alle Untertanen seien
schwierig» geworden: «die Aufständischen hätten die Vögte von Thierstein,
deren Schlösser sie besetzten, mit der Drohung von ,Brand und
Schwert' zur Abgabe von Viktualien und Wein gezwungen». Am 2. Mai
musste die Tagsatzung trotz der Abwesenheit vieler Gesandter —die
von Uri und Obwalden waren auf ihre Landsgemeinden gereist, Werdmüller
nach Zürich, die Luzerner zu einer dringlich einberufenen Ratssitzung
nach Luzern — eine Extrasitzung abhalten, weil «schlimme
Berichte aus Basel» eingelaufen waren: «die Untertanen seien ,alle in
Waffen'; in Liestal hätten sie den Schultheissen' (natürlich Imhoff,
nicht Gysin) «und einige Röte gefangen und die Torschlüssel an sich
genommen». «Man beschloss daher», wie Peter berichtet, «,mit allen
Mitteln dahin zu trachten, dass dieser ungute Bauernbund wieder cassiert
werde'. Dann wurde die Einmischung des französischen Gesandten
De la Barde in diese rein interne Angelegenheit scharf kritisiert»
—natürlich vor allem seitens der spanischen Partei; von den Berner
Herren hört man in diesem Zusammenhang nichts, aus guten Gründen,
wie wir wissen! Sie revanchierten sich dafür mit dem Vorwurf
an die Zürcher, sie hätten «den Gesandten der Entlebucher und Willisauer
zu viel Ehre angetan...»
Schon «am frühen Morgen des 2. Mai» war ein tags zuvor bestellter
Bote der Tagsatzung an die Willisauer und die Entlebucher abgefertigt
worden, Hans Ulrich Schnorf, der Untervogt zu Baden. Bereits
tags zuvor nämlich war beschlossen worden, «die Bauern ,unter Zusicherung
freien Geleits durch ein offenes•Ausschreiben' einzuladen,
auf den 7. Mai bevollmächtigte Ausschüsse nach Baden abzuordnen».
Dieses «aufgesezte Vorladungspatent» (!) hatte Schnorf nach Willisau
zu bringen, wo es heftig gärte und wo der Luzerner Rat einen letzten
verzweifelten Versuch mit Verhandlungen machen wollte, «um mit
den aufständischen Bauern völlig zu traktieren und komponieren»;
sodann ins Entlebuch, wo am 3. die Landsgemeinde beim Heiligen
Kreuz bevorstand. Ausserdem beschloss eine Konferenz der auf der
Tagsatzung vertretenen evangelischen Orte, «die bernischen Bauern
noch speziell zur Entsendung bevollmächtigter Abgeordneter an die
Tagsatzung einzuladen». Bürgermeister Waser setzte darum persönlich
ein Schreiben an Leuenberger auf, das da lautet: «Es gelangt aller
evangelischer Orthen Herren Ehrengesandten, welche neuwlich wegen
der bewussten Tractaten zu Bern gewesen, begeren und ersuchen an
Euch, Ir wellen so befürderlich als müglich Albero kommen, umb einen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 352 - arpa Themen Projekte
Leuenberger und Schybi zu Pferde empfangen eine
Ratsdeputation des Berner Rates im Bauernlager auf
dem Murifeld bei Bern
(Gegen Ende Mai 1653).
Populäre Lithographie aus dem 19. Jahrhundert
(in Wirtschaften des Emmentals).
Nach einem Einzelblatt in der Landesbibliothek in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 352 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 353 - arpa Themen Projekte
volen bericht zu geben, derowegen Ir euch bereits gegen einen gewüssen
Herren auch verluthen, lassen; das würde Eüich und der Landdtschafft
Bern Underthanen... zu nil geringem guten gereichen. Gott
mit unss. Baden, den 22. Aprils (1. Mai) 1653. Euer geneigter gutwilliger
Hansa Heinrich Wasser, Bürgermeister von Zürich, dissmalen
Abgesandter alhier.»
Man sieht, es war wieder einmal, diesmal auf gemeineidgenössischem
Boden, auf eine grosse Diversion nach dem Prinzip divide et
impera (trenne, um zu herrschen) abgesehen. Wie reagierten die Bauern?
In der Form sehr verschieden, höflich bis echt bäurisch ruppig;
in der Sache lehnten sie die «Vorladung» vor die Tagsatzung einmütig
ab. In einem sehr höflichen Schreiben antworteten unterm 3. Mai die
Berner Bauern —kollektiv, nicht Leuenberger persönlich —, dass sie
«zue erscheinen nit befüegt seindt»: ein sehr deutlicher Hinweis darauf,
dass es Sache des ganzen Bundes, nicht die eines einzelnen Gliedes sei,
eine Gesandtschaft an die gemeineidgenössische Tagsatzung zu delegieren;
und dass weder Leuenberger persönlich, noch die Berner Bauern
überhaupt sich eidbrüchig machen lassen wollen. Hingegen wollten
sie ihre bernischen Belange mit dem Berner Rat direkt «abzuehandlen»
versuchen, «und arbeiten wir starckh, alle unssere Klagendten
Articklen und Landtsbeschwerdten zusammenzuesetzen», um sie «biss
auff nechst künftigen Mittwuchen», d. h. bis zum 7. Mai, der Stadt
Bern «zu überlifferen». «Denn wir begeren keine Gesandte dabei zu haben»
—sie hatten an Wasers Gesandtschaft in Bern für einmal genug
gehabt! Und zwar wollten sie die Abgesandten des Berner Rats zur
Verhandlung aufs Land heraus haben —«den unsser Abred ist, dass
lo. Gn. Ratsgesandten wellen erscheinen zue Huttwyll den 4. Tag
Meyens alt. Cal. (das ist am 14. Mai neuen Kalenders), dan nil mehr».
«Wesswegen es nil nothwendig ist, miss nach Baden zu bescheiden» —
wie der Bundes- und zugleich Kriegsrats-Schreiber Johann Konrad
Brönner am gleichen Tag in einem anderen Schreiben sagt, das er dem
Tagsatzungsboten Schnorf nach Baden mitgab, als dieser auf seiner
Rückkehr aus dem Entlebuch bereits am 3. wieder Huttwil passierte.
Ebenfalls am selben Tag —mithin alles unabhängig voneinander —
fand in Aarwangen eine Bezirks-Gemeinde statt, die beschloss, «in hiesigem
Kreis sei die Zitation nach Baden nicht anzunehmen, sondern,
so die Eidgenössischen evangelischen Gesandten mit den Untertanen
reden wollten, möchten dieselbigen sich in das Land zu ihnen (den
Bauern) begeben».
Die Reaktion der Luzerner Bauern auf die Huttwiler Vorgänge
und Beschlüsse und daher auch ihre Antwort auf die «Zitation» vor
die Tagsatzung waren noch weit entschiedener, ja entschlossen revolutionär.
Die Entschlossenheit, mit dem Herrenregiment überhaupt zu
brechen, machte sich Luft in Aktionen von einer bäuerlichen Grossartigkeit,
wie sie im Bauernkrieg immer wieder nur die Luzerner Bauern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 354 - arpa Themen Projekte
von echt bäurischer Handgreiflichkeit und etwelcher Grausamkeit,
wie sie am Rande der grossen Aktionen in Zeiten der Hochspannung
als unvermeidliche Ausbrüche der Volksstimmung aufzutreten
pflegen. Der Herrenchronist Liebenau, der für die Revolution von
oben stets bereit ist, das Schwert zu fordern, während er darüber stets
empört ist, dass auch die Revolutionen von unten nicht mit Rosenöl
gemacht werden können, Herr von Liebenau also drückt die Volksstimmung
im Luzerner Land in. den Tagen unmittelbar nach der ersten
Huttwiler Landsgemeinde naturgemäss in andern Worten aus: «Die
sozialistischen Tendenzen der Bauern aber», sagt er, «traten auch
gleichzeitig in nacktester Form so schroff hervor, dass der ruhig denkende
Bürger sich immer mehr von dem Treiben der Bauern mit Ekel
abwenden musste.» Herr von Liebenau bestätigt damit aber nur wenn
auch, wie gewohnt, spiegelverkehrt —unsere Diagnose, wissen wir doch,
was bei ihm unter «sozialistischen Tendenzen» zu verstehen ist.
«Während der Rat von Luzern die Boten der Entlebucher bis an
den Bodensee verfolgte, brach sich im benachbarten Sursee die Revolution
Bahn», berichtet Liebenau. Es war dies ein von den zehn Aemtern
von Anbeginn des Aufstands an besonders heiss umworbenes
Städtchen. Und dies zwar deshalb, weil es eine von den Herren mitten
im Aufstandsgebiet gehaltene Festung war, die sie hofften, zur Zwingburg
für den ganzen Aufstand machen zu können. Das Städtchen war
deshalb für damalige Zeiten wohlbewehrt und laufend mit Kriegsvorräten,
sowie mit einigen leidlich modernen Geschützen versehen worden.
Nichts aber hatten die Bauern gerade jetzt nötiger als diese Waffen
und diesen festen Platz, der alle Hauptverbindungen durch das
Wigger-, Suhr- und Baldeggertal nach Olten, Aarau, Lenzburg und den
Freien Aemtern beherrschte. Das nämlich waren die Haupteinfallspforten
für die so viel befürchteten «fremden Truppen» der Tagsatzungsarmee,
über deren Aufmarsch eben in diesen Tagen die Herrentagsatzung
in Baden zu Rate sass. Darum bestürmten nun die von
Huttwil heimgekehrten Willisauer und Ruswiler Ausschüsse die Surseer
Bürger, sich endlich für den Bauernbund zu entscheiden, sonst
würde man die Stadt mit Gewalt nehmen. Es war am 3. Mai, als die
Bürger von Sursee nun ihrerseits von ihrem Rat «den Anschluss der
Stadt an den Bauernbund, grössere Freiheiten und eine Allmendteilung
verlangten». Und siehe da — «der Rat war geneigt, gegen Ausstellung
eines Reverses dem Begehren zu entsprechen»! Das erfüllte die Bauern
des ganzen Landes mit Jubel, die Herren in Luzern mit Schrecken.
Sursee aber schwankte bis zuletzt zwischen beiden Polen des Kampfes
hin und her.
Den Hauptvorstoss führten wieder einmal die Entlebucher. Sie
waren es, die die weitaus kühnsten politischen Konsequenzen aus dem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 355 - arpa Themen Projekte
ereignisreichen 3. Mai, an dem Sursee gewonnen wurde und Leuenberger
und die Berner die Absagen an die Tagsatzung erteilten, und
zwar auf der grossartigen Landsgemeinde beim Heiligen Kreuz, die die
Entlebucher schon vor Sumiswald beschlossen und zu der Hans Emmenegger
und die Landesgeschworenen die Luzerner Regierung bereits
mit einem Schreiben aus Sumiswald eingeladen hatten.
«Am Feste der Kreuzerfindung, den 3. Mai», so erzählt Vock, «an
welchem Tage ohnehin alle Entlebucher, zur Feier des kirchlichen
Festes in dem berühmten Wallfahrtsorte, bei der Kirche zum heiligen
Kreuze sich zahlreich versammeln, wurde dort, nach Vollendung des
Gottesdienstes, eine Landsgemeinde gehalten. Der Pannermeister Emmenegger
sagte unter anderem in seiner Eröffnungsrede, er wisse zuverlässig
und mehr als 40 Mann können es bezeugen, dass schon Befehl
gegeben war, 40 000 Mann Bernertruppen in's Amt Entlebuch und
Willisau einrücken zu lassen, mit dem Auftrage, durch Mord, Brand
und Verwüstung jeglicher Art die Bauern zum Gehorsame zu bringen.
Auch ward eine der Granatkugeln vorgewiesen, die man auf dem Schiffe
bei Berken aufgefangen hatte. Hierauf wurden folgende Beschlüsse
durch offenes Stimmenmehr gefasst:
,1. Sie, die Entlebucher wollen nicht ruhen, bis das von der Tagsatzung
zu Baden am 22. März erlassene Mandat widerrufen sei, und
bis sie ihre alten Privilegienbriefe wieder haben, welche von einem
Landvogt ihnen genommen wurden, und nach der Aussage zweier
Herren, zu Luzern noch vorhanden sein sollen, und unter denen auch
ein Breve Sr. Heil, des Papstes sich befinde, welches dahin laute, dass,
wer einen ungerechten Krieg wider die Entlebucher führe, excommuniciert
sein solle.
2. Die Landesvorsteher sollen Gewalt haben, nöthigen Falls eine
Gesandtschaft im Namen des Landes Entlebuch zum hl. Vater nach
Rom und an Se. Kaiserliche Majestät von Deutschland zu schicken.
3. Alle seit St. Josephs Tag (19. März) und weiters ergangenen
Kosten müsse die Regierung ihnen ersetzen und zurückerstatten, weil
sie den an jenem Tage kundgemachten rechtlichen Spruch nicht befolgt
habe.
4. Weil man ihr Land, ihre Leute und Güter den Feinden habe
preisgeben wollen, so werden sie für einmal keine Zinse mehr in die
Stadt schicken.
5. Alle Grempel von Tragereien in die Stadt (kleine Bodenzinstragereien)
sollen gänzlich verboten sein.
6. Man soll nichts mehr in der Stadt färben lassen, sondern es
einstweilen nach Wollhausen und Willisau schicken, bis sie, wie schon
beschlossen sei, eine Färberei im Entlebuch errichtet haben.
7. Sie und die durch den Bund von Sumiswald und Hutwyl verbündeten
Miteidgenossen wollen in Zukunft das Geld von einander
abnehmen in dem Werthe, wie es vor dem Geldabrufe stand. Wollen,
nach Austrag des Handels, die Gnädigen Herren und Obern und die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 356 - arpa Themen Projekte
sie es bleiben lassen.
8. Wer im Lande selbst diesem Beschlusse entgegen handle, den
werden sie an den Nasen und Ohren zeichnen.
9. Man soll auf schnelle Beendigung dieses Handels dringen, weil
sonst, wie der französische Ambassador an die Landsgemeinde von
Hutwyl schrieb, das ganze Schweizerland in grosse Gefahr kommen
würde.
10. Diejenigen aus dem Entlebuch, so jüngst an der Landsgemeinde
zu Hutwyl gewesen, sollen sich unfehlbar auf Mittwoch, den
14. Mai, wieder daselbst einfinden, und andere zum Besuche dieser
Landsgemeinde bereden, damit der grosse Eidgenössische Bund noch
stärker und fester werde.
11. Mit der Regierung wollen sie künftig weder in der Stadt noch
auf Tagsatzungen mehr unterhandeln, sondern nur allein unter freiem
Himmel und auf offenem Felde.'»
«An die Bürgerschaft der Stadt Luzern aber», so ergänzt Liebenau,
«wurde ein freundliches Schreiben erlassen, worin über die Spruchbriefe
Beschwerde geführt und die Behauptung aufgestellt wurde, nach
den alten Urkunden besitze Luzern nicht eine eigentliche Landesherrschaft,
sondern eine Schirmherrschaft über Entlebuch. Um einem
Ueberfall von einheimischen oder fremden Truppen gewachsen zu sein,
habe man den Bund in Huttwil geschlossen.»
Eine imponierendere Kundgebung des Willens zu vollkommener
politischer Unabhängigkeit vom ganzen System des Absolutismus als die
Postulate der Entlebucher vom 3. Mai in Heilig Kreuz gibt es im ganzen
Bauernkrieg nicht — es seien denn die derselben Entlebucher vom
18. Mai in Schüpfheim! Diese Postulate —jene und diese —stellen in
der Tat die Geburt eines bäuerlichen Klassenstaates mit vollständiger
politischer Selbstbestimmung dar. Innen- und sozialpolitisch: vollständige
Wiederherstellung der alten, vorfeudalen und vorabsolutistischen
Bauernfreiheit. Aussenpolitisch: vollständige Freiheit des diplomatischen
Verkehrs mit den weltlichen und geistlichen Grossmächten. Wirtschafts-
und finanzpolitisch: Abschaffung der Zinsknechtschaft gegenüber
dem städtischen Kapital; Streben nach Autarkie im Gewerbe;
eigene Finanzhoheit etc. Rechtspolitisch: eigenes Strafrecht. Staatspolitisch:
autonomer Ausbau der eigenen föderativen Bundespolitik ohne
Rücksicht auf bisherige Kantons- und Tagsatzungs-Souveränität. Zum
Schluss, in der blossen Tatsache des Schreibens an die Luzerner Bürgerschaft:
die immer wiederkehrende Ahnung von der Notwendigkeit
des Bündnisses mit der Bürgerklasse und der Berechtigung auch der
bürgerlichen Freiheit!
Und nun zur Antwort der Entlebucher an die Tagsatzung. Noch
vor ihrem Vollzug mischte sich hier die erregte Volksstimmung mit
einem jener Akte ein, die von Herrenchronisten vom Schlage Liebenaus
in ihrer totalen Unkenntnis dessen, was Sozialismus bedeutet, gern als
krasse Beweise für die «sozialistischen Tendenzen» der Bauern angeführt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 357 - arpa Themen Projekte
mit «barbarischen Plänen» gleichsetzt. Der Tagsatzungsbote Schnorf
nämlich hatte sich von Luzern einen Hintersässen der Stadt namens
Heinrich Sager als Führer ins Entlebuch mitgenommen. Dieser Herrendiener
ist jedoch nicht gleichzeitig mit Schnorf aus dem Entlebuch zurückgekehrt,
sondern hielt sich dort noch einen Tag länger auf, unbekannt
zu welchem Zweck. (Es wird der gewöhnliche Auftrag solcher
Individuen, die Bauern auszuspionieren, gewesen sein.) Denn noch am
4., als Schnorf bereits wieder in Baden war, liess sich an dem besagten
Sager «auf offenem Platze in Schüpfheim» die Volkswut in folgender
bäurisch-grobianischer Weise aus: ihm wurde mit einer Schere Haar
und Bart geschoren, das damals gewöhnliche Mittel der Bauern, einen
als Herrendiener zu kennzeichnen; ferner die Ohren geschlitzt, die
spezifische Bauernrache für Ohrenträgereien; und schliesslich mit
einem Eisen die Nase «gebrannt», die besonders grausame Peinigung
für Schnüffeln und Spionieren. Zuguterletzt wurde er mit dem «Vermelden»
nach Luzern entlassen, «die Entlebucher seien Feinde der
Stadt Luzern, und wenn selbst ein Herr, ohne Befehl, ins Land käme,
so würden sie ihn nicht anders behandeln». Gerade dieses «Vermelden»
stellt klar, dass es sich hierbei um den Ausbruch einer allgemein gegen
die Herren gerichteten Volkswut handelte.
Dass die Bauernführer mit dergleichen anarchischen Akten der
Volkswut keineswegs einverstanden waren, geht daraus hervor, dass
sie sich wegen dieses Vorfalls und wegen anderer ähnlicher Akte durch
eine persönliche Gesandtschaft an die Tagsatzung ausdrücklich entschuldigten.
Der Tagsatzungsabschied dieser Session enthält darüber
folgenden Passus: «Folgends (und zwar am 8. Mai, nachmittags) sind
die Ausschüsse der Luzernischen Unterthanen, als nämlich: zwei Mann
aus Entlebuch, einer von Sursee und einer von Rothenburg, erschienen...»
(Zu welchem Hauptzweck werden wir sogleich erfahren.) «Darneben
aber haben sie auch Entschuldigung gethan, dass die Vorgesetzten
und gemeine Landleute kein Gefallen haben an dem, was des Herrn
Untervogts Guidon oder Zeiger, dem die Ohren geschlitzt und der Bart
geschoren worden, widerfahren; es sei von meisterlosen Burschen aus
Muthwillen beschehen, — wie ihnen zugleich auch höchst missfällig sei,
dass etwelche Zusammenrottierte ungerechter Weise durch das Land
ziehen, den Leuten das Ihrige mit Gewalt abnehmen und etwelche Personen
am Leib übel traktieren; allen können sie es einmal nicht erwehren,
angesehen, dass sie es wehren wollten, in Gefahr ihres Lebens sich
befinden müssten. Wer aber solche niedermachen würde, wollten sie
nichts dawider sagen; denn ihre Meinung sei, Gerechtigkeit und nicht
Ungerechtigkeit zu suchen». Das sagten Revolutionäre, nicht Kapitulanten.
Das ist eine treffliche Kennzeichnung des anarchistischen Lumpenproletariats,
das in jeder Rebellion, sei es eine bäuerliche, bürgerliche
oder sozialistische, durch die Wogen des Volkszorns emporgespült
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 358 - arpa Themen Projekte
wie unvermeidlichem Instrument macht. Es ist also töricht und ungerecht,
die betreffende Rebellion bezw. ihre Führer mit den Taten des
allgemeinen Volkszorns zu belasten; ebenso wie es erst recht falsch
und unsinnig ist, das Wesen einer Rebellion in solchen Akten zu erblicken.
Was war das nun aber für eine Gesandtschaft der Luzerner Bauern
an die Tagsatzung? Haben sie also doch klein beigegeben und —
ungleich den Berner Bauern —durch Sonderverhandlungen den Bund
gebrochen? Nein, was diese Gesandtschaft in Baden auszurichten
hatte, war wahrlich das Gegenteil einer Kapitulation. Auch die
eben mitgeteilte Entschuldigung wegen des Zwischenfalls in Schüpfheim
darf nicht zur entgegengesetzten Meinung verleiten, — souveräne
Staaten untereinander entschuldigen sich ja gegenseitig für
anerkannte Uebergriffe. Vielmehr ist die Botschaft, die diese Gesandtschaft
an die Tagsatzung zu überbringen hatte, ein erster Akt der
Souveränität des neuen entlebuchischen Staatswesens, wie es auf der
Landsgemeinde beim Heiligen Kreuz vom 3. Mai geboren worden war!
Zur Vollendung der Souveränität desselben bedurfte es in den Augen
der Entlebucher nur noch des urkundlichen Beweises seiner ursprünglichen
Eigenständigkeit. Dieser Beweis konnte jedoch nur aus Urkunden
geführt werden, die die Luzerner Herren ihnen im Lauf der Zeit
abzunehmen gewusst hatten. Da die Luzerner Herren deren Herausgabe
hartnäckig verweigerten, ging nun das Ersuchen der Entlebucher
an die Tagsatzung —ein Ersuchen wie von Staat zu Staat —ihrerseits
ihre Autorität bei der Luzerner Regierung einzusetzen, um sie zur Herausgabe
der Dokumente zu veranlassen. Sollte diese auch dann noch
verweigert werden, so sind die Entlebucher trotzdem entschlossen, auf
ihrer Unabhängigkeit gegenüber Luzern zu beharren, indem sie sich
an die in ihrem Besitz befindliche alte Abschrift (den «Vidimus-Brief»)
halten und diesen für beweiskräftig erklären. Ferner lehnen sie in dieser
Botschaft die bisher, z. B. noch im Ruswiler «Rechtsgang», anerkannte
Zuständigkeit des «eidgenössischen» Rechtes, d. h. die Rechtshoheit
der Tagsatzung, ab. An seiner Stelle rufen sie, für den Fall, dass
sich ein Rechtsstreit erheben sollte, nicht etwa die Regierungen, sondern
die Landsgemeinden der drei Urkantone —d. h. das Volk direkt —als
Schiedsrichter an und betonen, dass ihnen dies von den Landleuten von
Uri, Schwyz und Unterwalden selber anerboten worden sei!
Dass dies und nichts anderes, mithin Dinge von grösster politischer
Tragweite, der Inhalt der Antwort der Entlebucher auf das «Vorladungspatent»
der Tagsatzung war, möge nun der Wortlaut des Schreibens,
im vollen Umfang wie ihn G. J. Peter abdruckt, beweisen:
«Wir sollen nicht unterlassen, auf Euer freundliches Schreiben
und die Einladung nach Baden unsere zwei geehrten redlichen und
frommen Miträte an Euch zu schicken, nämlich Herren Niklaus Theiler
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 359 - arpa Themen Projekte
die hochansehnliche Session besuchen sollen... Es haben aber unsere
Gemeinde, die Landesväter und gemeine Landleute, ihnen keine
Vollmacht gegeben, zu unterhandeln, sondern allein anbefohlen, anzuhalten
um die ,Briefe' welche unsere gnädige Obrigkeit uns schuldig
ist und unseren Vorfahren genommen hat; dass ihr wollet mit den
Herren von Luzern reden und sie dahin halten, dass sie uns solche
geben und zustellen; denn, falls sie uns solche nicht zustellen und geben
wollten, so wollen wir uns an unsern alten Vidimus-Brief halten
und dabei verbleiben.., und wir wollen auch keine weitern Bemühungen,
Auslagen oder Sendungen anwenden; denn wir haben schon zu
viele Kosten, die wenig genützt, auflaufen lassen, welche uns laut
,Brieff und Sigel' von obrigkeitswegen wieder ersetzt werden sollten...
Unsere streitigen Punkte weiter ins Recht setzen, dazu haben wir keine
Lust; denn wir haben zu Ruswil den Rechtsgang beschritten; aber wir
haben den Gesandten der sechs katholischen Orte nicht folgen können,
welche hieran, weiss Gott, schuldig sind... Hätten wir die alten Briefe,
worin wir sehen würden, wie das eine und andere wäre, und möchte
alsdann noch weiter etwas ,stössig und streitig' sein, so dass die Sache
weitergezogen werden müsste, so wollten wir vor die Landsgemeinden
der drei alten Orte, Uri, Schwyz und Unterwalden treten, die über unsere
beiden Parteien zu ,richten und mehren' hätten. Was dort beschlossen
würde, danach wollten wir leben, weil wir dort das beste
Recht und die beste Gewalt haben, da die löbliche Stadt Luzern der
erste Ort ist, der sich mit den drei alten Orten verbündet hat. Darum
wollen wir, wenn wir nachher Streitigkeiten auszutragen hätten, uns
dorthin begeben, wie solches von den Landleuten der drei Orte uns anerboten
worden ist...
Datum Entlebuch, den 5. Mai. Landesbannerherr, Landeshauptmann,
Landesfähnrich und die vierzig Geschworenen und eine ganze
Landsgemeinde.»
Ausserdem sollen die beiden Entlebucher Boten, nach Liebenau,
die am 26. April dem Rat von Zürich übergebenen Artikel ausdrücklich
zurückgezogen haben —die waren jetzt, nach Heilig Kreuz, weit überholt.
Und schliesslich haben sie «das Begehren um Herstellung einer
Einheit im Münzwesen gestellt» —eine ausserordentlich fortschrittliche
Vorwegnahme des Postulats einer viel späteren Zeit! Wollten aber «die
Regierungen die von ihnen ausgegebenen Münzen nicht zum vollen
Nennwerte abnehmen, so müssten die Bauern statt mit Geld mit Waren
zahlen».
Mit der Botschaft der Entlebucher an die Tagsatzung war in Wirklichkeit
jede bisher von dieser vorausgesetzte Verhandlungsgrundlage
völlig beiseite geschoben. Jede Möglichkeit, auf Grund des Hin und
Hers von Konzessionen in den vielen Einzelfragen, die bisher die Diskussion
beherrschten, zu einem «Vergleich», d. h. zu einer Unterwerfung
der Bauern unter die bestehende Ordnung der Dinge, zu gelangen,
war einfach aufgehoben. Drang die Tagsatzung, wie die Entlebucher
sie ersuchten, bei der Luzerner Regierung auf die Herausgabe der Freiheitsurkunden
der Entlebucher — so hatte sie allein damit schon die
Unabhängigkeit des Entlebuchs anerkannt! Und es blieb ihr alsdann
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 360 - arpa Themen Projekte
Staaten-Bund der alten «Eidgenossenschaft» mit aufzunehmen. Und dabei
wäre es naturgemäss nicht geblieben: das Beispiel hätte gezündet —
und Willisau, das Emmental, Liestal und die Basler Landschaft, der
ganze Aargau, ja auch die übrigen unterworfenen Landesteile und gemeinen
Herrschaften, Thurgau, Rheintal, Tessin, Waadt etc. hätten
unaufhaltsam zum selben Ziele gedrängt; ganz abgesehen davon, dass
dadurch das ganze Herrschaftssystem sämtlicher Herren-Regierungen
der Schweiz seine ökonomische Basis und folgerichtig seine politische
Macht verloren hätte, sodass die unterdrückten Burgerschaften der
Hauptstädte zur «Machtergreifung» hätten schreiten können. Kurzum,
die alte Eidgenossenschaft hätte einer neuen weichen müssen, wie sie
im Prinzip erst zwischen 1798 und 1848 Wirklichkeit geworden ist. In
diesem Sinne war es vollkommen richtig, wenn «die Gesandten der 13
eidgenössischen Orte und ihrer Zugewandten», nach Liebenau, «allgemein
darüber einig» waren, «der Bundesschwur der Bauern bezwecke
eine totale Veränderung des gesamten eidgenössischen Staatswesens»!
Wenn da auch nur ein weitblickender Staatsmann unter diesen Gesandten
gewesen wäre —hier hätte sich ihm eine Aufgabe gestellt, deren
Lösung ihn unsterblich gemacht hätte...
Gewiss mögen die Entlebucher sich keine Vorstellungen über auch
nur annähernd so weitreichende Folgen ihres entschlossenen Unabhängigkeitswillens
gemacht haben. Aber wie fest ihr Entschluss war,
sich von diesem Willen durch keine Verhandlungen mehr abbringen
zu lassen, geht auch daraus hervor, dass sie in dem «Einbegleitschreiben»
zu der oben wiedergegebenen Botschaft an die Tagsatzung die
beiden zur Ueberreichung nach Baden gesandten Männer ausdrücklich
nochmals wohl als «Gesandte» bezeichneten, «jedoch ohne Vollmacht
und Gewalt, als welche von der Landsgemeinde durchaus verweigert
worden ist». Beide Schreiben, vom 5. Mai datiert, gehen also auf Beschlüsse
der Landsgemeinde beim Heiligen Kreuz vom 3. Mai zurück,
mithin auf das Volk als kollektiven Souverän, der bei der Vollziehung
seines Willens jede Willkür und jeden Zufall, die aus Verhandlungen
zwischen Einzelpersonen entspringen konnten, von vornherein durch
strikten Verhaltsbefehl ausschalten wollte. An der Entschlossenheit
dieses Willens aber haben wir zu ermessen, was für Folgen hätten eintreten
müssen, wenn dieser Wille in der Tagsatzung durchgedrungen,
geschweige wenn er auf dem Schlachtfeld siegreich geblieben wäre.
Dass die Ueberbringer dieser Schreiben, die beiden Entlebucher
Niklaus Theiler und Joseph Portmann, bei ihrem «Besuch» der Tagsatzung
am 8. Mai ausserdem von je einem Vertreter von Rothenburg
und von dem neu gewonnenen Sursee, sowie von drei Willisauern begleitet
waren —deren Namen uns alle nicht überliefert sind —, hat unter
diesen Umständen die Bedeutung, dass diese Orte entschlossen waren,
sofort in die Fusstapfen der Entlebucher zu treten. Nicht nur verlangten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 361 - arpa Themen Projekte
— das war nun schon nichts anderes mehr als eine selbstverständliche
Ehrenforderung, um die Herren zur Wiederherstellung des Prestiges
der Bauern zu zwingen —; vielmehr wollten auch sie «nur weiter unterhandeln
auf Grundlage ,ihrer alten Rechte, wie sie an Luzern gekommen'»,
d. h. auf der Grundlage ihrer alten Volksfreiheit, der Unabhängigkeit
vom Herrenregime. Bögli stellt bezüglich der Willisauer
Rechte einmal fest: «Das Recht der Willisauer in Betreff ihrer konstitutionellen
Begehren beweist das spätere Geständnis der luzernischen
Regierung, dass die Freiheitsbriefe verloren gegangen seien und sie
ihnen daher neue zustellen wolle.»
Der grosse Tag der Willisauer, an dem die Luzerner Regierung
dieses Geständnis machen musste, war die mächtige Zehn-Aemter-Versammlung
vom 6./7. Mai in Willisau, die also der Entlebucher Landsgemeinde
vom 3. auf dem Fusse folgte. Schon am 1. Mai hatten die
Willisauer auf das Ersuchen des Luzerner Rates um Verhandlungen
mit Vertretern der zehn Aemter in Ruswil trotzig geantwortet, sie verhandelten
nur auf Grund ihrer alten Freiheitsrechte und der Aufhebung
aller seit 26 Jahren neu eingeführten Lasten; ausserdem verlangten
sie, «die zehn Aemter sollen vom Rate statt nach Ruswil nach
Willisau berufen werden». Das war für den Rat eine Demütigung; denn
in Willisau hatte er nie etwas anderes als Niederlagen erlebt. Aber er
musste nachgeben. Lassen wir darüber Liebenau das Wort: «Als in der
Stadt Luzern sich die unzufriedenen Bürger mit den Bauern verbanden
und die Macht und Arroganz (sic!) der Angehörigen des Huttwiler-Bundes
von Tag zu Tag wuchs und selbst das Volk der Urkantone
seine Sympathie für die Sache der Revolutionäre immer offener zu erkennen
gab, da musste sich der Rat von Luzern dazu bequemen, in dem
verhassten Willisau zu verhandeln.»
Es war eine höchst ansehnliche Ratsdeputation, die in Willisau
erschien: an der Spitze Schultheiss Dulliker selbst, sowie vier weitere
Mitglieder der Regierung, die Kleinräte: Ritter Ludwig Meyer, der Leuteschinder,
den seine Schmeichler «den deutschen Platon» nannten;
der schneidige Willisauer Landvogt Jost Pfyffer, der von jeher «den
gwalt» im voraus einkalkulierte, sowie sein nicht minder zum Losschlagen
geneigter Vetter Kaspar Pfyffer; schliesslich Rudolf Mohr,
«letzterer anstelle des ablehnenden Jakob Hartmann, der als strenger
Landvogt den Bauern besonders verhasst war». Ferner hatte der Grosse
Rat der Hundert vier seiner Mitglieder delegiert, und, was das merkwürdigste
ist, auch vier schon lange als «Hochverräter» gebrandmarkte
Führer der rebellischen Bürgerschaft wurden von der Ratsdeputation
mitgenommen: Melchior Rüttimann, Jakob Wägmann, Martin Marzell
und Wilhelm Probstatt, die alle später, nach der Niederlage der Bauern,
auch wirklich als Hochverräter an Leib, Gut und Leben gestraft
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 362 - arpa Themen Projekte
hat in die Knie gegangen waren. Jedenfalls berichtet Liebenau, Schultheiss
Dulliker habe am 4. Mai dadurch «einen vollständigen Sieg» über
die Bürger errungen, dass er ihnen zusetzte, sie würden «doch nicht auf
ihre Vorrechte verzichten und zugeben wollen, dass auf dem Lande
massenhaft Weinschenken, Pfistereien, Metzgen etc. sich erheben, wodurch
die Gewerbe in der Stadt geschädigt würden»! Auch der obrigkeitliche
geistliche Einpeitscher Pater Plazidus war übrigens wieder
da, der die Verhandlungen in der Kirche von Willisau sogar feierlich
eröffnen musste. Worauf niemand geringeres als der Oberst, Altlandammann
und Feldmarschallieutenant Sebastian Bilgerim Zwyer das
Wort ergriff, um seinen «Rechtlichen Spruch» vor denselben Leuten
zu verteidigen, die diesen längst in der ganzen Schweiz als «gefälschtes
Machwerk» denunziert hatten! «Die Stadt Willisau stellte den Gesandten
von Luzern unter dem 5. Mai einen förmlichen Pass aus» — so wie
man fremden Gesandten kraft eigener Hoheitsrechte diplomatische
Pässe bewilligt!
Wen hatten die Bauern zu diesem denkwürdigen Rencontre geschickt?
«Die ganze Versammlung zählte 230 Personen», berichtet
Liebenau; nämlich lauter designierte Delegationen, nicht eine Volksversammlung
bezw. Landsgemeinde. Das Entlebuch hatte als Sprecher
seiner Delegation seine beiden hitzigsten Kämpfer, Stephan Lötscher und
Weibe! Krummenacher, geschickt; schon dies liess eindeutig erkennen,
dass jeder Kapitulation oder auch nur Diversion energisch der Riegel
geschoben werden sollte. Aber auch die Willisauer selber hatten ihre
ausgesprochenen Heissporne an die Spitze ihrer Delegation gestellt:
Jakob Stürmli, Fridolin Bucher und Hans Diener. Von Rothenburg
kam nicht Kaspar, sondern sein Bruder Sebastian Steiner. Mit
Kaspar hatte man doch allzu gefährliche Erfahrungen gemacht. Kurzum,
alle zehn Aemter waren durch Männer vertreten, die man für
die besten Sturmböcke hielt. Aber weder Hans Emmenegger, noch
Niklaus Binder, noch der Schulmeister Müller hielten es für nötig,
persönlich vor den Luzerner Herren zu erscheinen. Diese Disputation
über den «Rechtlichen Spruch» war für sie offensichtlich nur noch
ein Gespensterkampf mit einer Vergangenheit, über die man durch die
Beschlüsse der Landsgemeinde vom 3. und durch die Briefe an die
Tagsatzung vom 5. Mai endgültig hinweggeschritten war.
Ein «Gespensterkampf verwester Phantasien» — um mit einem
modernen Dichter zu reden — war es wirklich, was da von den Herren
in Szene gesetzt worden war. «Um sowohl gegen die Bauern als die
Bürger und Beisässen ein Entgegenkommen zu zeigen, wurde eine Revision
des Artikels 9 des Rechtspruches in Aussicht genommen, die
auch die weitgehendsten Forderungen hätte befriedigen können» —
meint allen Ernstes Liebenau. Worin bestand dieses grossartige «Entgegenkommen»?
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 363 - arpa Themen Projekte
Der Artikel 9 nämlich war — wie wir im ersten Buch sahen —
nichts anderes als die Schlussunterwerfung der Bauern unter den Willen
der Herren. Darin sollten die Bauern sich des hochverräterischen
«Fehlers» «Fehlers» schuldig bekennen, den Wolhuser Bund geschworen zu haben,
der bereits im Artikel 7 in Grund und Boden verdammt und aberkannt
war. Ferner sollten sie in Artikel 9 durch Vermittlung der
Zwyer'schen «Ehrengesandtschaft» die Herren um Gnade und Errettung
anflehen, um dann amnestiert und, als vollendete Sklaven, in
Gnaden wieder angenommen zu werden.
Das grosse «Entgegenkommen» der Herren in Willisau (übrigens:
wieso auch den Luzerner Bürgern und Beisässen gegenüber, die ja den
Bund gar nicht beschworen hatten?) bestand nun einzig darin, dass in
der dort neu vorgeschlagenen Form des Artikels 9 das Wort «Fehler»
vermieden wurde und dass das winselnde Um-Gnade-Flehen, das Zwyer
den. Bauern in diesem Artikel unterschoben hatte, um ein weniges gemildert
dargestellt wurde: statt «hoch bethürt» sollte stehen «ersucht
und gepetten», und dergleichen winzige Wortklaubereien mehr. Wie
ja Zwyer schon sechs Tage nach der Verkündung des Spruches hatte
revozieren müssen, die «Abbitte» sei von den Bauern «so inständig nie
begehrt worden». Das war Alles, wirklich Alles! Kein Wort vom Artikel
7, in dem «der Bund und gethane Eid... für null und nichtig» erklärt
und jedes Amt einzeln (nicht verbündet) verpflichtet wird, jedes
neue «zusammenlaufen» und «Bündnis und Eyd errichten», der Regierung
zu denunzieren, «und, welche sich diessfalls übersehen würden,
als an ihrer Obrigkeit treulos gestraft», also geköpft werden sollten!
Kein Wort auch vom Artikel 4, in welchen den Willisauern jedes
Recht zur Aemterbesetzung durch Volkswahl strikte abgesprochen und
Zuwiderhandlung ebenfalls zum Hochverrat gestempelt werden sollte.
In erster Linie die beiden Artikel 7 und 9 waren es gewesen, die
einer — infolge dieses Spruches bereits illegalen — Vier-Aemter-Versammlung
in Ruswil am 22. März den Anlass gegeben hatten, den ganzen
Spruch als «gefälschtes Machwerk» zu brandmarken, da bei Abfassung
dieser Artikel nie ein Entlebucher oder anderer Bauernausgeschossener
dabeigewesen sei. «Weder bei den gütlichen, noch bei den
rechtlichen Verhandlungen sei bestimmt worden, dass die 10 Aemter
vom Eidschwure abstehen sollen», schrieben damals die Bauern den
«Vermittlern» direkt, ohne von diesen seither jemals mit einem Wort
widerlegt worden zu sein! Ebenso verhält es sich mit der damals sofort
erhobenen Beschuldigung seitens der Bauern, diese beiden Artikel
«seien ihnen auch nie vorgelesen worden» und auch bei dem von
Trompetengeschmetter begleiteten Ablesen auf dem Krienserfeld am
Stephanstag «von den Zuhörern gar nicht gehört worden». Auch jetzt
in Willisau wurde von den Herren nichts davon widerlegt oder auch
nur erwähnt — man ging schamhaft um die Hauptsache herum und
bildete sich wahrhaftig ein, den Bauern das Kuckucksei der Bundesabschwörung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 364 - arpa Themen Projekte
Nest legen zu können! Jetzt noch — nach Sumiswald und Huttwil!
Nichts könnte die junkerliche Einbildung und zugleich die abgründige
Dummheit der Luzerner Rusés besser illustrieren...
Aber damit waren diese Herren an die Falschen geraten. Die Entlebucher,
Stephan Lötscher und die Weibe! Theiler und Krummenacher,
stiessen zuerst vor. «Die 10 Aemter», erklärte Lötscher, «haben durchaus
kein Recht, einen Vergleich abzuschliessen, bis die Entlebucher, als
Urheber des Handels, von Luzern ihre Rechte und Freiheiten erhalten
hätten». Damit bekräftigte er die unlösliche Gebundenheit aller zehn
Aemter eben an den Bundesschwur von Wolhusen. Dann verlangte Lötscher
die wirkliche Aushändigung der Urkunden; angeblich «nicht existierender
Urkunden», wie Liebenau den Luzerner Herren zuhilfe
springt. Und zwar soll Lötscher dieses Verlangen zu dem Zweck gestellt
haben, «um den Vergleich zu verunmöglichen».
Damit könnte Herr von Liebenau schliesslich recht haben: Alles,
was die Bauern jetzt in Willisau am 6. Mai forderten, diente dem
Zweck, einen «Vergleich», d. h. eine Kapitulation auf der Basis des «gefälschten
Machwerks», zu verunmöglichen! «Auch die Edition der Urkunden
über die Hoheitsrechte Luzerns wurde verlangt, nebst Widerruf
des Mandates von Baden, Abänderung des gütlichen und rechtlichen
Spruches, Ersatz der Kosten. Die Willisauer verlangten Zurückgabe
eines ihnen von Landvogt Cysat hinterhaltenen Buches» —d. h. wohl:
der ihnen, wie früher dargetan, entwendeten Freiheitsbriefe. Liebenau
allerdings deckt diese Urkunden-Entwendung, indem er, in Klammern,
den ironischen Zwischenruf «(Amtsrecht!)» einschiebt — es war also
das «Amtsrecht» der Landvögte, ihren «Unterthanen» die Freiheitsbriefe
wegzunehmen! Gerade hier aber muss es gewesen sein, wo die
in die Enge getriebenen Ratsdeputierten den Willisauern als Köder das
von Bögli erwähnte «Geständnis der luzernischen Regierung» hinwarfen,
«dass die Freiheitsbriefe verloren gegangen seien und sie ihnen
daher neue zustellen wolle». Nur finden wir darüber bei Liebenau an
dieser Stelle kein Wort; wohl aber berichtet er später ganz allgemein
von einem Beschluss des Luzerner Rates vom 8. Mai, «den Aemtern
beglaubigte Abschriften der verlangten Urkunden zu geben und an
einem unparteiischen Orte die Originalien aufzulegen». Dann berichtet
Liebenau noch, dass die Willisauer «laut einer Urkunde von 1428 als
Stadtbürger von Luzern betrachtet werden» wollten. Denn «als Graf
Wilhelm von Arberg Willisau an Luzern verkaufte, versprachen ihm
die Luzerner, die Willisauer wie ihre eigenen Bürger zu halten», wie es
in einem Schreiben des Grafen vom Jahr 1423, in der Amtskanzlei
Willisau, heisst, das im Jahr 1428 einem Spruchbrief einverleibt wurde.
Aber die Willisauer setzten den Luzerner Herren nicht nur historisch
zu, sondern auch mit sehr aktuellen Enthüllungen. So teilte Jakob
Stürmli der Versammlung — wohl als Inhalt eines der vielen aufgefangenen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 365 - arpa Themen Projekte
Bern Hülfstruppen verlangt, und zwar, laut Geständnis von Landvogt
Sonnenberg, zuerst 2000 Mann». Das wurde weder von den damaligen
Herren, noch wird es von Liebenau widerlegt. Es diente damals trefflich
als wenigstens teilweiser Beweis für die Richtigkeit der Behauptung
Hans Emmeneggers auf der Landsgemeinde beim Heiligen Kreuz. Um
dieses «Gerücht», «der Rat von Luzern habe bewilligt, dass die Berner
mit 30000 bis 40000 Mann das Land von oben bis unten mit Feuer
und Schwert heimsuchen» sollten, speziell für die Verhandlungen von
Willisau unwirksam zu machen, hatte der Rat ein «offenes Patent»
als Zweck-Dementi für diesen Tag erlassen «und demjenigen eine Belohnung
von 25 Kronen zugesichert, der den Urheber desselben vorzeige».
Jakob Stürmlis Enthüllung diente also dazu, die Herren in diesem
Punkte Lügen zu strafen.
Schliesslich aber zogen auch die Willisauer die volle Konsequenz
aus der Willenskundgebung der Entlebucher beim Heiligen Kreuz. «Ein
Sechser von Willisau», d. h. einer der sechs obersten Magistraten, erklärte:
«Die Bauern wollen die Luzerner nicht mehr als Obrigkeit anerkennen,
mit derselben nicht mehr verhandeln und sich eine andere
Obrigkeit suchen»! Meister Jakob Stürmli aber fügte bei: «die Untertanen
lassen weder Zinsen noch Zehnten in die Stadt abliefern». Das
Schlusswort hatte wieder ein Entlebucher. Es war Stephan Lötscher,
der den Räten ins Gesicht «die Luzerner nicht als Landesväter, sondern
als Tyrannen» erklärte... Das war das Ende dieses letzten Korrumpierungsversuchs
seitens der Herren, die abermals völlig unverrichteter
Dinge nach Luzern zurückreiten mussten.
Die Zehn-Aemter-Versammlung aber konstituierte sich sofort nach
Abreise der Herren «als Gerichtshof». Das war die Schule der Berner
von Huttwil! Am 7. Mai fasste die Versammlung folgende Beschlüsse:
1. «Alle ,Linden' in allen Aemtern sollen nach Gebühr bestraft werden.
Die Bestraften können an die zehn Aemter appellieren.' Damit war
allen überführten Kapitulanten und Verrätern an der Bauernsache, getreu
dem Sumiswalder Bundesbrief und dem Punkt 8 der Heilig Kreuz-Beschlüsse,
das Handwerk gelegt. 2. «Die Strafgelder sollen gehörig
verrechnet und zur Bestreitung der gemeinsamen Ausgaben verwendet
werden.» Damit wurden auch die Verräter und Kapitulanten — die
man natürlich schon längst genau kannte —der gemeinsamen Bauernsache
dienstbar gemacht! Speziell sollten die Bussengelder «zur Zahlung
der Gesandtschaftskosten» verwendet werden. Die Abgeordneten
der zehn Aemter in Willisau. entschieden noch «verschiedene Injurien-
und Civilstreite», und wenn man Liebenau glauben will, durchzogen
«schon am 6. Mai ... ,Exekutoren' der 10 Aemter das Land, erpressten
von den Anhängern der Regierung, den Linden, Geld, scherten ihnen
Haar und Bart und durchschlugen ihnen die Ohren, so im Michelsamt,
Büron, Triengen und in Ebikon...»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 366 - arpa Themen Projekte
Wenn nun also die Luzerner Herren mit ihrem letzten Diversionsversuch
«in dem verhassten Willisau» das pure Gegenteil einer Unterwerfung
der zehn Aemter erzielt hatten, so werden sie sich doch zweifellos
mit demselben Trost getröstet haben, den der mitfühlende Liebenau
ihnen verleiht: «Damit gewann der Rat allerdings zwei Vorteile:
erstens konnte er getrost sagen, dass das Scheitern des Vergleichs nicht
dem (soll heissen: im) Mangel an Entgegenkommen von Seite der Behörden
zu suchen sei» (wir haben ja gesehen, was für ein «Entgegenkommen»
das war!) «und zweitens konnten inzwischen die Tagsatzungsgesandten
in Baden den Kriegsplan entwerfen und die Truppenkonzentration
bewerkstelligen.» Danach wäre mithin das ganze aufgelegte
Theater mit der «Revision des Artikels 9 des Rechtsspruchs...,
die auch die weitgehendsten Forderungen hätte befriedigen können»,
nichts weiter als eine hinhaltende Kriegslist der Herren gewesen!
Als solche doppelzüngige Kriegslist-Politik enthüllt sich auch die
ganze Tagsatzungspolitik dieser Mai-Session, wenn man den Tagsatzungs-Abschied
aufmerksam durchstudiert. Da liest man beispielsweise:
«Unter diesem» — d. h. während man den Untervogt Schnorf mit dem
«offenen Patent» «zu gedachten Unterthanen abfertigt, damit die desto
eher, ander zu kommen, disponiert würden» (mithin bereits am 2. und
3. Mai) —«ist angelegentlich in Diskurs und Berathschlagung gezogen
worden, dass nothwendig sei, ein Projekt zu machen, wie man, auf den
Fall der Nothwendigkeit, mit der Gegenwart sich verhalten wollte;
hat dabei aber für das vornehmste erachtet, dass man alles verschweigen
und geheim behalten thue, wie Wir derowegen ein solches zu halten
unter uns aufgenommen (verabredet) haben.» Vock bemerkt mit
Recht zu dieser Stelle: «Darum ist auch dieser Abscheid so lakonisch
abgefasst, und vermutlich darum auch in der Aktensammlung zu den
Badischen Tagsatzungsabscheiden von Jahr 1653 so wenig über den
Bauernkrieg zu finden.»
Noch eine zweite Stelle dieses Abschieds beweist die bewusste Doppelspurigkeit
und Vernebelungspolitik der Mai-Session der Tagsatzung.
Gegen Ende der Session, die am 10. geschlossen wurde, hat man Schnorf
mit einem anderen «Patent» auf die Reise geschickt, diesmal an die
Regierungen in Basel und Bern, um deren Einwilligung zu erlangen,
dass ihre Untertanen vor das eidgenössische Recht geladen werden dürfen,
sowie anschliessend auf die zweite Landsgemeinde in Huttwil am
14. Mai, und zwar zu Leuenberger persönlich, um dort die Bauern direkt
vor das eidgenössische Recht zu laden. Wir müssen zuerst den Inhalt
dieses neuen «Patentes» an die Bauern kennen lernen, um das Doppelspiel
zu begreifen, das in der bewussten Stelle des Tagsatzungsabschieds
zum Ausdruck kommt. Der Inhalt dieses Vorladungspatentes
ist nach Peter folgender: «weil auf die freundliche Einladung zu gütlicher
Verhandlung ein Teil gar nicht und ein Teil nicht mit erforderlicher
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 367 - arpa Themen Projekte
ein für allemal vor das eidgenössische unparteiische Recht und befehle
ihnen, ihre Meinung darüber innert Monats frist dem Rate von Zürich
mitzuteilen, damit dieser einen Rechtstag bestimme; es wäre denn, dass
sich die Bauern mit ihren Obrigkeiten selbst vergleichen würden; unterdessen
sollten alle Feindseligkeiten eingestellt bleiben»! Um übrigens
die Bauern auf das Glatteis der Einzelverhandlungen mit den verschiedenen
Regierungen zu locken und auf diese Weise womöglich den Bund
zu sprengen, «versprach man den Ausschüssen, im Fall eines Vergleichs
mit ihren Obrigkeiten solle auch das anstössige Manifest vom 22. März
aufgehoben werden...» (Nicht also vorher, zur Beruhigung, sondern
erst als Belohnung für die Unterwerfung sollte diese schimpfliche
Brandmarkung des ganzen werkenden Volkes aufgehoben werden!)
Nachdem nun also die Herren auf diese Weise den Bauern eine «Monatsfrist»
gesetzt hatten, während welcher «alle Feindseligkeiten eingestellt
bleiben» sollten, beschlossen die Herren unter sich jedoch eine
ausgesprochene Kriegsmassnahme! Denn so steht es in dem «lakonischen»
Tagsatzungsabschied: «Wann dann Hr. Untervogt der Grafschaft
Baden (Schnorf) wiederum von seiner Verrichtung heimgelangen und
seine Relation ablegen wird» (also unmittelbar nach der Landsgemeinde
in Huttwil am 14. Mai), «sollen alsdann die drei Kriegshäupter, welche
von Zürich, Bern und Luzern werden ernannt werden, an ihnen gefälligern
Orte, so unvermerkt als möglich (!), zusammenkommen, wozu
Jeder einen Assistenten mitnehmen wird, um die fernere Nothwendigkeit
zu unterreden.»
Ja, wir können das Doppelspiel der Tagsatzung noch weiter verfolgen.
Während man nämlich eben beschlossen hatte, das neue «Patent»
an die Bauern zu senden, in dem man auch die Aufhebung des
ersten Badener Mandats vom 22. März in Aussicht stellte —beriet und
beschloss man am 8. Mai. ein neues Badener Mandat, das dem ersten in
seiner Qualität als Schimpfmandat in nichts nachsteht! Von diesem
durften die Bauern, die man inzwischen durch das ungeheure «Entgegenkommen»»
der Aufhebung des früheren Mandats hoffte kirre machen
zu können, erst recht keine Kenntnis bekommen. Denn auch dieses
neue Mandat war eine ausgesprochene Kriegsmassnahme. So wurde beschlossen,
«mit der Ausfertigung einzuhalten, bis die Nothwendigkeit
es erfordern werde; denn das Manifest ist allein zu Unserer G. H. Herren
und Oberen Entschuldigung gemeint, wenn alle angewandten gütlichen
und rechtlichen Mittel keine fernere Hoffnung mehr hätten».
Das heisst: in dem Augenblick, wo klar werden sollte, dass die Bauern
sich nicht einfach dem Willen der Herren —und zwar der einzelnen
Regierungen — unterwerfen würden, sollte «das liebe eidgenössische
Recht», vor das man sie doch für genau den gleichen Fall gleichzeitig
innert Monatsfrist einlud, ein Pfifferling wert sein! Man wollte für diesen
Augenblick, ganz gleichgültig, ob er schon lange vor Ablauf der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 368 - arpa Themen Projekte
Auszug der Bauern, unter Führung Leuenbergers, in
den Kampf bei Wohlenschwil, am 3. Juni 1653
Nach einem zeitgenössischen Originalgemälde im Besitze des
Schweizerischen Landesmuseums in Zürich (Pendant zu Abb. 25)
Leuenberger trägt die berühmte rote "Casaque", die ihm die
Entlebucher geschenkt haben. Die Bauern in nur leicht uniformierter
brauner Zivilkleidung (hier zweifellos stilisiert). Im
Hintergrund links: das Schloss Hilfikon; rechts: Villmergen. Die
Bedeutung der Fahne — je ein Gold-, Rot- und Weiss-Streifen
von unten nach oben quer zur Fahnenstange parallel übereinander
geordnet — ist unbekannt.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 368 - arpa Themen Projekte
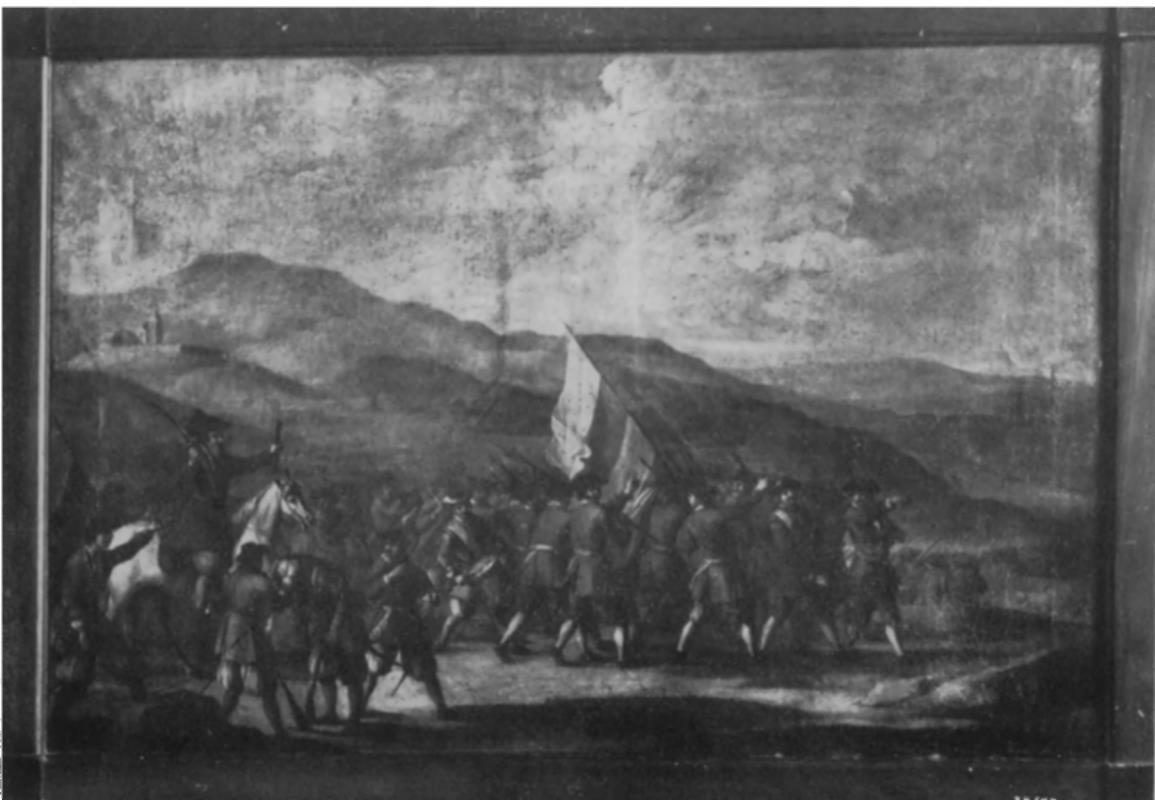
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 369 - arpa Themen Projekte
eingeräumten Rechtsfrist eintrat, gerüstet sein, um — ausser mit Waffen
—auch mit der ganzen «eidgenössischen» Gewalt der Propaganda
über das werkende Schweizervolk herzufallen und es abermals vor der
ganzen Welt zu diffamieren...
Dieses Mandat vom 8. Mai ist dann am 20. Mai wirklich publiziert
worden. Und dies zwar in einem Augenblick, als tatsächlich die Bauernschaften
aller vier aufständischen Kantone sich bereits in Verhandlungen
mit ihren zuständigen Regierungen eingelassen hatten —allerdings
mit dem festen Willen, echte Verhandlungen, von Gleich zu
Gleich, zu führen, unter keinen Umständen aber sich wie die Luzerner
am 19. März, zum Opfer eines Verhandlungsbetruges zum Zwecke der
Unterwerfung machen zu lassen.
Aber eben dies war in den Augen der Herren das «Verbrechen»,
das sie zum casus belli, besser: zum Kriegsvorwand, zu machen entschlossen
waren, und dies zwar bereits auf der Tagsatzung —- und darum
müssen wir das Mandat bereits an dieser Stelle behandeln. Denn
das Doppelspiel der Tagsatzungspolitik wird durch nichts besser bewiesen
als durch dieses Mandat vom 3. Mai. Wir übergehen den ganzen
Schwall endloser Lügen- und Schimpfanhäufungen in ebenso endlosen
Bandwurmsätzen, die ganze Perioden lang fast wörtlich aus dem Mandat
vom 22. März abgeschrieben sind. Aber es ist doch für die Abwägung
von Ursache und Wirkung im Bauernkrieg von grosser Bedeutung,
dass die Herren in diesem Mandat sich mit schamloser Offenheit
dazu bekennen; allein schon der Umstand, dass die Bauern ihre alten
Freiheitsrechte zur Diskussion und dadurch das Herrenrecht zur Unterdrückung
in Frage stellten, sei für die Herren ein zwingender Grund
zur Kriegserklärung gegen die Bauern. Das nämlich ist, nackt herausgeschält,
der konkrete Inhalt dieser Schimpflawine, und das macht das
Mandat vom 8. Mai zur eigentlichen Proklamation des autoritären und
totalitären Absolutismus in der Schweizergeschichte! Da heisst es:
«Weil... Unsere ungehorsamen und aufrührerischen Unterthanen...
diese Unsere, bei hohen Ständen althergekommene Submission
(Unterwerfung!) in den Wind geschlagen und verworfen..., haben Wir
anders der Sache nicht helfen können, als die Waffen mit Gottes Hilfe
zu ergreifen...»!
Nicht Not und Elend der Bauern, nicht Unterdrückung ihrer alten
Freiheitsrechte, nein — «dass sie, die Jahre her, in allzu gutem Frieden
und Ruhestand gesessen, viel unter ihnen mit ihrem üppigen, liederlichen
und unhauslichen Wesen verdorben sind und in solche Schulden
sich gesteckt haben, dass sie die nicht mehr zu bezahlen vermögen,
auch endlich in diese, nun lange bedachte (vielerwähnte) Félonie (Treulosigkeit)
und Untreue gerathen sind, dass sie, ihrer rechten, natürlichen,
ihnen von Gott vorgesetzten Oberkeit entsagend, an deren statt
selbst Herren sein wollen» —diese wahrlich nicht aus allzu vielem Frieden
und Wohlsein abzuleitenden blossen Symptome bezw. Endwirkungen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 370 - arpa Themen Projekte
das sind in den Augen der Herren «die wahren und eigentlichen
Ursachen» des Aufstandes! Und da die Symptome sich natürlich
an den Bauern zeigten, sind die Bauern an Allem schuld. Und darum,
da die Bauern all «die Jahre her in allzu gutem Frieden und Ruhestand
gesessen» —Krieg über sie!... Nur so kann man den Bauern beibringen,
«von ihrer hohen und natürlichen Oberkeit das Recht und die Berechtigung
der über sie führenden Herrschaft und oberkeitlichen Gewalt
und die Titel der Besitzung, in der sie nun bei dritthalbhundert
Jahren ruhig und unverrückt gestanden», endlich ohne Mucksen und
Murren anzunehmen, statt Brief und Siegel darüber «an End und Orten,
da es sich nicht gebührt... unter Augen gelegt» zu bekommen!
Und darum bleibt uns nur noch übrig, das Unterdrückungsinstrument,
das «Defensionalprojekt», kennen zu lernen, das die Tagsatzung
seit dem 7. Mai beriet und am 10. Mai beschloss. Wohlgemerkt: vier
Tage bevor noch der Untervogt und Tagsatzungsbote Schnorf dem Niklaus
Leuenberger auf der Landsgemeinde in Huttwil die Zitation der
Tagsatzung an die Bauern, «ihre Angelegenheiten, falls sie sich nicht
mit ihren Obrigkeiten vergleichen können, innert Monatsfrist ,vor das
liebe eidgenössische Recht zu bringen'» —auch nur überreichen konnte!
Wir geben das Dokument hier nach den Papieren des designierten Generalissimus
der Tagsatzungsarmee, des Zürcher Seckelmeisters Johann
Konrad Werdmüller, wieder, wie sie Peter im Auszug abdruckt:
«Da die Ungehorsamen die ihnen durch einen offenen besiegelten
Brief angebotenen Unterhandlungen vermittelst des lieben eidgenössischen
Rechts ausgeschlagen haben, also die schärferen Mittel notwendig
ergriffen werden mussten, ward auf Gefallen der Obrigkeit beschlossen:
1. Dass auf die bestimmte Zeit und an die bestimmten Orte
in der ganzen Eidgenossenschaft alle Orte und alle Zugewandte mobilisieren
und ausziehen sollen. 2. Die beiden Orte Uri und Unterwalden
sollen die Stadt Luzern und die Pässe zwischen Unterwalden und
Entlebuch beobachten: zu ihnen sollen ziehen, ausser ihrer eigenen
Mannschaft in genügender Zahl, achthundert von ihnen besoldete
Mann und 300 aus den welschen Vogteien ausser der Garnison, die die
Stadt Luzern bereits selbst aufgenommen, samt ihren gehorsamen
Untertanen; über diese Truppen soll ein gemeinsamer Kommandant
sein, nämlich... Sie sollen nicht allein die Stadt Luzern beschützen,
sondern auch deren Untertanen abhalten, den bernischen zuzuziehen
und Schaden zu stiften. 3. Schwyz soll sich gegen die Landesfeinde (!)
mit 500 Mann und Zug mit 400 Mann in der Gegend von Hitzkirch, in
den obern Teil der Freien Aemter legen, der an das luzernische Gebiet
stösst, und den Pass zwischen Hallwiler- und Baldeggersee beobachten;
ebenso soll Schwyz sich des Städtchens Sursee versichern und
mit den Truppen zu Luzern und im untern Teil der Freien Aemter
korrespondieren. 4. Glarus soll 300 Mann zu Fuss und 30 zu Pferd
stellen. 5. Appenzell a. -Rh. 400 Mann, Appenzell i.-Rh. 300. Diese sollen
sich neben einem Detachement, das Zürich hinzuzufügen belieben
mag, in den untern Teil der Freien Aemter legen und korrespondieren
mit dem folgenden Korps unter dem Kommandanten von Zürich. 6.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 371 - arpa Themen Projekte
lassen, wozu ausser 1500 Mann zürcherischer Truppen kommen sollen,
300 zu Fuss von Luzern und 200 Reiter; 300 von Schaffhausen und 50
Reiter; 200 von der Stadt St. Gallen und 200 vom Bischof von Basel und
50 Reiter; 1000 Mann aus Bünden ,in der drei Bünden eigenen Kosten.
Ausserdem bewilligt Zürich 1500 Mann und 150 Reiter in seinem Sold
zu werben'. 500 Mann zu Fuss wird Basel (mit Mülhausen) zu diesem
Korps stellen, dazu Schaffhausen zwei Feldstücke und Zürich deren
fünf samt Zubehör. Diese beiden Orte sollen sich auch versehen mit
Geniewerkzeug und mit Zimmerleuten zum Oeffnen der Wege, wie
auch mit Handgranaten. 7. Das andere Korpus im obern Aargau:
Bern, Freiburg und Solothurn samt Wallis; 2500 Mann zu Fuss gibt
oder besoldet Bern, 100 zu Fuss Freiburg, 500 zu Fuss Solothurn samt
100 Reitern. Dieses Korps so!! unter einem bernischen Kommandanten
stehen und von den drei Städten mit Schaufeln, Pickeln und Granaten
versehen werden. Wenn sich diese zwei Korps im bernischen Gebiete
befinden, sollen sie vom Rate zu Bern ,mit gnugsamem Brot' versehen
werden.
,Allen Völkeren soll ein gleicher Eid und dieselbe Ordonanz gemacht
werden', und alle weitern Notwendigkeiten zu beratschlagen
und zur Exekution zu bringen soll den drei verordneten Kommandanten
überlassen sein, welche sich zu diesem Zwecke ,an einem unvermerkten
Ort zusammentun sollen, wann der Abschlag des Rechts von
den Bauern wieder erfolgt, und jeder Ort soll sich auf weitern Notfall
mit mehrerem Nachdruck verfasst halten'.»
Wir ergänzen hier nach Liebenau:
«Dieser Kriegsplan, welcher sich in seinen Hauptzügen dem von
der Tagsatzung im März 1653 entworfenen Verteidigungsplan anschloss,
nahm also, abgesehen von dem zur Verteidigung der Stadt
Luzern bestimmten Kontingent, eine Armee von 11880 Mann in Aussicht.
Von dieser Truppenmacht sollte ein Teil von Luzern auf dem
Wege der Werbung aufgebracht werden. Wir wissen auch, dass man
dabei an Werbungen in Würtemberg dachte und dass angeblich der
Graf von Fürstenberg 6000 Mann anerboten hatte. (!)
Die Ereignisse der folgenden Tage nötigten die Regierungen von
Bern und Zürich, ihre Truppenmacht zu vermehren, so dass Bern
allein 7000 Mann, Zürich mit seinen Zuzügern 9000 und Luzern mit
den Urkantonen, den Truppen aus den italienischen Vogteien und den
Landen des Fürstabtes von St. Gallen 5000 Mann im Felde hatte.»
Als Generäle der drei Divisionen waren dieselben vorgesehen wie
schon beim Aufgebot durch die März-Tagsatzung: Zwyer für das innerschweizerische
Korps samt Zuzug, Sigmund von Erlach für das bernische
und Seckelmeister Werdmüller für das zürcherische sowie zugleich
als Oberbefehlshaber für die ganze Tagsatzungsarmee; auch der Stab
der letzteren war naturgemäss derselbe, der sich hauptsächlich aus der
Werdmüller-Familie rekrutierte.
Inzwischen hatte sich jedoch etwas ereignet, was Werdmüller einigermassen
einen Strich durch die Rechnung machte: die oberen Freien
Aemter, Hitzkirch, Meyenberg, Man und Bettwil, waren, wie wir sahen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 372 - arpa Themen Projekte
zum Bauernbunde und die Neutralitätserklärung des Deutsch-Ordenshauses
daselbst», so sagt Liebenau, «wurde der Feldzugsplan der Tagsatzung
durchkreuzt, indem jetzt Hitzkirch nicht mehr als Waffenplatz
der I. Division dienen konnte, welche die Verbindung durch das Seetal
nach Luzern und Lenzburg vermitteln sollte.» Das verstärkte auch die
Bedeutung des von den Bauern ebenfalls neugewonnenen festen Platzes
Sursee als Sperre im gleichen Sinne.
Am gleichen Tage nun, da die Tagsatzung sich an die definitive
Aufstellung des «Defensionalprojektes» machte, am 7. Mai, traten auch
die unteren Freien Aemter geschlossen zum Bauernbund über: d. h. die
Aemter Villmergen, Sarmenstorf, Wollen, Krummamt (das sich mit
neun Kirchspielen «krumm» an der Reuss entlang zieht), Boswil, Niederwil,
Hägglingen, Dottikon und Büblikon. Damit war nun auch das
künftige Schlachtfeld bei Mellingen und Wohlenschwil definitiv mit in
den Aufstand einbezogen.
Es waren vor allem die Hitzkircher, die die Freien Aemter von
oben bis unten auf die Beine brachten. Auf einer eigenen Amtsgemeinde
in Hitzkirch am 4. war es so hitzig zugegangen, dass der dortige Pfarrer
Frey dreimal mit dem «Venerabile» dazwischen treten musste; er
«beschwor sie, keinen voreiligen Beschluss zu fassen, sondern zuvor
auch die Gesinnung und Ansicht der übrigen freien Aemter einzuvernehmen
». Damit trug der gute Pfarrer, ganz gegen seine Absicht, nur dazu
bei, die Revolution in alle Aemter zu tragen. Denn nun eilten die
Hitzkircher, von Luzernern aus Hochdorf begleitet, von Amt zu Amt
und brachten am 7. Mai «eine Landsgemeinde der sämtlichen freien
Aemter in Boswil» zusammen.
Sofort eilte der Generalissimus Werdmüller herbei, im Auftrag der
Tagsatzung und begleitet von je einem Vertreter Unterwaldens und Uris.
Da nämlich die Freien Aemter nur den VII alten Orten, nicht allen
XIII, unterstand, so waren sie vorzüglich das Ausbeutungsobjekt der
innerschweizerischen «Landsgemeinde-Kantone». Wie gründlich korrumpiert
diese angeblichen «Demokratien» durch den Besitz dieser
Untertanenländer bereits waren, geht aus den wahrhaft haarsträubenden
Beispielen landvögtlicher Erpressungen an den Freiämtler Bauern
hervor, mit denen gerade die anlässlich der Boswiler Landsgemeinde
zusammengestellte Klageschrift zuhanden der Tagsatzung gespickt ist.
Darin wird nach Vock z. B. ausgeführt, wie die Willkür der Landvögte
«bis auf den gegenwärtigen gestrengen Landvogt Niklaus Wipflin von
Uri so drückend geworden sei, dass dieser sich für Erneuerung der
Wirtschaftspatente 70 Gulden, für einen Augenschein in Villmergen
180 Gulden und wegen des Widerstands der Gemeinde Wohlen gegen
den ihr aufgedrungenen Untervogt 152 Gulden Bussgeld, und 400 Gulden
Entschädigung für seine Reise von Uri nach Wohlen (!) zahlen
liess». Aber deswegen wurde Herr Wipflin nicht etwa von der Tagsatzung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 373 - arpa Themen Projekte
nur heuchlerisch angewiesen, «mit aller müglichen Bescheidenheit zu
verfahren, damit die Untertanen lernten, die Obrigkeit nicht allein zu
fürchten, sondern auch zu lieben»!
Als nun Werdmüller mit seinen Trabanten am 7. früh in Boswil
ungerufen erschien, um im Auftrag der Tagsatzung die von den Aemtern
autonom und spontan einberufene Landsgemeinde zu überrumpeln und
durch Predigen des immer gleichen heuchlerischen Friedens, der Güte
und des Gehorsams eine Verhörs- und Kapitulantenversammlung daraus
zu machen —da kam er an die Lätzen! Die Leute, besonders die
Hitzkircher, Villmerger und Meyenberger, schrien den grossmächtigen
Werdmüller nieder: «Was es da viel zu predigen brauche?» fiel ihm
der Altseckelmeister Keusch von Boswil ins Wort. «Sie seien nicht deswegen
hierhergekommen, sondern in der Meinung, eine Landsgemeinde
abzuhalten, und dazu hätte man keine Herren von der Tagsatzung nötig
gehabt»! Und als die Kapitulanten gewisser Gemeinden, durch die
Anwesenheit der Tagsatzungsherren dazu ermuntert, kriecherische Vorschläge
zur gütlichen Einigung mit den Herren machen wollten, da
fuhr ihnen der Seckelmeister Hildbrand von Boswil übers Maul und
sagte: «der gemeine Mann habe ihnen, den geschossenen nicht befohlen,
eine solche Erklärung zu tun», sondern sich nach den Richtlinien
der drei revolutionärsten Aemter, Hitzkirchs, Meyenbergs und Villmergens,
zu richten; ausserdem habe man den Luzerner Bauern (wie
bei Peter steht) «ein lästerliches Mandat zugestellt, das wenig guten
Willen auf seiten der Tagsatzung verrate». Auch der Ammann Heinrich
Meyer von Hilfikon denunzierte die Kapitulantengeschworenen als
Volksverräter: «Man sehe nun, welchen Weg es gehen solle und dass
die Geschworenen, ohne Rücksicht auf den Befehl des Volks, machen
werden, was sie wollen»!
Auf diese Weise vertrieben die Bauern die Tagsatzungsherren aus
ihrer Landsgemeinde, wobei es so unsanft herging, dass der Seckelmeister
von Boswil den Seckelmeister von Zürich, wie Peter erzählt, «heftig
schüttelte, indem er schrie: ,Die Unruwen sind dissem Herrn sehr angelegen,
dass er so mager!'» «Die Gesandten kehrten», wie Vock berichtet,
«nach Baden zurück; die Deputierten der untern und obern freien Aemter
aber hielten, nach Ankunft der Meyenberger, die Landsgemeinde
und beschlossen, den Tag zu Huttwil am 14. Mai mit Abgeordneten aus
allen Aemtern zu beschicken und mit den Landleuten der verschiedenen
Kantone, zur Verteidigung des Vaterlands gegen das fremde Kriegsvolk,
zusammenzuschwören.»
Im Solothurnischen rebellierten am selben 7. Mai die Bucheggberger
und verlangten, auch sie, «man solle ihnen aus Briefen und Urkunden
zeigen, wie und mit welchen Bedingungen sie unter die Herrschaft
von Solothurn gekommen seien». Der gute alte Staatsschreiber Franz
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 374 - arpa Themen Projekte
dem «greulichen Kometen mit dem gestutzten Bart» die Schuld
am Bauernkrieg in die Schuhe schob —wurde daraufhin von der Regierung
beauftragt, «diese Urkunden im Archive herauszusuchen, damit
sie den Bauern nächster Tage vorgelesen werden können». Aber der
gute Hafner wird kaum sofort Zeit dazu gehabt haben; denn schon am
nächsten Tag wurde er, mit dem Schultheissen Sury zusammen, an der
Spitze einer Ratsdelegation von sieben Häuptern an eine grosse Kantonallandsgemeinde
aller solothurnischen Aemter in Oberbuchsiten, geschickt.
Es galt, die Bauern durch allerhand Konzessionen und Versprechen
von einer abermaligen Beschwörung des Bundes abzuhalten.
«Dessenungeachtet wählten sie», nach Vock, «wieder Ausschüsse zur
Landsgemeinde in Huttwil und erteilten ihnen den Auftrag, zu erklären,
dass wenn fremde Kriegsvölker ins Land kommen werden, die
Solothurner Bauern Leib und Blut, Hab und Gut daran setzen wollen,
dieselben wieder herauszutreiben.» Ihre auf gesetzten Beschwerden
schickten sie am 10. durch eine ebenfalls siebenköpfige Delegation —
wie die der Herren — an den Rat.
Am Sonntag, dem 11. Mai, fand in Subingen eine grosse Landsgemeinde
der Vogtei und Herrschaft Kriegstetten statt. Diese richtete eine
«Adresse» an die für den 14. bevorstehende Huttwiler Landsgemeinde.
Dieses Schreiben gibt die richtige Antwort des Solothurner Volkes an
die heuchlerischen Bemühungen der Regierung, es durch fromme Versprechen
und Ermahnungen zu korrumpieren: dass zwar die «Oberkeit
der Stadt Solothurn uns anerboten hat, was wir uns zu beschwert bedünken
zu sein, wir dasselbig sollen in Freundlichkeit einer hochweisen
Oberkeit fürbringen, und sie uns versprochen hat, in demselbigen ein
Einsehen zuthun, wir aber in demselbigen gar nichts haben ausgerichtet,
und hat sie uns in demselbigen nur schier ausgelacht»! Ferner geht
aus diesem Schreiben hervor, dass die Regierung an eben diesem 11. Mai
in allen Kirchen ein Mandat hatte verlesen lassen, mit dem sie versuchte,
der militärischen Wachbereitschaft des Bauernbundes im ganzen
solothurnischen Gebiet in den Arm zu fallen. Nämlich dieses Mandates
«Inhalt ist, dass man keine Boten an Pässen oder anderswo aufhalten
noch verhindern solle, viel weniger die Briefe ihnen nehmen
und eröffnen.., und das bei höchster Strafe». Die Antwort der Bauern
auf dieses Mandat lautet: «Was nun diese Missiv lauten thut, sind wir
ganz darwider; denn es ist unser Will und Meinung, dass man Niemand
solle lassen passieren, insonderheit was fremde Völker sind, sondern
dieselbigen wieder zurückschicken. » Gegen den Versuch der Regierung,
die Solothurner Bauern vom Bund abspenstig zu machen, heisst es in
diesem Schreiben: «Weil aber uns unsere Oberkeit hoch verboten hat,
dass wir uns nicht sollen verbinden mit andern Völkern, haben wir uns
in demselbigen nicht wollen lassen abwendig machen, noch viel weniger
erschrecken, sondern, dieweil wir allezeit Euere» (d. i. der Huttwiler
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 375 - arpa Themen Projekte
Nutz und Heil dem Vaterland, also haben wir uns gänzlich entschlossen,
uns mit Euch zu verbinden, so lang und viel, bis wir alles dasjenige
ins Werk bringen, was wir Vorhabens sind, und das mit Leib, Gut
und Blut bis in alle Ewigkeit... Was aber die grossen Bürden und Ungerechtigkeiten
antreffen thut, auch Tyrannei, darwider wollen wir
streiten und fechten bis auf das Blut, wie unsere frommen Altvordern
selig. Dazu helfe die allerheiligste Dreifaltigkeit, Gott, Vater Sohn und
hi. Geist, Amen.» Es folgt die Unterschrift «Die Vogtei und Herrschaft
Kriegstetten», und dann noch der Wahlspruch: «Nur frei, stark und
fest.» Selbst Vock druckt dieses Schreiben ab «als Beweis, wie das
Landvolk überall von dieser grossen Bewegung ergriffen war»! Zwei
äusserst wichtige revolutionäre Vorschläge, die von den tapferen und
klugen Kriegstettern in diesem Schreiben der Huttwiler Landsgemeinde
gemacht wurden, werden wir bei der Behandlung dieser letzteren kennen
lernen. Der Verfasser dieses Schreibens ist Urs Kaufmann von Horriwil;
Urs Hofstetter von Volken hat es nach Huttwil gebracht.
Der Solothurner Rat seinerseits liess inzwischen, «etlicher Punkte
halb, durch den Staatsschreiber die alten Urkunden im Gewölb' aufsuchen
und darin nachschlagen, in wie weit die Forderungen der Untertanen
begründet seien» usw. «Damit nicht von neuem wiederum ein
Aufruhr erweckt werde», wie es in einem Ratsbeschluss vom 13. steht,
wurden an diesem Tag bernische Schiffe, die nach Klingnau bestimmt
waren, auf der Aare angehalten «und auf Befehl des Rats vom Zollner,
im Beisein des Grossweibels, visitiert, ob nichts Verdächtiges darin sei».
Am 14. Mai, mithin genau am zweiten Huttwiler Tag, «wurde der Vorschlag
zur Pacification mit den Bauern von Rät' und Burgern gutgeheissen
und die Regierung zu weiterer Unterhandlung bevollmächtigt».
Doch überlassen wir die Solothurner Regierung vorläufig ihren
Nachforschungen im romantischen «Gewölb» —und ihrer nicht geringen
Angst — und sehen wir zu, wie die Basler Herren und die Basellandschäftler
das Rennen für oder gegen Huttwil bestritten. Am 5. erschien
der Held von Aarau, Oberst Zörnlin, an der Spitze einer dreigliedrigen
Ratsdeputation in der Rebellenstadt Liestal, um dieser, wie
Heusler berichtet, «das höchste Befremden über die nach dem freundlichen
Entgegenkommen der Obrigkeit angestellte Landsgemeinde auszusprechen»
und die Liestaler eindringlich dazu zu mahnen, «sie sollten
daher nicht allein sich nicht weiter auf Antrieb böser Gesellen vertiefen,
sondern auch die übrigen Aemter, als welcher Absehen einzig
und allein auf Liestal gerichtet sei, davon abhalten». Es «sollte ihnen
vorgestellt werden, ob es nicht besser sei, im Frieden seinen Berufsarbeiten
abzuwarten, als mit verletztem Gewissen in steter Furcht der
gerechten Gerichte Gottes (!) zu stehen, welche gewiss bei denen, so sich
ihrer Obrigkeit (!) unrechtmässiger Weise beharrlich widersetzen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 376 - arpa Themen Projekte
Herrenregiments, ein echt Wettstein'sches Lied, sollten die Landvögte
am gleichen Tag auch den vier rebellischen «oberen Aemtern» vortragen.
Deren Ausschüsse aber, und also diejenigen Männer, für die das
Lied besonders bestimmt war, sassen an eben diesem 5. Mai in Höllstein
zusammen und beschlossen «eine neue Supplikation». Als «Eingang»
zu dieser Supplikation wählte man «die von Isaak Bowe an der
letzten Landsgemeinde vorgetragene «Rechtfertigung des Rundes von
Huttwil». Das war also ein durchaus anderes Lied! Ausserdem beklagte
man sich darin «wegen des Benehmens der Soldaten» beim Auflauf am
17. April, sowie über «die aufgefangene Munition in Aarwangen».
Schliesslich wurde die Regierung ermahnt, sie «möge sich hüten, Verhaftungen
wegen dieser Unruhe vorzunehmen, dagegen bei hoher Strafe
verhindern, dass man die Bauern rebellische Schelmen schelte»! Das
klang auch anders, als die Herren es zu hören wünschten.
Im übrigen zeigt der Hauptinhalt dieser Supplikation, wie weit zurück
die Basellandschäftler im Vergleich mit den Entlebuchern und
Willisauern, ja auch hinter den Berner Bauern, waren. Keine, auch
nicht die leiseste Andeutung von solchen Forderungen politischer Freiheitsrechte,
wie sie am 3. beim Heiligen Kreuz, am 6./7. in Willisau erhoben
wurden. Ausser der grundsätzlichen Rechtfertigung des Huttwiler
Bundes —und der Kritik an der Borkener Schiffsgeschichte —nichts
weiteres von eidgenössischem Belang. Vielmehr stehen die Postulate
dieser Supplikation noch auf derjenigen Stufe, die die Luzerner Bauern
mit ihren Forderungen schon ganz im Anfangsstadium des Aufstandes,
Wochen vor dem Wolhuserbund, erreicht hatten! Diese politische Rückständigkeit
der Führung der Basler Bauern ist einer der Hauptgründe,
warum diese, trotz all des prachtvollen revolutionären Muts und
Schwungs, den sie von Anfang an bewiesen und bis zuletzt entwickelten,
bei der bevorstehenden eidgenössischen Austragung des grossen Kampfes
um die allgemeine Volkssache so weit ins Hintertreffen gerieten.
Folgendes sind die gemeinsamen Forderungen der vier Aemter
Farnsburg, Waldenburg, Homburg und Ramstein in der am 5. Mai in
Höllstein beschlossenen, am 8. Mai in Basel überreichten Supplikation.
Sie forderten: «1. freien Salzkauf und Verkauf für eigenen Bedarf, sowie
freien Kauf und Verkauf von Früchten, Vieh und anderm, auch
Erlass des Eides wegen des Salzkaufs; 2. Abschaffung der neuen Zölle
in Basel, besonders auf Leder; dieses begehren auch die Liestaler; 3. Erlass
der Stumpflösi (einer Abgabe für die Nutzung des Hochwalds für
Bauholz etc.); 4. Nachlass der 2 Gulden bei Hochzeiten; 5. Milderung
des Weingelds.» Das ist Alles! Noch dazu haben die Ausschüsse der
Liestaler und Waldenburger beim Punkt 5 «dagegen geredt, weil die
Sache vor 60 Jahren abgemacht worden, und sie nicht widersprechen
könnten, was ihre Eltern gegen die Obrigkeit eingegangen»! Folgen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 377 - arpa Themen Projekte
betrafen hauptsächlich Bussen, Taxen, Erhaltung alter Rechte und
Uebungen, und Abschaffung der Zünfte auf dem Lande»; dies letztere
ist noch das relativ revolutionärste Postulat, weil es an eine wirtschaftliche
Grundlage des politischen Absolutismus, an das Gewerbemonopol,
tastet. «Auch die Klagen der einzelnen Aemter betrafen solche Spezialpunkte.»
Bezeichnend für die mangelnde Wachsamkeit in der politischen
Führung ist auch, dass noch auf dieser Stufe der allgemeinen Entwicklung
der Bauernsache der Liestaler Stadtschreiber-Substitut Stähelin,
der auf beiden Schultern trug, den Schreiber der Bauern in Höllstein
am 5. Mai spielen konnte und dass die Bauern dessen Doppelspiel überhaupt
nicht zu entlarven vermochten. Ob nicht die Doppelrolle dieses
schreibkundigen Herrendieners eben darin bestand, den Bauern unter
der gut gespielten Maske des rebellischen Biedermanns von der Aufnahme
auch wirklich vorhandener politischer Mehrforderungen «zum
Nutzen der revolutionären Sache» abzuraten? Dann bewiese das allerdings
nur, dass die Basler Bauern wirklich keinen politischen Kopf
unter ihren Führern hatten, sodass also der Spion Stähelin politisch ihr
einziger «Führer» gewesen wäre!
Wenigstens aber wurde in Höllstein beschlossen, «die Supplikation
nicht durch Ausschüsse überbringen zu lassen», angeblich, «weil bei
diesem Wesen keinem zuzumuten, sich nach Basel zu begeben». Entscheidend
jedoch wird die schlimme Erfahrung gewesen sein, die man
mit der Rolle der Kapitulanten unter den Ausschüssen, besonders mit
dem Untervogt Wirz aus Buus, bei der Ueberreichung der ersten Supplikation
Anfang April gemacht hatte. Man schickte die zweite am 8. Mai
nur durch Leute ohne jede Vollmacht zu Verhandlungen nach Basel,
durch reine Briefboten. Diese Boten scheinen keineswegs freundlichen
Bescheid bekommen zu haben. Die Herren XIII (d. h. die Regierung)
hatten an diesem Tag «von Morgens 7 bis Mittags 12 Uhr auf die Ausschüsse
gewartet»; als nun statt ihrer nichtbevollmächtigte Leute erschienen,
bei denen ein Korrumpierungsversuch nichts abtragen konnte,
scheinen die Herren die Nerven verloren zu haben; denn der obgenannte
Schreiber Stähelin schreibt von diesen Boten (vielleicht hatte er sich
selber als Ueberbringer anerboten!), «es sei ihnen gesagt worden, die
Antwort werde nächstens mit 500 Mann erfolgen»!
Das revolutionäre Temperament der Basellandschäftler aber liess
sie die gnädige Antwort der Herren nicht erst abwarten. Ohne Rücksicht
auf sie beriefen sie auf den 12. Mai eine zweite grosse Landsgemeinde
nach Liestal, und zwar zu dem Hauptzweck, die Ausschüsse
für Huttwil zu wählen! «Ungefähr 1000 Bewaffnete erschienen an derselben
und gegen 1000 Knaben mit weissen Fähnlein.» Als der Herrendiener
Schultheiss Imhoff im Namen der Regierung zu der Menge sprechen
wollte, erhob sich ein Tumult. Aengstlich drückten sich die Räte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 378 - arpa Themen Projekte
faulen Haufen». Ueberhaupt waren die Waldenburger unter ihrem
Führer Schad auch bei diesem Tumult wieder die Hitzigsten. Alsdann
wurden die Ausschüsse für die Landsgemeinde in Huttwil gewählt.
Leider wissen wir sehr wenig über den ganzen Verlauf der Liestaler
Versammlung und darum auch über diese Wahlen. Sicher aber ist,
dass wiederum Isaak Bowe und Uli Schad an der Spitze der Ausschüsse
nach Huttwil gingen, wer und wieviele aus den vier Aemtern es sonst
waren, wissen wir nicht.
Wohl aber kennen wir die Namen derer, die von der Bürgerschaft
Liestals nach Huttwil delegiert wurden. Auch auf der ersten Huttwiler
Gemeinde waren bereits zwei Liestaler Bürger erschienen, aber keiner
vom Rat. Jetzt wurden ihrer drei offiziell abgeordnet, wieder zwei
Nicht-Räte, der Hutmacher Michel Strübin und der «Rotgerber» Hans
Jakob Gysin; das Erstaunlichste aber war: der Rat selbst sandte eines
seiner Mitglieder, den Schlüsselwirt Samuel Merian, als Gesandten nach
Huttwil! Wie das zuging, wissen wir nicht genau. Konrad Schuler, einer
der energischsten rebellischen Bürgerführer, gab später an, «Schultheiss
Imhoff habe das Mehr für Merian gemacht», was diese Wahl
allerdings sehr bedenklich machen würde. Aber diese Aussage passt
schlecht sowohl zu der feststellbaren Rolle Merians, wie auch zu derjenigen
Imhoffs (wenn dieser damit nicht den «Vetter» Merian bewusst
kompromittieren wollte!). Merian selbst sagte später aus, «die Gemeinde
habe mit Bewilligung von Schultheiss und Rat drei in die Wahl gezogen
und ihn gewählt». Jedenfalls aber hat der Rat die Delegierung
eines seiner Mitglieder zur Beschwörung des «hochverräterischen» Bauernbundes
offiziell bewilligt. Und es muss schon so sein, dass dies deshalb
geschah, weil die Mehrheit des Rates während dieser Landgemeinde
für die Bauernsache gewonnen werden konnte. Es wäre sonst
nicht einzusehen, warum der entschlossene Herrendiener Imhoff es für
nötig fand, sofort nach diesem Beschluss den Schauplatz seiner amtlichen
Tätigkeit unter Uebergabe seines Amtssiegels für die ganze
übrige Dauer des Aufstandes zu räumen. «Nach dieser Gemeinde», berichtet
Heusler, «entfernte sich der Schultheiss Imhoff von Liestal, das
Siegel aber liess er dem Stubenmeister Lauser zurück, welcher es dem
Schlüsselwirt übergab.»
Mit Samuel Merian aber wanderte das Stadtsiegel von Liestal schon
am nächsten Tag nach Huttwil und wurde dort schon am übernächsten
Tag auf den neu beschworenen, endgültig bereinigten und vierfach in
Pergament ausgefertigten Bundesbrief gedrückt!
Im Kanton Zürich blieb es die ganze Zeit über merkwürdig still.
«Es mag auf den ersten Blick auffällig erscheinen», bemerkt der Zürcher
Herrenchronist G. J. Peter, «dass die Zürcher Bauern mit den
bernischen Untertanen nicht etwa gemeinsame Sache machten, wiesen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 379 - arpa Themen Projekte
in den Kantonen Zürich und Bern unbedeutende Unterschiede auf...
Die Gefahr des Hinübergreifens der Bauernunruhen auf den Kanton
Zürich lag umso näher, als die unzufriedenen Berner und Luzerner
Bauern Sendlinge in die Ostschweiz ausschickten, um die gesamte
Bauernschaft zum Anschluss an den ,Volksbund' zu bewegen.» Dass
es trotzdem im Kanton Zürich ruhig blieb, führt der Zürcher Herrenchronist
naturgemäss auf die Weisheit der Zürcher Herren, auf «eine
Vorsichtsmassregel», zurück: «auf die rechtzeitige Entgegennahme der
Klagen, zu denen Verwaltung und Gericht Anlass gaben». Denn «Alles»
war ihnen «daran gelegen, dass gerade der Vorort von einer Erhebung
seiner Untertanen verschont bleibe: es galt also für den Zürcher Rat
den allfälligen Wühlereien (sic!) unzufriedener Elemente zuvorzukommen
und sich der Treue des Landvolkes zu versichern».
Wir haben die «Vorsichtsmassregel» der Zürcher Herren, sich der
«Treue» der Bauern zu versichern, bereits kennen gelernt: sie waren
die grosszügigsten demagogischen Volksbetrüger aller damaligen
schweizerischen Herrenregierungen! Sie schickten bald den einen,
bald den andern von ihren «besten» Ratsherren reihum durch die Zürcher
Aemter, und jeder brachte eine wundervolle Liste von samt und
sonders im voraus «bewilligten» Volksbegehren als Versprechungen mit,
die, wenn sie gehalten worden wären, ja wirklich jede Revolution gegenstandslos
zu machen schienen. Jetzt war der zweite Seckelmeister
Hans Ludwig Schneeberger an der Reihe für eine solche «Visitations»-Tour.
Nach seinem eigenen, von Peter wiedergegebenen Bericht an den
Rat vom 14. Mai, leitete er die Verhandlungen mit folgender Ansprache
ein, die ein grelles Licht bigotten Aberglaubens auf das geistige Niveau
dieser Herren wirft: er wies darauf hin, «was gestalten der getreue
liebe Gott uns vordem und sonderlichen im jüngstverwichenen letzteren
Jahre mit grossen Wassern, ungewohnten Winden, vielfachen Erdibidemen
(Erdbeben) und höchst schädlichen und verderblichen Wettern
und Strahlen zur Büess- und Besserung des Lebens eiffrig und treulich
ermahnet, und auf Nichterfolgung derselben so gefährliche Sachen in
unserm lieben Vaterland, so entlieh selbstlich den Untergang angetreuwt,
indem sich die Untertanen Luzerns gegen ihre Obrigkeit erhoben
und die benachbarten Untertanen Löblicher Statt Bern zu
gleichmässigem Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen ihre ordenliche
Oberkeit aufgestachelt und angezündt und also hiedurch das
allgemeine liebe Vaterland in nit geringe Gfahr gsetzt habind» — das
Vaterland der Herren, versteht sich! Das ist genau das geistige Niveau
des in derselben Weise frommen, wenn auch katholischen Staatsschreibers
Hafner von Solothurn und seiner Kometen-Abergläubigkeit.
Ein geistig auf derselben Stufe stehendes demagogisches Mittel
der Zürcher Regierung war die splendide Bewirtung der Bauernabgeordneten
auf obrigkeitliche Kosten. Z. B. berichtet Peter: «Diese
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 380 - arpa Themen Projekte
Ratsherren im Gasthaus zum Sternen in Enge auf obrigkeitliche Kosten
bewirtet. Wie sich aus den Seckelamtsrechnungen ergibt, wurden
jeweilen nach den Verhandlungen mit Seckelmeister Schneeberger
auch die Ausschüsse der übrigen Aemter und Herrschaften auf Staatskosten
bewirtet, und zwar recht splendid, indem, auf den Mann durchschnittlich
etwa drei Pfund ausgegeben wurden.» Mit sehr bezeichnendem
Sarkasmus — volksfeindlichem Sarkasmus — erteilt der moderne
Herrenchronist Peter den damaligen Volksverächtern die Sanktion
für diese «Vorsichtsmassregel», indem er beifügt: «Dieses Mittel
der Bewirtung war offenbar vorzüglich geeignet, die Untertanen eng
an die väterliche Regierung zu fesseln»!
Aber der wahre Grund der erstaunlichen «Treue» und «Ruhe»
der sonst immer gern an der Spitze der Rebellionen marschierenden
Zürcher Landleute während des Bauernkriegs war ein ganz anderer;
ein tiefsitzender objektiv-geschichtlicher Grund, den unser Herrenchronist
sich hütet, gebührend ans Licht zu ziehen. Dafür tut dies in
anerkennenswerter Offenheit der Berner Rechtslehrer Carl Hilty in
seinem zur 600-Jahrfeier der Eidgenossenschaft erschienenen Buch
über die schweizerischen Bundesverfassungen. Dort nämlich steht
über den Wädenswiler Aufstand vom Jahre 1646, bezw. über die
«Kassierung der Freiheitsbriefe von Wädenswil und Richterswil»,
folgende plastische Schilderung zu lesen: «Generallieutenant Leu und
Oberst (Johann Konrad) Werdmüller landeten plötzlich am 21. September
1646 mit 60 Schiffen voll Truppen in Wädenswil, liessen die
Bewohner der beiden Gemeinden, die sich gegenüber der Stadt auf
ihre Freiheitsbriefe berufen hatten, mit Weib und Kind auf 'Zollinger's
Matte' zusammentreiben und dort, von Truppen umstellt, erklären, ,ob
sie vielleicht die Briefe und Urkunden zu ihrem ferneren Unheil noch
länger zu behalten begehren, oder ob sie dieselben, damit sie ihnen
nicht mit Gewalt weggenommen werden, Unsern gnädigen Herren und
Obern freiwillig übergeben wollen'. ,Dieses Letztere' — so berichtet der
Augenzeuge —,hielten sie für das Beste, warfen sich mit Weibern und
Kindern auf die Kniee und schrieen um Gnade', worauf ihnen der Generallieutenant
den gewöhnlichen Eid, ,welchen er vorher in einigen
Punkten abgeändert und nach den gegenwärtigen Umständen eingerichtet
hatte', (nämlich mit Weglassung aller Stellen, welche die Freiheiten
des Landes vorbehielten) herunterlesen und von Allen, im Beisein
ihrer Weiber und Kinder beschwören liess.»
Wenn wir bedenken, welch fundamentale Rolle die Freiheitsurkunden
bei allen Aufständischen im Bauernkrieg 1653 spielten, so ist
nicht schwer zu ermessen, welche Lähmung für die Zürcher Bauern
es bedeutete, dass sie die einzigen Dokumente, auf die sie sich bei einer
Erhebung hätten berufen können, erst vor sieben Jahren «freiwillig»
— «legal» — weggegeben hatten! Ausserdem aber bestand die «nachhaltige
Einschüchterung», von der der Zürcher Herrenchronist Peter
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 381 - arpa Themen Projekte
dass anno 1646 sieben Bauernführer aus den Aemtern Wädenswil und
Knonau in Zürich hingerichtet und zahlreiche andere schwer an Leib
und Gut gebüsst worden waren.
Die Zürcher Bauern hatten also die blutige und zornwütige Niederschlagung
ihrer Freiheitsbegehren bereits hinter sich, die den jetzt
auf gestandenen Bauern der übrigen Schweiz erst noch bevorstand.
Die Zürcher Herren genossen mithin bereits während des Bauernkriegs
den — von den andern Herrenregierungen vielbeneideten
«Vorteil», ihrem Volk das Rückgrat schon gebrochen zu haben und so
das blutige Fundament des absolutistischen Regimes bereits zu besitzen,
das die übrigen Herrenregierungen eben jetzt auf der Tagsatzung
auf gleiche Weise zu schaffen beschlossen hatten und das dann
die «freie Eidgenossenschaft» durch Richtschwert und Halseisen bis
zum Jahr 1798 aufrecht erhielt...
Doch kehren wir, solang wir dies noch können, zu den für diesen
geschichtlichen Augenblick noch freien Schweizer Bauern zurück.
«Mit der grössten Spannung sah man in der ganzen Eidgenossenschaft
der zweiten Landsgemeinde von Huttwil (14. Mai) entgegen»,
sagt Peter mit Recht. In der Tat war diese Landsgemeinde des Volksbundes
auf der Höhe des stürmischen Mai im voraus eine gemeineidgenössische
Angelegenheit wie seit Jahrzehnten und auf Jahrzehnte
hinaus keine zweite mehr. Ja, man kann ruhig sagen, dass zwischen
der Reformation und dem Jahr 1798 kein zweiter Höhepunkt der
schweizerischen Volksgeschichte anzutreffen ist, der bezüglich der
Teilnahme des Volksganzen mit diesem Ereignis zu vergleichen wäre.
Alle Volksbewegungen der ersten Maihälfte spitzten sich, wie wir
sahen, auf dieses letzte grosse Fest der alteidgenössischen Volksfreiheit
zu. Die grosse Hoffnung — und die tragische Illusion — der
Bauern war dabei die: durch das blosse Aufgebot aller ihrer angesehensten
Männer zur endgültigen feierlichen Beschwörung ihres grossen
Bundes müsse es gelingen, die Herren zur Anerkennung desselben zu
bringen, und unter der Garantie des Bundes müsse es dann ein Leichtes
sein, die kantonalen Forderungen jedes Einzelgliedes bei den einzelnen
Regierungen durchzusetzen. Es war also gerade umgekehrt wie
unsere Herrenchronisten — ich zitiere Peter — behaupten: «...den
Bauern war es nicht ernstlich um Unterhandlung zu tun; sie drängten
vielmehr rasch auf eine Entscheidung mit den Waffen hin». Leider war
es ihnen viel zu viel um Unterhandlungen zu tun — und viel zu wenig
um die Rüstung und das rechtzeitige Losschlagen!
Gerade weil sie bisher bei allen Einzelunterhandlungen im kantonalen
Rahmen betrogen worden waren, wollten die Bauern sich eine
bessere Verhandlungsposition schaffen, indem sie sich überkantonal
verbanden und der verbündeten Macht der Herren die verbündete
Macht des Volkes entgegensetzten, um überhaupt von Gleich zu Gleich
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 382 - arpa Themen Projekte
Gleichheitsinne überhaupt nie «ernstlich um Unterhandlung zu
tun», vielmehr ausschliesslich um ein schlaues Finassieren zu dem
einzigen Zweck, die Bauern so hereinzulegen, dass auch bei scheinbar
stärkstem Entgegenkommen eine möglichst hundertprozentige Unterwerfung
herauskam. In den letzten vierzehn Tagen aber waren alle
Verhandlungen, die sie unter dem Druck der wachsenden Macht der
Bauern eingingen, für die Herren nichts weiter mehr als ein hinauszögerndes
Täuschungsmittel, um die «Entscheidung mit den Waffen»,
die von der Tagsatzung schon zum zweiten Mal beschlossene Mobilisierung
aller ihrer militärischen Kräfte, so lange zu tarnen, bis diese
Rüstung erdrückend eingesetzt werden konnte. Ja, es ist gerade die
entscheidende Tragik der zweiten Huttwiler Landsgemeinde, dass sie
immer noch im naivsten Treu und Glauben an der Illusion der Verhandlungsmöglichkeit
festhielt — statt in diesem entscheidenden Augenblick
alle ihre Kraft und Aufmerksamkeit genau so umfassend
und energisch der Organisierung und Mobilisierung ihrer militärischen
Kräfte zu widmen, wie es die Herren der Tagsatzung schon acht Tage
vorher getan hatten!
Die grosse Masse der Bauern war eben noch ganz in der von edler,
aber naiver Rechtlichkeit getragenen illusion der Verhandlungsmöglichkeit
mit den Herren befangen. Nur die Entlebucher und Willisauer
Führer waren in diesem Stadium im Begriff, diese Illusion abzustreifen
und sich zu positiven Revolutionären mit dem Willen zur
Selbstbestimmung und zu eigener Staatlichkeit herauszumausern. Sie
waren aber im grossen Ganzen des Bundes, ja selbst, seit Sumiswald,
in dessen Führung, nur eine kleine Minderheit. Deshalb wuchsen in
diesem Stadium nicht sie, sondern die Berner Bauernführer zu den geschichtlich
entscheidenden Figuren der Bauernsache nicht nur im
grossen Bunde, sondern im Bauernkrieg überhaupt empor.
Keiner unter ihnen aber war in den Augen der grossen Masse der
Bauern ein derart idealer Vertreter ihrer Verhandlungsillusion wie
Niklaus Leuenberger.
Die gerade dafür nötigen Eigenschaften zeichneten ihn im höchsten
Grade auch vor allen anderen Bauernführern aus, von denen darin
einzig Hans Emmenegger in seiner früheren Phase mit Leuenberger verglichen
werden kann; nur ganz von ferne — lediglich der Wesensart,
nicht der Stärke der Persönlichkeit nach auch Isaak Bowe. Leuenbergers
Grundeigenschaft war: eine unbestechlich reine Rechtlichkeit,
die nur den als «idealistisch» gepriesenen, also sehr wenig realistischen
Fehler hatte, auch beim Gegner bis auf Gegenbeweis dieselbe
Rechtlichkeit vorauszusetzen. Bis aber in seinen Augen der Gegenbeweis
geleistet war, brauchte es bei Leuenberger viel — und dann
war es meist schon zu spät und die Sache vom Gegner bereits gewonnen.
Ferner zeichneten ihn eine grosse Würde des Auftretens und eine
bedeutende Beredsamkeit aus, wie sie in Bauernkreisen nur ganz selten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 383 - arpa Themen Projekte
gewesen, wenn es sich bei den absolutistischen Herren wirklich um
reines Recht und nicht um die nackte Machtfrage gehandelt hätte.
Dass Leuenberger jedoch, trotz gemachter Erfahrungen und trotz
seiner manchmal erstaunlich kühnen Haltung — die jedoch mehr aus
der hohen Auffassung von der Würde seines Amtes als aus wirklicher
Erkenntnis der objektiven Lage entsprang (wie etwa der kühne Brief
an den französischen Gesandten) —, dass Leuenberger trotzdem den
wirklichen Willen der Herren nie klar erkannte und jedenfalls praktisch
nie rechtzeitig in Rechnung stellte: das mag ja «edel» genannt
werden, spricht jedoch keineswegs für eine überragende politische Intelligenz.
Hierin waren ihm die Entlebucher und Willisauer, wenn
auch vielleicht nur dank ihrer längeren Erfahrung, bedeutend über den
Kopf gewachsen. Aber auch darin war Leuenberger mit der Masse
der Bauern eins, teilte ihre Durchschnittsvorurteile, die (in den Kantonen
Bern, Solothurn und Basel!) aus grösserer und länger dauernder
Unterwürfigkeit erflossen waren — und gerade auch dies machte
ihn zum gegebenen Repräsentanten und Willensvollstrecker der Masse
der Bauern, wie sie wirklich war. All dies zusammengenommen aber
macht Leuenbergers Gestalt für alle Zeit auch zum Symbol der Tragik
der ganzen Bauernklasse seiner Zeit, und als solches ist er mit Recht
in die Geschichte eingegangen. In ihm ist der Sonnenuntergang der
uralten Bauern freiheit überhaupt verkörpert — so gross und ergreifend
wie in keiner andern Figur der Geschichte....
Eben jetzt, zwischen der ersten und der zweiten Landsgemeinde
von Huttwil, trat Leuenberger entscheidend in den Vordergrund der
Geschichte. In diesen vierzehn Tagen hat sich sein Bild dem Schweizervolk
so eingeprägt, wie es heute noch in seinem Herzen lebt. Dieses
Bild Leuenbergers dringt selbst durch die Verzerrungen und Entstellungen
seiner erklärten Gegner. Und nur solche haben es ja in Schrift
gefasst, wenn auch wohlmeinende Gegner, wie etwa Vock, oder auch
Dändliker, ihm manchmal gerührt auf die Schulter klopfen.
«Leuenbergers Ansehen unter den Bauern wuchs mit jedem Tage»,
erzählt Vock nach zeitgenössischen Quellen. «Sie gaben ihm bereits
den Namen: Obmann des Bundes; sie priesen seine Geschicklichkeit
und Beredtsamkeit — die ihm wirklich, nach dem einstimmigen Zeugnisse
der Zeitgenossen, in hohem Grade eigen und angeboren gewesen
sein muss —, erhoben ihn über alle bisherigen Regenten, und sein
Wort galt ihnen mehr als Predigten der Pfarrer, denen, wenn sie auf
der Kanzel zum Frieden und Gehorsam ermahnten, sie öffentlich in der
Kirche widersprachen. Von allen Seiten liefen sie zu ihm, seinen Rat
einzuholen; was er sagte, wurde getan, was er riet und befahl, pünktlich
vollzogen. Leuenberger erschien gewöhnlich zu Pferde, in einem
prächtigen roten Oberkleide, mit welchem die Luzerner Bauern ihn
beschenkt hatten, und von einer starken Wache begleitet. So ritt er von
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 384 - arpa Themen Projekte
Der unentschiedene Kampf bei Wohlenschwil, am
3. Juni 1653
Volkstümliche Darstellung aus dem Schweiz. Bilderkalender des
Jahres 1839 von Martin Disteli.
Nach einem Einzelblatt in der Landesbibliothek in Bern,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 384 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 385 - arpa Themen Projekte
Dorf zu Dorf und ward überall, gleich einem Landesfürsten, mit grosser
Ehrfurcht empfangen.»
Das «rote Oberkleid», das Vock erwähnt, war eine von den Bauern
so genannte «Gasage» (von ital. «casacca», oder französ. «casaque»),
«wie die reichen und vornehmen Bauern im Kanton Luzern und in den
freien Aemtern es damals und bis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts
trugen». Die Entlebucher hatten es dem Leuenberger wohl bereits
auf der ersten Huttwiler Landsgemeinde geschenkt. Zwar wird es in
keinem Bericht über diese bereits erwähnt. Aber Bögli erwähnt es unmittelbar
danach als im Besitz Leuenbergers: «Nachdem die oberländischen
Ausschüsse von Huttwil unverrichteter Dinge weggezogen
waren, begaben sie sich zur Ausrichtung ihres Auftrages nach Schönholz
in das Haus Leuenbergers und verwunderten sich über sein
prächtiges rotes Kleid.» (Abgebildet auf Tafeln 23 und 25 unseres
Buches.)
«Inzwischen fuhren die Bauern des Kantons Bern fort, fleissige
Wache zu halten, Reisende, die durch ihre vornehme Kleidung verdächtig
schienen, anzuhalten und die Briefe der Regierungen aufzufangen.
Zu Wiedlisbach wurden zwei österreichische Freiherren, namens
Althan, mit sieben Begleitern festgehalten und zu Leuenberger
geführt, der sie bewachen liess, um sie von der Landsgemeinde zu
Huttwil beurteilen zu lassen. Die Bauern nahmen denselben die schönen
Federbüsche von den Hüten und stolzierten damit im Lande herum».
Diese Wiedlisbacher waren überhaupt hitzige Gesellen. Leuenberger
musste sich deshalb am 12. Mai in einem besonderen Schreiben an sie
wenden, in dem er erklärte, «dass der Herr Baron (Sekretär und Dolmetscher
des Gesandten De la Barde) zu ihm nach Ranflüh gekommen
sei und sich beklagt habe, es seien einige französische Herren in Wiedlisbach
arretiert worden. Er befehle ihnen daher, diese loszulassen und
auch die mit dem königlichen Siegel von Frankreich versehenen Briefe
nicht aufzuhalten. Ausserdem erinnerte er sie an die künftige ,Tagsatzung'
in Huttwil».
Schon die erste Huttwiler Landsgemeinde hatte die Berner Regierung
eingeladen, eine Delegation an die zweite Landsgemeinde zu Huttwil
am 14. Mai zu senden, um mit den Bauern deren Forderungen zu
besprechen. Auf den 7. hatten diese ihre «Klagartikel» nach Bern geschickt.
In einem Schreiben vom 9. an Leuenberger nun sagte die
Berner Regierung Verhandlungen zwar zähneknirschend zu; sie konnte
sich aber nicht enthalten, eine lächerliche Prestigefrage zum Ausgangspunkt
einer tagelang zäh durchgeführten Intrigue zu machen, in
der Hoffnung, die Bauern inzwischen zu desorientieren, in ihrer Kampfbereitschaft
zu lähmen und für die Vollendung der eigenen Kriegsrüstung
Zeit zu gewinnen. Da es nämlich — so schrieb die Regierung
— «nicht den Untertanen, sondern der Obrigkeit zustehe, Tag
und Ort zu bestimmen (!), so wolle sie hiemit einen Tag auf den
16. Mai nach Wynigen angesetzt haben, in der Meinung, dass die Bevollmächtigten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 386 - arpa Themen Projekte
den Abgeordneten der Regierung zu verhandeln, was der lieben Gerechtigkeit,
Gebühr und Billigkeit gemäss sei». Inzwischen aber sollen
die Bauern «die Ruhe des Landes nicht weiter stören» — «widrigenfalls
sie (die Regierung) zum voraus gegen alle ordnungswidrigen
Handlungen der Bauern in bester Form protestiert haben wolle»! Die
Berner Herren wollten also um keinen Preis wieder vor einer Landsgemeinde,
d. h. vor dem versammelten Volk, erscheinen, sondern lediglich
mit Ausschüssen verhandeln, weil sie darauf spekulierten, diese,
wie bei früheren Fällen, besser herumkriegen zu können.
Aber gerade Leuenberger war derjenige, der von seinem Berner
Kniefall her am besten wusste, was das zu bedeuten hatte und war
entschlossen, einer solchen Art «Verhandlung» nie wieder weder beizuwohnen,
noch Vorschub zu leisten. In seinen Augen durfte es seit
dem Sumiswalder Schwur keine vom Bauernbund losgelöste, sondern
nur noch eine vom ganzen Bund gestützte Verhandlung geben, wenn
er auch, wie schon auf der ersten Landsgemeinde zu Huttwil, darein
einwilligte, auch bei der zweiten eine spezielle Kantonalgemeinde für
die Behandlung der bernischen Regionalfragen der allgemeinen Bundesgemeinde
folgen zu lassen. Und auf keinen Fall war er willens, die
Wachbereitschaft der Bauern durch die Regierung lahmlegen zu lassen.
Er hatte darum bereits am Tag vor Erhalt der Antwort der Berner
Herren, am 8., «die schriftliche Mahnung» an alle Bauern erlassen,
«überall Wache zu halten und am 24. Mai die Landsgemeinde in Huttwil
zu besuchen».
Am 12. nun erliess Leuenberger aus Ranflüh, dem Heimatort seines
Freundes Lienhard Glanzmann, unweit seinem eigenen Heimatort
Schönholz, ein Schreiben folgenden Inhalts an den Schultheissen
Dachselhofer, und zwar «in seinem und der Ausgeschossenen Namen»:
«Sie, die Bauern, müssen den nach Huttwil auf den 14. Mai angesetzten
Tag besuchen, weil sie sich mit einem Eide dazu verpflichtet hätten;
an einem andern Orte, als in Huttwil, können sie mit der Regierung
nicht in Unterhandlung treten, aus begründeter Besorgnis, dass
durch Abänderung des Orts das Volk zu blutigen Massregeln gereizt
würde.» Was aber die Verhandlungen über ihre kantonalbernischen
Fragen betraf, so wollte Leuenberger das «liebe eidgenössische Recht»,
d. h. das Privilegienrecht des Herrenbundes der Tagsatzung (das z. B.
in Ruswil und in Bern so eindeutig zugunsten der Herren «vermittelt»
hatte!) von vornherein ausschliessen .— denn eben dieses wollten
die Bauern ja durch das wiederherzustellende demokratische Recht der
«alten Bunde', d. h. der Bauernfreiheit der alten Eidgenossenschaft,
mit andern Worten: durch das eigene Bauernrecht des Sumiswalder
Volksbundes ersetzen. Leuenberger schrieb also weiter: «Bei der Zusammenkunft
wollen sie keine Herren anderer Kantone, sondern nur
ihre Gnädigen Herren und Väter von Bern haben, zumal sie, die
Bauern, nur bei den alten Bünden und Gerechtigkeiten verbleiben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 387 - arpa Themen Projekte
Spruches bedürfte.» Auch sie wollten dabei «die alten Urkunden und
Briefe» heraushaben und ihrer Obrigkeit nur geben, «was ihre seligen
Altväter derselben versprochen haben». So sanft sah die Berner Revolution
bei alledem noch aus.
Dass die «Oberländer» Ausschüsse, die bereits am 30. April in
Huttwil als «Vermittler» aufgetaucht waren, nichts anderes als im
Dienst der Regierung vorgeschickte Kapitulanten gewesen sein können,
erwies sich jetzt ziemlich eindeutig darin, dass sie fast gleichzeitig
mit dem Brief des Berner Rates an Leuenberger eine mit dem Inhalt
dieses Briefes völlig übereinstimmende Aktion bei den Aufständischen
unternahmen, die nur demselben Zweck dienen konnte: die bevorstehende
Huttwiler Bauern-Tagsatzung zu sabotieren. (Die Landleute
von Oberhasle, Ober- und Niedersimmental, Saanen und Sigriswil», berichtet
Bögli, «ermahnten am 12. Mai durch eine Zuschrift die aufständischen
Bauern, ihre Ausschüsse (!) nach Wynigen (!) zu schicken
und die ,Freundlichkeit' anzunehmen». Wieder wird nicht gesagt,
welche «Landleute» dies waren und wie diese «Zuschrift» beschlossen
wurde. Die wahre Meinung des Oberländer Volkes kommt später in
ganz entgegengesetztem Sinne zum Ausdruck.
Genau in denselben Tagen entwickelte die Berner Regierung
übrigens eine fieberhafte Tätigkeit, um durch eine grossangelegte Diversion
die Bauernschaft in den verschiedensten Landesteilen zu zersetzen.
Bögli berichtet: «Der Landschaft Saanen (siehe oben!) wurden
mehrere Zugeständnisse gemacht. Es war den Leuten gestattet, bei den
Unterwaldnern für den Hausgebrauch Salz zu kaufen; ein Landeshauptmann
wurde ihnen gegeben, das Trattengeld abgeschafft. Auch
gab die Regierung hinsichtlich des Pulververkaufs und der Satzung der
Wirte nach. Zugleich willfahrte sie in einigen Punkten den Obersimmentalern
(siehe oben!), welche unter anderem auch freien Fischfang,
sowie freie Vögel-, Fuchs- und Hasenjagd begehrten. Am 11. Mai beschloss
der Rat, dass überhaupt den Gehorsamen (!) die Salzpunkte
accordiert sein sollen». Das war überhaupt der hauptsächliche Lohn
für die Kapitulanten und der Hauptköder für die «Ungehorsamen».
der in allen Landesteilen durch eigene Ratsgesandte ausgelegt wurde.
Denn seit die Regierung in der Beratung des «Libells (!) der Sumiswald-Huttweilischen
weiteren Landtsbeschwerden», d. h. der von den
Bauern eingereichten Klagartikel, am 9. Mai die in den Instruktionen
an diese Gesandten niedergelegte, grosse Entdeckung gemacht hatte.
«wie stark von allen Seiten das Verlangen nach Freigabe des Salzhandels
gestellt wurde und welche Bedeutung die Salzfrage in diesen
Freiheitsbestrebungen des Landvolks überhaupt gespielt hat» —
wie der bernische Regierungsrat Paul Guggisberg in einer Spezialstudie
über den bernischen Salzhandel formuliert —, hoffte sie durch
eine «gentzliche Frei- und von Handen-Lassung dieses bisher alle
Sachen schwer gemachten Saltzzugs... desto besser zu der Underthanen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 388 - arpa Themen Projekte
heisst. Also schickte sie Abordnungen mit entsprechenden Weisungen
auch nach Konolfingen und in den Aargau. «Zwei Abgeordnete», sagt
Bögli, «erhielten den Auftrag, im Aargau die Parteien durch gewisse
Zugeständnisse zu trennen.» Den beiden Gesandten nach dem Aargau,
dem Althofmeister zu Königsfelden Georg Imhof, und dem Altschultheiss
von Burgdorf Abraham Imhof, gab der Rat den ausdrücklichen
Befehl: «dass zu einer Diversion (!) und Separierung (!) der Guten (!)
von den Widerspenstigen (!) sie den Gehorsamen (!) die völlige Concession
des Saltzpuncktens ankünden sollind». So berichtet Guggisberg,
der dazu meint, dass die Regierung hoffte, «auf jeden Fall aber
mit diesem Mittel die Klugen (!) von den Törichten (!) zu trennen».
Die «Klugen» waren also, nach Guggisberg, die Unterwürfigen, und
die «Törichten» waren die Aufrechten! Bögli dagegen sagt wenigstens
rund heraus: «Die bernische Regierung hatte den Grundsatz: divide
et impera»!
Am 12. Mai sorgte der Berner Rat für die Ausführung des zweiten
Teils dieser Devise. In ein- und derselben Sitzung beschloss sie, «wenn
auch mit starkem Widerstreben», die sehr gewichtig bestellte Diversions-Gesandtschaft
nach Huttwil, die wir dort kennen lernen werden
das gehörte noch zum ersten Teil, zum «Trennen» —, «während
sie gleichzeitig an Lausanne, Morsee (Morges), Iferten (Yverdon) und
Romainmotier den Befehl ergehen liess, die gedungenen Völker anmarschieren
zu lassen». Das war die Vorsorge für das «Herrschen»
— das war echter Berner Herrenstil!
Inzwischen aber mischte sich abermals der französische Gesandte
in Solothurn, De la Barde, ein — wie wir wissen, von Anfang an,
schon bei der ersten Einmischung in die Huttwiler Landsgemeinde
vom 30. April, auf Grund einer heimlichen Abrede mit der Berner Regierung.
Das war mithin die zweite grosse Diversion der Berner Regierung
zum Zweck der Sabotierung der zweiten Huttwiler Landsgemeinde.
De la Barde hatte, wie Peter berichtet, bereits die Herrentagsatzung
in Baden, die darüber am 3. Mai beriet, «eingeladen, eine Session
in Solothurn abzuhalten, damit man daselbst unter der Bedingung
der Erneuerung eines Bündnisses mit Frankreich nicht nur über
die Auszahlung des rückständigen Soldes unterhandelte, sondern dass
auch Bauernausschüsse nach Solothurn eingeladen würden und der
Gesandte zwischen den Obrigkeiten und den Aufständischen vermitteln
könnte». Damit war De la Barde allerdings bei den Herren damals
sehr ungelinde abgeblitzt. Nicht etwa aus besonders edlen «patriotischen»
Motiven der Herren: ihm wurde nämlich, nach Peter, geantwortet:
«wenn er Geld geben wolle auf Abschlag ohne Kondition, dass
man ein Bündnis abschliesse, werde man sich einstellen»! Eine Tagsatzungs-Sitzung
der Herren war also unter gewissen Bedingungen
ohne weiteres käuflich...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 389 - arpa Themen Projekte
Jetzt, am 13. Mai, wandte sich De Ja Barde mit einem ähnlichen
Gesuch, diesmal zur Vermittlung zwischen der Berner Regierung und
den Bauern, direkt an Leuenberger, «indem er», wie Peter berichtet,
«proponierte, Leuenberger möchte einen Ort zwischen Bern und Solothurn
wählen, zur Unterhandlung mit dem Berner Rate im Beisein
des französischen Gesandten». Und zwar hat Leuenberger darüber
später in einem Verhör während seiner Gefangenschaft im Berner
«Mörderkasten» ausgesagt: «damals habe der französische Gesandte
den Bauern zugemutet, in Solothurn eine Landsgemeinde ,anzustellen,
welche er in seinen Kosten (!) zu halten und ihr Fürsprech (!)
sein zu wollen versprach....' Er begehrte, dass Leuenberger mit 20
Aus geschossenen (!) zu ihm kommen solle... Der König von Frankreich
gebe den Obrigkeiten jährlich eine Pension, wovon die Landleute
doch nichts hätten (!); die Bauern sollten ihm Soldtruppen stellen,
dagegen wolle er in ihren Bund eintreten (!) ...»
Es gehört zu Niklaus Leuenbergers höchsten Ehrentiteln, dass er
auf diesen unerhört demagogischen Korrumpierungsversuch nicht hereingefallen
ist, sondern ihn unverzüglich rundweg ablehnte — trotzdem
er erst kürzlich selbst dem Gesandten geschrieben hatte, «wenn
er das Bündnis mit der Eidgenossenschaft erneuern wolle, so solle er
jetzt mit den Bauern unterhandeln, denn bei diesen liege die Macht»!
Eine Bauern-Tagsatzung war eben unter keinen Bedingungen käuflich,
auch von einem zahlenden König von Frankreich nicht, der in
ihren Bund eintreten wollte, um ihr «Fürsprech» zu sein... Dieser
plumpe Bestechungsversuch, der allzu verächtlich von der Moral der
Herren auf die der Bauern schloss, hat im Gegenteil den französischen
Gesandten jeden weiteren Einfluss auf die ganze Bauernsache
gekostet. So konnte denn De Ja Barde nichts weiteres mehr tun, als
wiederum nur seine Spione an die Huttwiler Landsgemeinde zu schicken,
wie einst nach Sumiswald.
Aber auch die Zürcher Regierung sandte ihre Spione. Peter berichtet:
«Um genaue Information über die Vorgänge im Kanton Bern
zu erhalten, sandte der Zürcher Rat acht (!) Kundschafter aus, erfahrene
Bauern (!), auf deren Treue man sich durchaus verlassen
konnte, mit dem Auftrage, sie sollten unter dem Vorwande, auch die
zürcherischen Untertanen wären geneigt, dem grossen Bauern bunde
beizutreten, mit geeigneten Personen Gespräche und Unterhandlungen
anzuknüpfen (!) ... Auch einige Stadtbürger, so ein ,Herr' Heidegger
und ein Meister Steinbrüche!, zogen zum gleichen Zwecke in den
Kanton Bern».
Rings umgeben von Verrat und Tücke also eröffnete Niklaus
Leuenberger am Morgen des 14. Mai das letzte grosse Fest der Bauernfreiheit
in der Schweizergeschichte. Wieder waren gut 3000 — andere
melden wieder 5000 — Ausgeschossene aus den vier aufständischen
Kantonen und den Freien Aemtern in Huttwil zusammengeströmt. Die
Luzerner rückten unter Führung Jakob Stürmlis in geschlossenem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 390 - arpa Themen Projekte
Baumgartners, die Basler unter derjenigen Isaak Bowes und Uli
Schads. Besonders mächtig war natürlich wieder das Kontingent der
Berner, unter Führung Leuenbergers und seines nun bereits fast übermässig
angeschwollenen Stabes. Es muss für die Herren der Berner
Ratsdeputation, die schon am Vorabend in Huttwil eingetroffen waren,
ein aufregendes und nicht wenig erbitterndes Schauspiel gewesen sein,
den verschiedenen Einzügen besonders der «landesfremden» Bauernscharen
auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet beiwohnen zu müssen, den
Stolz und die überschäumende Freiheitslust der Bauern zu erleben, die
scharenweise hoch zu Ross, andere auf geschmückten Wagen, viele mit
klingendem Spiel, auf allen Strassen, von Langenthal, von Willisau
und von Sumiswald her, in das kleine Städtchen hereinströmten, das
sie gar nicht zu fassen vermochte. Sie stauten sich schliesslich auf
einem grossen, mit Obstbäumen bestandenen Wiesengelände ausserhalb
der Stadt, «in der Nähe des Hochgerichts» — «prope patibulum,
digno tau foedere loco» — «würdiger Platz für einen solchen Bund» —
wie der zeitgenössische Herrenchronist, der allerdings besonders betroffene
Luzerner Landvogt Cysat und sein Schreibgehülfe, der Kaplan
Wagemann aus Willisau, sich nicht enthalten konnten, in ihrer Chronik
zu spotten.
Bevor die Landsgemeinde eröffnet werden konnte, musste zunächst
die Arroganz der Berner Herrendeputation abgewiesen werden.
Dieser gehörten an: drei Mitglieder des Kleinen Rats, d. h. der eigentlichen
Regierung, an der Spitze der Welschseckelmeister Johann Anton
Tillier, der schon früher wiederholt ins Emmental abgeordnet worden
war; sodann der Zeugherr Samuel Lerber und der Ratsherr Emanuel
Steiger; ferner drei Mitglieder des Grossen Rats, der Althofmeister
Georg Imhof, den wir soeben bei der Diversionsgesandtschaft im Aargau
tätig sahen, sowie Marquart Zehnder, Altlandvogt von Signau, und
Simon Nöthiger, Altlandvogt von Laupen; schliesslich der Stadtpfarrer
Heinrich Hummel, «Vorstehender göttliches Worts», und der Obertheologe
Christoph Luthard, derselbe der den Entlebuchern in einem
feierlichen Schreiben zu Anfang April so hochmütig «fromm» die
Leviten gelesen hatte.
Diese Herren also fanden es mit ihrem Prestige offenbar unvereinbar,
dass die lang vor der Zusage ihrer Beteiligung und für überkantonale
Zwecke einberufene Versammlung zuerst ihren Hauptzweck
erfüllen wollte, bevor sie die anwesenden Berner zu einer Kantonallandsgemeinde
zum Zweck der Verhandlung mit den Berner Herren
entliess. Als Vorgänge vor der Eröffnung nämlich berichtet Vock: «Die
Regierungsabgeordneten ermahnten die Bauern sehr nachdrucksam,
von der Verbindung mit den Landleuten anderer Kantone» — also gerade
vom Hauptzweck der Landsgemeinde — «abzustehen, und die
beiden Geistlichen bewiesen ihnen die Pflicht des Gehorsams aus der
hl. Schrift»! Es war mithin noch hier, in der letzten Stunde vor der endgültigen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 391 - arpa Themen Projekte
und die Ratsdeputation samt den Geistlichen bildete sich wahrhaftig
ein, die Berner Bauern noch in einem solchen Augenblick an
ihrem schon in Sumiswald beschworenen Bunde zu meineidigen Verrätern
machen zu können! Zu diesem und keinem anderen Zwecke
<(wurden den Bauern 47 Artikel, welche die Regierung zu bewilligen
geneigt sei, sowie die besonderen Wohltaten, die mehreren einzelnen
Gemeinden zu gut kommen würden, ausführlich eröffnet». Noch dazu
handelte es sich bei diesen Artikeln um prinzipiell nichts anderes als
was die Berner Herren bereits in den «Konzessionen von Anfang
April «eröffnet» und versprochen, aber bis zu diesem 14. Mai den
Bauern weder gehalten, noch auch nur in Brief und Siegel ausgefertigt
hatten! Man wundert sich nur über die Mässigung der Bauern,
von deren Reaktion auf diese Zumutung Vock weiter berichtet: «Die
Landdeputierten gaben freundliche Antwort, entschuldigten sich jedoch
mit dem Umstande, dass nun die Landsgemeinde nicht mehr verschoben
werden könne, und verhiessen, nach Beendigung derselben und
nach Entfernung der Bauern aus andern Kantonen mit den Deputierten
der Regierung in die nötige Verhandlung einzutreten». Die Herren
mussten also vorläufig unverrichteter Dinge in ihren Gasthof zurück
und dort die fünf Stunden abwarten, die der «Spektakel» dauerte,
worüber sie sich später heftig beklagten.
Endlich konnte Leuenberger die grosse Landsgemeinde «mit einer
kurzen Anrede» eröffnen. Alsdann «wurden viele aufgefangene Briefe
und dann auch beipflichtende Zuschriften einzelner Vogteien und
Amteien verschiedener Kantone verlesen». Unter diesen letzteren ragt
die «Adresse» der solothurnischen Vogtei Kriegstetten, die wir bereits
kennen, durch zwei Ratschläge von grösster Tragweite hervor, die,
wenn sie rechtzeitig und wirklich allgemein befolgt worden wären —
und dazu war jetzt die allerletzte Stunde —, das Schicksal der ganzen
Bauernrevolution hätten wenden können! Diese Ratschläge lauten:
1. «Auch wäre es unsere Meinung, dass man der Städten einmal
sollte abschneiden und nichts in die Stadt kommen lassen, damit der
Aufruhr in den Städten einen Anfang machte; auch dieweil nun auf
den heutigen Tag wiederum eine Versammlung geschehen tut, so sollet
Ihr dasselbige zum End bringen und ins Werk richten.»
2. «Auch wäre es hoch vonnöthen, dass man eine Musterung ansehe
(anordne), wie jeder gerüstet oder gewehrt wäre, und auch denselbigen
in Rotten abtheile, im Fall der Noth, dass ein jeder wüsste,
was er tun sollte.»
Die Verfasser und Beschliesset dieser Adresse müssen ganz besonders
helle Köpfe gewesen sein. Denn sie haben mit diesen Verlangen
mitten im Sturm der Ereignisse genau die beiden Hauptgebrechen auf's
Korn genommen, an denen die Bauernrevolution dann sehr bald wirklich
zugrunde ging und die wir noch nach drei Jahrhunderten als ihre
geschichtlichen Hauptgebrechen erkennen müssen: 1. die noch fehlende
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 392 - arpa Themen Projekte
der bäuerlichen; 2. die weitgehende Anarchie und Rückständigkeit in
der Organisation der militärischen Mittel. Lag die Erfüllung der ersten
Forderung auch nicht in der Macht der Bauern allein, weil dafür das
wirtschaftliche und politische Bewusstsein der Bürger noch nicht entwickelt
genug war — so hätte doch die konsequente und allseitige Erfüllung
der zweiten Forderung den militärischen Sieg der Bauern herbeiführen
müssen, und dieser hätte die allerorts unzufriedenen Bürger
doch soweit mitreissen können, dass das Bewusstsein ihrer wirtschaftlichen
und politischen Macht viel allgemeiner erwacht und sich
in ganz anderem Tempo entwickelt hätte!
Leider vernehmen wir gar nichts darüber, welche Diskussion zwischen
den Bauern über diese beiden Punkte, nicht einmal, ob überhaupt
eine darüber gewaltet hat. Es ist zwar ohne weiteres anzunehmen,
dass gerade diese beiden Verlangen von den Führern der Entlebucher
und der Willisauer begriffen und begrüsst worden sind. Wohl
ebenso sicher aber ist anzunehmen, dass sie über den Horizont der
grossen Masse der in Huttwil vertretenen Bauern, einschliesslich der
übrigen Luzerner, hinausgegangen sind und dass gerade die Berner
Bauern und ihr Führer Leuenberger auch darin den Durchschnitt der
grossen Masse der Bauern repräsentierten. Es war die Verhandlungsillusion,
die sie diese beiden revolutionären Aufgaben nicht ernst genug
nehmen liess, Aufgaben, die nur durch die Entschlossenheit zu bedingungslosem
Kampf jetzt noch allgemein und durchgreifend genug hatten
«ins Werk gerichtet» werden können. So hat sich schliesslich der
an sich kühne Gedanke der Entlebucher und Willisauer, zum Zweck
der Erweiterung und Verallgemeinerung des Bundes die Führung desselben
den Bernern zuzuschieben, als eine verhängnisvolle Schwächung
und Verwässerung des Inhalts ihrer Bundesidee — wie er auch erst
inzwischen sich deutlicher entwickelt hatte — ausgewirkt.
Vorläufig aber war man in Huttwil umso entschlossener, alles
drohende Unheil durch die Einigkeit eines besonders feierlichen Eidschwurs
auf alles bisher Erreichte mit religiösen Mitteln zu beschwören.
Vock berichtet darüber: «Hierauf wurde der Sumiswalder Bundesbrief
laut vorgelesen. Nach Verlesung desselben rief der auf dem Tische
stehende Leuenberger, dass jeder, der diesen Bund nicht beschwören
wolle, sich aus dem Ring der Landsgemeinde entferne, worauf wirklich
einige Wenige zur Seite gingen. Alsdann warfen sich die Versammelten
auf die Knie, hoben die Schwörfinger empor, und Leuenberger sprach
mit starker Stimme: «Nun liebe und getreue Leute! losset auf euren
Eid, und sprechet mir nach alle diese Worte: Wie die Schrift ausweist,
dem will ich nachgehen und es vollbringen mit guten Treuen;
wenn ich das halte, dass mir Gott wolle gnädig sein an meinem letzten
Ende; wenn ich es aber nicht halte, dass er mir nicht wolle gnädig
sein an meinem letzten Ende; so wahr mir Gott helfe, ohne alle Gefährde...»
«Bei dem Bundesschwure ergänzten» ,wie Liebenau berichtet,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 393 - arpa Themen Projekte
schwöre ich, so wahr mir Gott helfe', durch die Worte ,Gott, Maria und
die lieben Heiligen'.»
Aber die Einigkeit der Bauern war nicht so stark, wie man sie
wohl wünschte. Fromme Sprüche vermögen eben die Widersprüche der
harten Wirklichkeit nicht zu bannen. So platzten denn die Meinungen
erst nach dem feierlichen Eidschwur und trotz der erhebenden Einmütigkeit
desselben heftig aufeinander. Zwar wäre dies an sich nur ein
Zeichen demokratischer Kraft —jedoch nur unter der Bedingung, dass
es einer überlegenen Führung gelungen wäre, die neu auftretenden
Spannungen dem gemeinsamen Bundeszweck dienstbar zu machen. Es
waren dies ja durchaus fruchtbare Spannungen, die nur dem Bestreben
der vorwärts drängenden Kräfte entsprangen, bisher unaufgearbeitete
Aufgaben mit frischem Mut in Angriff zu nehmen; Aufgaben,
für die der eben beschworene Bundesbrief zwar den richtigen Rahmen
bot, deren konkrete Lösung er aber noch gar nicht enthielt; lag
doch seine Niederschrift bereits um eine wichtige und ereignisreiche
Etappe zurück.
Aber gerade in dieser entscheidenden Stunde hat Leuenberger in
nicht wieder gut zu machender Weise versagt. Für ihn war offensichtlich
der Bundesbrief bereits eine heilige Urkunde geworden, die das
Höchste des von den Bauern Gewünschten ausdrückte und über die
hinaus es für ihn nichts mehr gab. So rückten die trotz ihres Katholizismus
immer wieder so imponierend realistisch denkenden Entlebucher
mit ihrem Begehren nach Aufhebung des Münzmandates heraus,
«soweit dasselbe die Abrufung der Münzen von Bern, Freiburg
und Solothurn betraf». Wir wissen, dass dieses Begehren bereits an der
Wiege des ganzen Aufruhrs stand; aber nur die Entlebucher haben
verstanden, es nicht nur als treibenden Faktor festzuhalten, sondern
es auch — bereits auf der Landsgemeinde beim Heiligen Kreuz am
3. Mai — zum Ausgangspunkt für die Forderung der eigenen Münzhoheit
des Volksbundes zu machen. Das lag im Zuge ihrer ganzen
Politik der totalen Unabhängigkeit vom absolutistischen System der
Herrenpolitik, im Zuge der Wiederherstellung der Souveränität des
Volkes. So konsequent konnte Leuenberger gar nicht denken, obschon
diese Forderung nur eine natürliche Schlussfolgerung aus dem Bundesbrief
war und dessen Forderung nach eigener Rechtshoheit des
Volksbundes vollkommen parallel lief.
Da brauchte der regierungsfromme Kapitulant Adam Zeltner, der
«Wortführer der Solothurner», nur zu verlangen, «dass das Mandat
der Regierungen nicht angegriffen werde», «sie wollen es bei dem
bleiben lassen, was ihre Gnädigen Herren verordnet haben» — und
das Postulat der Entlebucher fiel aus Abschied und Traktanden! Bezeichnend
für den kühnen Sinn dieses Postulates ist, dass der Landessiegler
Niklaus Binder von Entlebuch dem Kapitulanten Zeltner mit
dem Ausruf ins Wort fiel: «Wir wollen fortan keine Obrigkeit mehr!»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 394 - arpa Themen Projekte
der ihm ergebenen grossen Masse der Bauern ist es, dass sie bei solcher
Fragestellung nicht Binder, sondern Zeltner folgten... Das war
der erste Riss in der Einheit der Bauern, der zu dem Auseinanderstreben
der Kräfte führte, das während des nun folgenden Kampfes auf
Leben und Tod zwischen Herren und Bauern die gesamte Bauernmacht
wie eine galoppierende Schwindsucht ergriff...
Gewisse andere Postulate waren offenbar bereits vor dem Bundesschwur
bei der Verlesung der eingegangenen Schreiben, aus der
Mitte der Versammlung gestellt worden, mit dem Verlangen, sie noch
in den Bundesbrief selbst mit aufzunehmen. Aber der lag ja, in vier
Pergamenten ausgefertigt, bereits fix und fertig auf dem Vorstandstisch,
um von den vier Kantonen besiegelt und ihnen ausgehändigt zu
werden. So ist Leuenberger mit seiner Mehrheit über die neuen Forderungen
hinweg zum Schwüre geeilt. Als nun die Entlebucher mit ihrem
Begehren — es wird übrigens nicht ihr einziges gewesen sein — den
Bann des heiligen Nebels, der nach dem Eidschwur auf der Versammlung
lag, gebrochen hatten, da drängten auch diese Forderungen der
Wirklichkeit wieder in die Diskussion. Deshalb wurden -—wie Liebenau
berichtet — nach dem Bundesschwur noch folgende Beschlüsse gefasst:
«
1. Wer den Bund nicht hält, demselben sich widersetzt oder sich
als ein Aufwiegler gegen denselben zeigt, der soll alsbald in die Gefangenschaft
gezogen und an Leib und Gut gestraft werden.
2. Die Boten der Regierungen sollen bis zu Austrag des Handels
an den Pässen und Orten, wo man sie findet, zurückgehalten werden.
3. Man soll die Gegner nicht mehr so ungütlich mit Worten, Bart-
und Ohren-Abschneiden behandeln, sondern sie in Gefangenschaft
legen.
4. Man soll sich mit Kraut und Loth wohl versehen.
5. Wenn bis Montag die 4 Orte (Luzern, Bern, Basel und Solothurn)
sich mit dem Bunde nicht vergleichen, so soll man die Städte,
Schlösser und Pässe, die mit fremdem Volk besetzt sind, wegnehmen.
6. Die Zölle auf dem Lande sollen wie vor alter Zeit entrichtet
werden. Man soll aber in die Städte nichts mehr liefern und bis zu
Austrag des Handels nichts mehr zufergen lassen.
7. Ohne Wissen und Zustimmung der Ausschüsse darf kein Ort
sich mit seiner Obrigkeit vergleichen.
8. Jeder Ort ist verpflichtet, dem andern zur Abschaffung der Beschwerden
oder neuen Aufsätze laut Bundesbrief behilflich zu sein.»
Man sieht es diesen Beschlüssen an, dass sie das Produkt des
Drängens zur Tat seitens einer revolutionären Minderheit, aber auch,
dass sie, so wie sie schliesslich einstimmig angenommen wurden,
zumeist doch Kompromisse sind. Artikel 6 z. B. soll dem ersten der
beiden Kriegstetter Postulate entsprechen; aber wir vermissen darin
jede Einsicht in den hochpolitischen Zweck dieses Postulats, nämlich:
«mit dem Aufruhr in den Städten einen Anfang zu machen»! Etwas,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 395 - arpa Themen Projekte
Artikeln überhaupt nicht; nämlich keine neuen Methoden zur
Ausbildung, Kontrolle und systematischen Organisation der bäuerlichen
Streitkräfte; die hielten also Leuenberger und seine Paladins für
überflüssig (was Wunder, da sie auf eine friedliche «Verständigung»
spekulierten!). Dafür ist Artikel 3 um das Wohl der bisher allzu grob
behandelten Herrendiener besorgt, was ja aller Ehren wert ist, aber
objektiv der Revolution in den Arm fällt. Die Artikel 1, 7 und 8 sind
nur Wiederholungen aus dem Bundesbrief. Von den militärischen Artikeln
2, 4 und 5 bietet allein der letzte etwas Neues und eine wirkliche
Kriegsmassnahme von Bedeutung: ein Ultimatum von fünf Tagen bis
zum 19. Mai an die Herren, unter Androhung einer — allerdings sehr
partiellen — Gewalt. Das Alles zusammengenommen macht den Eindruck
einer Flickarbeit, um die Leute zusammenzuhalten!
Derselbe Eindruck ergibt sich erst recht aus den zwei Fragen, die
Leuenberger zur Herstellung eines einmütigen Abschlusses der Diskussion
an die Landsgemeinde richtete und über die er diese abstimmen
liess. Sie lauten:
1. «Ob ein Jeder seiner Obrigkeit, was ihr gehört, zu geben gesinnt
und Willens sei?»
2. «Ob nicht auch ein Jeder alle Neuerungen abzuthun und aufzuheben
sich befleissen wolle?«
«Beide Fragen», sagt Vock, «wurden durch offenes Handmehr bejahend
entschieden.» Natürlich. Denn sie stellten, nach dem Prinzip
des geringsten Widerstandes, ungefähr das Minimum dessen dar, was
von den Bauern jemals verlangt wurde; ein Minimum, das vielleicht am
Beginn der Bewegung, niemals auf deren Höhepunkt hätte verlangt
werden dürfen und für das sogar regierungsgläubige Kapitulanten wie
Zeltner noch stimmen konnten. Welch verhängnisvolle Unklarheit
durch solch billig erlangte Schein-Einigkeit erzeugt wurde, geht schon
daraus hervor, dass z. B. das Münzmandat, dessen Aufhebung man
soeben abgelehnt hatte, gerade zu den wichtigsten, den ganzen Aufstand
verursachenden «Neuerungen» gehörte, die «abzuthun und aufzuheben»
man sich jetzt durch die Bejahung der zweiten Frage feierlich
verpflichtete! Die Bejahung der ersten Frage aber war für die
Kampfbereitschaft der Bauern noch bedenklicher, nachdem die Entlebucher
bereits proklamiert hatten: wir wollen keine Obrigkeit mehr!
Und jetzt diese echt Leuenbergerisch sektiererische Losung: geht dem
Kaiser, was des Kaisers ist — mein Reich ist nicht von dieser Welt ..
Nein, das war kein «Höhepunkt» der Bauernbewegung, kein mobilisierender
Schlachtruf zur Sammlung der Kräfte für den unvermeidlich
gewordenen Kampf — ganz im Gegenteil! Es war dafür gewiss
kein hinreichender Trost, dass gegen Schluss der Landsgemeinde wenigstens
der Wille zur Ausdehnung des Bundes noch zum Ausdruck
kam. «Endlich», so berichtet Bögli, «erliess Leuenberger im Namen der
Versammlung einen Bericht und die Aufforderung an die Schwarzenburger,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 396 - arpa Themen Projekte
nicht.»
Einen gewissen Trost für viele der enttäuschten Teilnehmer aber
mochte es darstellen, dass hierauf die Lands gemeinde — diesmal nicht
eine bloss kantonale, sondern die allgemeine des gesamten Bundes -—
sich abermals zu einem Gerichtshof konstituieren konnte. Aber diesmal
fehlte ihr der Gegenstand von irgendwelcher alarmierender oder stimulierender
Bedeutung, wie es die Schiffsgeschichte von Berken oder
auch die Gefangennahme des Hauptmanns Rummelt auf der ersten
solchen Gerichtsgemeinde in Huttwil gewesen war. Jetzt war einfach
ein kläglicher Irrtum zu korrigieren, den die hitzigen Wiedlisbacher
mit der Gefangennahme der beiden österreichischen Barone Althan
und ihres Gefolges in der Meinung begangen hatten, es mit feindlichen
Reiterspionen der Herrenregierungen zu tun zu haben, während es
harmlose durchreisende Privatpersonen waren. Diese wurden «vor die
Landsgemeinde geführt, examiniert und dann mit Geleitsbrief entlassen
— und «hiemit wurde die Landsgemeinde beendigt». Ein Abschluss
des letzten grossen gemeinsamen Freiheitsfestes der schweizerischen
Bauernklasse, wie er kaum nichtssagender und bedeutungsloser
hätte sein können...
Vielleicht dass aber doch — hoffen wir es — eine etwas stirnmungsvollere
und festlichere Szene den wirklichen Abschluss bildete,
nämlich die Uebergabe der inzwischen je fünffach besiegelten vier Pergamente
des Bundesbriefs an die verbündeten Bauernschaften der vier
Kantone. Da hingen an diesen, feierlich «wie ein amtliches staatsrechtliches
Aktenstück besiegelten» Urkunden folgende Siegel: 1. «an
grünen und roten Seidenbändern das Landessiegel von Entlebuch»; 2.
«an gelben und roten Seidenbändern das Siegel des Amtes Willisau»;
3. «an einem Pergamentstreifen das Stadtsiegel von Olten»; 4. «an
einem Pergamentstreifen das Siegel von Rothenburg, das aus einem
Privatsiegel erstellt wurde...»; 5. «an grünen und roten Seidenbändern
das Stadtsiegel von Liestal von 1569». Nur gerade die Berner Bauern,
die die Baumeister dieses Bundes stellten, vermochten kein eigenes Siegel
aufzutreiben — ein kleines, unbedeutendes und doch symptomatisches
Zeichen dafür, wie die Gewohnheit der wenigstens regionalen
Freiheiten im Bernbiet seit Menschengedenken verschollen war...
Die Landsgemeinde hatte nun aber nach der Verlesung der vom
Untervogt Schnorf dem Leuenberger überreichten «Zitation» der Tagsatzung
den Beschluss gefasst: bevor sie ihre Angelegenheiten innert
Monatsfrist «vor das liebe eidgenössische Recht» bringe, wie diese Zitation
verlangte, «wolle man zuerst friedliche Verkommnisse mit den
Obrigkeiten anstreben». Darin stak zwar noch etwas von der Entschlossenheit,
das Herrenrecht der Tagsatzung nicht anzuerkennen,
aber nicht genug Entschlossenheit, das eigene demokratische Recht,
wie es der Sumiswalder Bund konstituierte, durch Kampf an dessen
Stelle zu setzen! Diese Halbheit rächte sich in der Folge fürchterlich.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 397 - arpa Themen Projekte
Alternative — entweder Vergleich mit den einzelnen Regierungen
oder Unterstellung unter das «eidgenössische» Recht — auf
die Bahn der kantonalen Sonderverhandlungen drängen, statt mit vereinter
Kraft los. zuschlagen und sich das Recht auf die Freiheit von der
Tagsatzung sowohl wie von den Regierungen mit dem Schwerte zu
holen. Man meinte, auf diese Weise dem Herrenrecht zu entschlüpfen
— und lief ihm gerade so am sichersten ins Garn. Denn eben dadurch
gelang es den Herren schliesslich, den einheitlichen Block des Volksbundes
mit dessen ausdrücklicher Zustimmung wieder in seine vier
Teile aufzuspalten, um jeden Teil durch die ihm zugehörige Regierung
einzeln verspeisen zu lassen...
Das Verschlingen hatte allerdings für die Herren noch seine Tücken,
und mehr als einmal drohte dieser Vorgang für sie tödlich abzulaufen.
Denn der zu bewältigende Brocken war durch den ganzen bisherigen
Verlauf des Aufstandes stachliger geworden, als es die Herren
für möglich und die Leuenberger-Partei für wahr halten wollten. Und
erst die «eidgenössische» Brachialgewalt hat diesen Brocken derart in
Krümel zu zerschlagen vermocht, dass er schliesslich mit ein paar
Silberpokalen Festweins mühelos heruntergespült werden konnte...
Die Stacheln der Volksstimmung, die in der allgemeinen Landsgemeinde
nicht ihrer wirklichen Gefährlichkeit gemäss zur Geltung
gekommen waren, begannen sich bereits in der kurzen angeschlossenen
bernischen Kantonallandsgemeinde wieder zu sträuben. Endlich
nämlich liess Leuenberger, wie Peter berichtet, »die Ratsabordnung
von Bern, die während der fünfstündigen Verhandlung hatte warten
müssen, vor die bernischen Ausschüsse treten», besser: vor die ganze
Versammlung sämtlicher in Huttwil anwesenden Berner Bauern. Die
Herren waren nun offenbar entschlossen, ganze Arbeit zu leisten und
überspannten dabei den Bogen: sie wollten ihren bereits in den Tagen
vorher in den verschiedensten Landesteilen mit Versprechungen und
Bestechungen begonnenen Diversionsversuch bis zur Aufspaltung der
bernischen Kantonalgemeinde in verschiedene Ausschüsse der einzelnen
Aemter, Gerichte und Bezirke weitertreiben! Damit hofften sie wohl,
eine Methode wiederaufnehmen zu können, mit der es ihr vor Bestehen
des Sumiswalder und Huttwiler Bundes in den ersten Apriltagen in der
Tat gelungen war, zuerst die Emmentaler, dann die verschiedenen
Oberaargauer Ausschüsse auf die Knie zu zwingen, allen voran Leuenberger
selber, den jetzigen stolzen Obmann des grossen Bundes. Aber
wenn etwas,, so hatten die Berner Bauern und hatte besonders Leuenberger
gerade diese Demütigung nicht vergessen. Die Zumutung der
Herren am Schluss der zweiten Huttwiler Landsgemeinde hat darum
mächtig dazu beigetragen, den Kampf willen gerade des grössten und
— ausser Solothurn — am bedenklichsten geführten Gliedes des grossen
Bauernbundes und den der Bundesleitung selbst neu anzufeuern!
All dies geht klar aus dem Bericht Böglis hervor: die Berner Ratsabgeordneten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 398 - arpa Themen Projekte
einzelne Abgeordnete nach Wynigen, Höchstetten, Münsingen, Worb
oder Langenthal zur Abmachung eines gütlichen Vergleichs mit Deputierten
der Obrigkeit senden sollten. Die Bauern aber verlangten sofortige
Verhandlung mit sämtlichen bernischen Anwesenden, so dass die
Mühe der Gesandten an diesem Tage eine vergebliche war, weil man
sich nicht über den Ort und die Art der Unterhandlungen verständigen
konnte. Der Streit ist ein sehr begreiflicher, da die Obrigkeit natürlich
leichteres Spiel gehabt hätte, einzelne bevollmächtigte Ausschüsse zur
Unterwerfung zu überreden, als eine ganze Versammlung. Eben deshalb
wollten die Bauern nichts davon wissen (!). Man hatte ja schon
früher die Erfahrung gemacht, dass Vergleiche, von Ausschüssen heimgebracht,
durch die Masse nicht gebilligt wurden». Nach Vock erklärten
die Bauern sogar nicht nur, diese Angelegenheit «müsse in voller
Gemeinde», sondern sie müsse auch «im Einverständnis mit den verbündeten
Untertanen der andern Kantone behandelt werden»!
Es scheint, dass tatsächlich dieser für die Herren blamable Ausgang
der bernischen Kantonallandsgemeinde die Energien des ganzen
Bundes neu belebt haben. Vielleicht auch hatten inzwischen die Entlebucher
und die Willisauer die Gefahr gewittert, die von der zögernden
Führung Leuenbergers ausging und beschlossen, etwas Antreibendes
und Stärkendes dagegen zu tun. Sicher ist, dass noch am. Abend des
Landsgemeindetages die Bauernführer aller beteiligten Kantone eine
gemeinsame Beratung abhielten, auf. der sie, wie Peter berichtet,
«einige Verabredungen über das Truppenaufgebot» trafen, mithin über
das, was angesichts der fieberhaften Rüstungsanstrengungen der Herren
— für die alle «Verhandlungen» ja nur eine tarnende Nebelwand
darstellen sollten — das vordringlichste, ja das einzig wichtige Thema
für die ganze Landsgemeinde gewesen wäre. Wir werden also die
Versammlung vom Abend des 14. Mai in Huttwil als eine Sitzung des
bereits in Sumiswald aufgestellten Kriegsrates des Bauernbundes aufzufassen
haben — und sie wäre denn auch die einzige solche allgemeine,
von der wir überhaupt hören.
Gern wüssten wir mehr darüber als das, was uns Peter und Liebenau
berichten. Immerhin geht daraus hervor, dass man beschloss,
«mit Ablauf der Bedenkzeit, die man den Regierungen gestellt», mithin
bis zum 19. bezw. 21. Mai eine Armee von 16000 Mann aufzubieten.
Nach Liebenau wurde «das Kontingent der einzelnen Aemter... genau
fixiert», und er führt als Beispiel aus den Luzerner Staatsakten an:
«so sollte die Grafschaft Willisau 415 Mann stellen, wovon 270 mit
Musketen, 145 mit Harnisch und Halbarten». Leider aber müssen wir
stark bezweifeln, dass solche Abreden auch nur für einen geringen
Bruchteil des gesamten aufständischen Gebiets bereits in Huttwil «genau
fixiert» und derart zentral von einem gemeinsamen Kriegsrat organisiert
worden sind. Sonst nämlich wäre der Verlauf der späteren
kriegerischen Ereignisse ein ganz anderer gewesen. Ferner wollte man,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 399 - arpa Themen Projekte
setzen». Man wollte diese «aus den obrigkeitlichen (!) Häusern zuerst
mit Güte (!) abfordern, widrigenfalls mit Gewalt abnehmen; so sollten
die Luzerner Bauern ,alle Stücklein' zu Wykon, Sursee und Reiden
an sich ziehen; die Berner namentlich die Geschütze zu Aarwangen
und Aarburg». In Vollzug dieses Beschlusses wird es gewesen sein,
dass Leuenberger, wie Bögli berichtet, bereits am 17. Mai von Langenthal
aus «im Namen der gemeinen Ausgeschossenen des Bundes an
die Landvögte zu Aarwangen und Aarburg und an die Schullheissen
und Räte in Burgdorf und Thun» — lauter «feste Plätze», die über
einige Artillerie verfügen mussten — «die Aufforderung ergehen liess,
die Garnisonen aus den Schlössern zu schaffen, ansonst man Gewalt
brauchen werde». Schliesslich wurden in der Sitzung der Bauernführer
vom Abend des 14. Mai anscheinend ein paar Ergänzungswahlen in den
Kriegsrat vollzogen. Peter berichtet: «Ein Hans Hochstrasser von
Hauenstein und Kaspar Steiner (!) von Emmen, sowie ein Niklaus
Bündner wurden zu Obersten gewählt» (sofern es sich bei letzterem
nicht etwa um eine Namensverwechslung mit dem Landessiegler
Niklaus Binder von Entlebuch handelt, was sehr wahrscheinlich ist).
Zu einer militärisch wichtigen Rolle ist von diesen in der Folge nur
Hans Hochstrasser gelangt.
Wie bedenklich es aber mit der Zeitgemässheit und Zweckmässigkeit
der Beschlüsse des Huttwiler Kriegsrates im allgemeinen bestellt
gewesen sein mag, zeigt die Vermutung Liebenaus, dass die Bauernführer
dabei «die alte Kriegsordnung der Eidgenossenschaft von 1393
(!), die unter dem Namen Sempacherbrief bekannt ist, als Basis für die
Aufrechterhaltung der Disziplin im Bundesheere in Aussicht genommen»
haben sollen! Nach Liebenau nämlich findet sich bei den solothurnischen
Staatsakten zum Bauernkrieg, «mit der Bemerkung: Ein
uszug us der kronek», «ein Auszug von sehr unbeholfener Hand» aus
dem Sempacherbrief «als Beilage zu den Beschlüssen der Volksversammlung
von Huttwil». Dieses kindliche Vertrauen der Bauern in die
Verwendbarkeit einer 260 Jahre alten Kriegsordnung der alten Eidgenossen
gegen die in kaiserlichen und königlichen Heeren des damals
modernsten Europas erworbene Kriegskunst der Zwyer, Werdmüller
und von Erlach wäre dann eine wahrhaft tragische Uebertragung des
geschichtlich rückständigen alteidgenössischen «Idealismus» der
Bauern auf eine für sie buchstäblich mörderisch gewordene Wirklichkeit
gewesen! Erschütternder noch als der Stolz der Entlebucher
auf den wiedererstandenen Morgenstern, ihre mit «Stäfzgen» beschlagenen
Eichenknüppel, und als ihre Begeisterung für die selbstverfertigten,
«gewaltig schiessenden», hölzernen Kanonen...
Klar, dass Liebenau recht hat, wenn er die Bilanz der zweiten
Hälfte der letzten Huttwiler Landsgemeinde mit den Worten zieht:
«Zwar misslangen die Versuche, die Volksführer für die Regierung zu
gewinnen... Aber diese (die Obrigkeiten) erkannten rasch die schwache
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 400 - arpa Themen Projekte
Rückzug der Bauern, unter Führung Leuenbergers,
aus dem Kampf bei Wohlenschwil, am 3. Juni 1653
Nach einem zeitgenössischen Originalgemälde im Besitze des
Schweizerischen Landesmuseums in Zürich (Pendant zu Abb. 23)
Hier wird der Ausgang des Kampfes als regellose Flucht der
Bauern- und eindeutiger Sieg der Herrenarmee dargestellt, während
er in Wahrheit militärisch unentschieden und nur diplomatisch
(siehe folgendes Bild) eine Niederlage war, Die Soldaten der
Herrenarmee sind hier bereits weitgehend uniformiert; viele
Rot- und Blauröcke, hohe Stiefel usw. — Rechts im Hintergrund:
Schloss Hilfikon.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 400 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 401 - arpa Themen Projekte
Seite. Sie fanden heraus, dass es den Bauern an diszipliniertem Militär
und an Mitteln zur Verpflegung der Truppen fehle.»
So gleicht die nun endgültig «verbriefte» Bauernfreiheit, wie sie
von der fromm beschworenen Huttwiler Bauernmacht in die Zukunft
gerettet werden sollte, jenem «Wilden Mann», der, das Christkindlein
auf den Schultern und einen Baumstamm in der Hand, mühselig
durch den Strom der Zeit stapft — während an dessen Ufern,
noch gut versteckt, die Schlünde neuzeitlicher Kriegsmaschinen klaffen,
um den gottseligen Riesen mitten im Strom zu Fall zu bringen
und ihn samt seiner frommen Last in den Fluten zu ertränken...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 403 - arpa Themen Projekte
XVI.
«Auch dann nicht!...»
Hans Emmenegger und der entlebuchische «Geheime
Landrat» geben ein grosses Beispiel — auf dem Gipfel
des Erfolges und in schwerster Prüfung
Die Stimmung in den Bauernmassen weit im Lande herum war
unvergleichbar viel revolutionärer und kampfentschlossener als sie in
der Leitung der zweiten Huttwiler Landsgemeinde — und des Bauernbundes
insgesamt — unter Leuenbergers Führung zum Ausdruck gekommen
war.
Allen voran waren wieder einmal die Entlebucher. Sie hatten —
offenbar schon seit einiger Zeit, sicher spätestens nach der Heilig Kreuz-Landsgemeinde
vom 3. Mai — einen «geheimen Landrat» gebildet, dem
der Pannermeister Hans Emmenegger, der Landeshauptmann Niklaus
Glanzmann, der Weibel Theiler von Entlebuch, der Landessiegler Binder,
der Weibe! Krummenacher und seltsamerweise ein Nicht-Entlebucher,
und zwar ausgerechnet Kaspar Steiner von Emmen, angehörten.
Sekretär dieses «Entlebucher Geheimrates» war, nach Peter, der Schulmeister
Johann Jakob Müller. «In erster Linie», sagt Peter, «suchten
sie durch ihre Gesandten die Lands gemeinden von Uri, Schwyz, Unterwalden
und Zug, wo mancher Landmann auf ihrer Seite stand, für
sich zu gewinnen.» Dieser «geheime Landrat» hatte also — in Verfolgung
bereits früher gemachter Anstrengungen der Entlebucher — den
weitausschauenden Plan, die ganze Urschweiz um die Bauernsache zu
gruppieren und für den Aufstand reif zu machen! In der Tat wurde
dieser Plan bis Ende Mai soweit gefördert, dass es eines einzigen militärischen
Sieges der Bauern bedurft hätte — so wäre das Volk der
Urschweiz aufgestanden und hätte seine ganze verlogene «Landsgemeinde»-Aristokratie
hinweggefegt, um die ursprüngliche Demokratie
wiederherzustellen. Schon am 24. Mai denunzierte z. B. der Zürcher
Vogt Holzhalb in Wädenswil seiner Regierung: «Im Kanton Schwyz
ist man uneinig; die einen geben der Regierung, die andern den Bauern
recht.» Der Luzerner Rat musste daher der Propaganda der Entlebucher
in den Urkantonen schon seit dem 10. Mai durch fortwährende mühsame
Ratsgesandtschaften an die Landsgemeinden und Regierungen
dieser Kantone «zur Widerlegung der von den Bauern ausgestreuten
Verleumdungen» entgegenwirken.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 404 - arpa Themen Projekte
Eine wahre Panik riss wieder einmal bei den Luzerner Herren
ein und die Kopflosigkeit der Regierung wuchs angesichts der energischen
und planmässigen .Tätigkeit der Entlebucher von Tag zu Tag.
Diese hatten die Kühnheit, nicht nur die ganze urschweizerische Umwelt,
sondern auch die eigene, unterdrückte Bürgerschaft der Stadt
Luzern, die innere Basis des ganzen Herrenregimes, neu gegen den Luzerner
Rat zu mobilisieren. Dieser befand sich, wie Peter berichtet, «in
einer doppelt schlimmen Lage, weil die unzufriedenen Stadtbürger
mit den Bauern in Verbindung traten und gegen die Obrigkeit Partei
zu nehmen drohten'. Und dies zwar auf die Initiative der Entlebucher!
Die Entlebucher nämlich «hatten den Bürgern von Luzern gelobt, nicht
eher einen Friedensschluss einzugehen, bis der Rat sich mit den Bürgern
verglichen hätte». Dies brachte die Bürgergefahr so weit, dass der Nuntius
Caraffa, der päpstliche Gesandte in der Schweiz, am 15. Mai nach
Rom schreiben konnte: «Noch mehr bedaure ich, dass die Einwohner
und Bürger der Stadt ebenfalls schlimme Gedanken hegen, so dass sie
in dieser Woche zweimal daran waren, die Waffen gegen ihre Herren
zu ergreifen, unter dem flauen Vorwande (!), man solle ihnen einige
alte Rechte gewähren. Ich hin durch die Ordensgeistlichen dem Vorhaben
auf die Spur gekommen (!) und suchte so gut es anging, die
Sache ins rechte Geleise zu bringen. Ich fürchte, sie werden eines
Tages den draussen stehenden Bauern die Tore öffnen, kurzerhand
ihren Herren die Macht entreissen und eine Volksregierung einrichten;
... das scheint der Hauptzweck ihres ganzen Vorgehens zu sein.»
Peter berichtet weiter: «Der Rat, der übrigens, weil zwischen
den Häuptern der spanischen und der französischen Partei in Luzern
eine Rivalität bestand (!) in sich selbst uneinig war, musste sich mit
den Bürgern zu verständigen suchen. Er lud sie ein, ihre Begehren
einzureichen. In seiner Bedrängnis wandte er sich an die Geistlichkeit,
namentlich an den Nuntius um Vermittlung.» Was Peter hier schönfärberisch
«Vermittlung' nennt, ist ein hundertprozentiges Hülfegesuch.
Denn wir lesen darüber in Caraffas gleichem Bericht vom 15. Mai nach
Rom: «Da man wenig Hoffnung hegt, die Aufständischen zum Gehorsam
zurückzubringen, hat der Rat den Schultheissen Dulliker zu, mir geschickt,
mit der Bitte, ich möchte nicht nur meine Bemühungen um Erreichung
des Friedens fortsetzen, sondern die Bedrängnis der Regierung
auch dem Papste schildern und ihn im Namen aller anflehen, er möge
sie doch mit Mannschaft und Geld unterstützen, falls sie gezwungen
würden, ihre Untertanen mit Waffengewalt zu unterwerfen!» Allerdings
hat Caraffa diese militärische Unterstützung abgelehnt; der Papst
sei «der Vater aller» und könne nicht in Bürgerkriege eingreifen; «auch
sei der heilige Stuhl infolge der Kriege unter Papst Urban und der Unterstützung
der Venezianer gegen den gemeinsamen Feind (die Türken)
stark erschöpft..»
Trotzdem legte sich Caraffa, wie Peter weiterfahrt, «umso eifriger
ins Mittel, als er... vermutete, die Bürgerschaft, die unter anderem verlangte,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 405 - arpa Themen Projekte
Zürich, stehe auch in einem geheimen Einverständnis mit den Zürchern
(!), weswegen der Fortbestand des katholischen Glaubens (!) in
Luzern aufs höchste bedroht sei...» ... Ja, dieser Hirte des Herrn
trieb es so weit, zu behaupten, «dass die Hauptabsicht der Ketzer in
nichts anderem bestände, als die Gelegenheit zu benützen, sich in die
Stadt Luzern einzuschleichen und sie aus einer Hauptstätte des Katholizismus
in eine Schule der Prädikanten zu verwandeln...»! Mit diesem
Argument hat er dann die «Versöhnung» zwischen dem Rat und der
Bürgerschaft betrieben und sie unter Zelebrierung der Messe am
17. Mai in der Peterskapelle auch wirklich erreicht, in Gegenwart auch
des Propstes Jodokund Knab, «erwählten Bischofs von Lausanne und
der Welt- und Ordensgeistlichkeit der Stadt».
In demselben, von Peter referierten Bericht «vermutete dieses
päpstliche Oberhaupt der Luzerner Herren ferner, «dass ein Vertrag
zwischen den Bürgern und den aufständischen Bauern schon beinahe
abgeschlossen sei zum Zwecke, sich eines Tages der Stadt zu bemächtigen.
Dies habe solchen Schrecken und solche Bestürzung verursacht,
dass der grösste Teil der regierungstreuen Leute beabsichtigte, dem
Feinde das Feld zu räumen und sein Heil in der Flucht zu suchen; der
ganz konsternierte Rat besass weder die Macht, noch die Fähigkeit, sich
gleichzeitig nach beiden Seiten zu widersetzen»!
All dies bezeugt die grundlegende Bedeutung, die die bäuerliche
Revolution für die revolutionäre Erringung auch der bürgerlichen
Rechte hätten haben können. Leider nur hören wir nichts davon, dass
die Bürger ihrerseits den Bauern Gegenrecht gehalten hätten! Zwar
bedienten sie sich weidlich des gewaltigen Druckes der Bauern auf die
Herren, um diese zu kaum je erträumten Konzessionen an die Bürger
zu pressen. Kaum hatten sie aber die Zugeständnisse unter Dach, so
verrieten sie die Bauern und vereinigten sich mit den Herren, um mit
diesen zusammen auf die Bauern zu drücken. Die Herren ihrerseits
waren in dieser Lage (auf Zeit!) bereit, jede Demütigung seitens der
Bürger einzustecken — was diesen später, nach der Niederschlagung
der Bauern durch die Tagsatzungsarrnee, mit Richtschwert und
Galgen, Verbannung, Galeerendienst und saftigem Vermögensraub allerdings
barbarisch genug heimgezahlt worden ist! Die Herren gaben sich
dem Wahne hin, nach vollzogener «Befriedung» der Bürger mit den
Entlebuchern leicht fertig zu werden. «Um den Vergleich mit dem
Entlebuch zu ermöglichen» — so nämlich berichtet Liebenau — «wurden
vom 12. bis 17. Mai auch die Verhandlungen mit der Bürgerschaft
zu Ende geführt...» Die Herren spekulierten also schamlos auf den
Verrat der Bürger an den Bauern und auf die Treuherzigkeit der
Bauern, die von den Bürgern nicht einmal Gegenrecht verlangt hatten:
der Rat schloss zähneknirschend einen Scheinvergleich mit den
Bürgern, um mit diesem die Bauern und später auch die Bürger hereinzulegen!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 406 - arpa Themen Projekte
Aber die Luzerner Schläulinge hatten die Rechnung ohne die Entlebucher
gemacht. Schon am 8. Mai hatten diese den Räten von Luzern,
unter Zusage «sicheren Geleites», geschrieben: «sie sollen die alten Urkunden
ins Land schicken und mit den Gesandten sie im Entlebuch
aufsuchen, wenn sie einen Vergleich wollen; denn nach Luzern kommen
sie, die Entlebucher, nicht mehr». Am 12. schrieben sie abermals,
aber nicht nur an den Rat, sondern gleichzeitig auch an die Bürgerschaft.
Dem Rat drohten sie: «wenn die verlangten Urkunden bis morgen
nicht vorgewiesen werden, so müssen sie den Bund von Huttwil
zu Hilfe rufen»! Sie denunzierten dabei die «Truppenwerbungen (des
Rates) im Elsass» und erklärten u. a. noch, «sie können durch ein
Schreiben der Regierung beweisen, dass man die Regierung von Bern
aufgefordert habe, ins Entlebuch einzufallen». (Das wagt Liebenau, ohne
jeden Gegenbeweis, als «Lüge» zu bezeichnen, nachdem doch die Anforderungen
und Versprechungen gegenseitigen «Beisprungs» seitens
der Regierungen durch zahllose Briefe und Dokumente dieser Tage
belegbar sind! Und wir wissen ja, dass die Bauern durch Abfangen
der obrigkeitlichen Korrespondenz laufend in Besitz solcher Briefe
gelangten.) An die «befreundeten Bürger» aber schrieben «die 40 Geschworenen
von Entlebuch», «die Regierung zu drängen, dass sie die
verlangten Urkunden verweise»; dabei gaben sie ihnen natürlich
Kenntnis vom Inhalt ihres Schreibens an den Rat.
Damit hatten die Entlebucher den Bürgern die Waffen gegen den
Rat zur sofortigen Eröffnung des Kampfes um ihre eigenen Rechte in
die Hand gedrückt. «Deshalb wurden dann am 13. Mai Klein- und
Grossräte samt Bürgerschaft versammelt.» Um nun die Entlebucher
bis zum Abschluss des «Vergleichs» zwischen den Räten und den
Bürgern hinzuhalten, wurde beschlossen, «vier Geistliche ins Entlebuch
zu senden, um vorerst die Geschworenen daselbst zur Geduld zu ermahnen».
Und zwar erfolgten die «Ermahnungen zum Gehorsam»,
wie Peter den Bericht Liebenaus ergänzt, zugleich «im Namen der
Regierung und des Nuntius», Caraffas, des Gesandten des Papstes
in der Schweiz. Diese Delegierten, über deren Charakter als Spürhunde
Caraffas uns dieser selbst eindeutig aufgeklärt hat, waren der Leutpriester
Byslig, der Chorherr Wilhelm Pfyffer, sowie die «beim Volk
beliebten» Kapuzinerpatres Basilius und Placidus. Aber, als diese am
15. Mai in Schüpfheim im Entlebuch die Geschworenen mit ihrer hohen
obrigkeitlichen und kirchlichen Mission einschüchtern wollten, da «hat
man sie gar nicht anhören wollen», wie der venezianische Gesandte in
der Schweiz an seine Regierung schrieb. Vielmehr kehrten die Entlebucher
den Spiess um: sie verlasen den geistlichen Herren «ihre Resolutionen»!
Es waren in der Hauptsache die stolzen Forderungen der
Landsgemeinde vom 3. Mai beim Heiligen Kreuz. Diese kehren drei
Tage später bei einer noch ganz anders feierlichen Gelegenheit verstärkt
wieder — wir werden sie dort kennen lernen. Vorläufig schickten
die Entlebucher die vier Geistlichen wieder heim, indem sie, nach
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 407 - arpa Themen Projekte
Luzerner gar nicht» und indem sie den geistlichen Boten zuhanden des
Luzerner Rates, wie Peter sagt, «ein Ultimatum —Vorweisung der Urkunden
bis spätestens am 18. Mai» — schriftlich aushändigten.
Das war jedoch nicht die einzige Antwort, die die Entlebucher an
diesem 15. Mai, am Tag nach der zweiten Landsgemeinde in Huttwil,
den Luzerner Herren gaben. Gerade die Entlebucher werden in Huttwil
diejenigen gewesen sein, die ob dem Zögern des verhandlungsseligen
Leuenberger am härtesten hatten auf die Lippen beissen müssen.
Jetzt, am Tag darauf, waren sie die ersten, die die kriegerische Konsequenz
zogen: «Am gleichen Tag liess der geheime Rat die Entlebucher
Truppen nach Sins und Gisikon legen» so berichtet Peter; «zugleich
drohten die Aufständischen, durch Ausrüstung von Schiffen auch den
Seeweg zu sperren! Liebenau weiss darüber noch zu berichten: «Während
dieser Unterhandlungen (mit den vier geistlichen Delegierten des
Luzerner Rates) besetzten auf Betrieb Waibel Hüslers, genannt Hartli,
und Gassmanns von Eich 700 Bauern, worunter 300 Berner (!), den
Pass bei der Brücke zu Gisikon und zu Sins. Den Oberbefehl über die
Truppen in Gisikon führte Hans Amrein aus der Holdern... Wie es
bei diesem Auszuge herging, ist daraus ersichtlich, dass Felix Möller
auf der Wydenmühle zu Eschenbach auf dem Emmenfelde offen verlangte,
man soll jedem, der gegen den Auszug rede, sein Gut nehmen,
ihm Weib und Kind an die Hand geben und ihn aus dem Lande verweisen;
weigere sich einer, dem Befehle nachzukommen, so solle man
ihn an den nächsten Baum aufhängen.»
Das war die Sprache echter Revolutionäre, die wussten, dass man,
wenn man das Ziel will, auch den Weg wollen muss und dass man
nicht in Pantoffeln Krieg führen kann. Wie nötig diese Sprache und
vor allein die Sprache der Tatsachen, der sofortige anfeuernde militärische
Auszug, war, wenn man die ganze Bauernsache nicht abermals
demselben Verrat wie beim «Rechtlichen Spruch» preisgeben
wollte, das zeigt nichts deutlicher als die Tatsache, dass am gleichen
15. Mai, als die Entlebucher auszogen und ihr Ultimatum nach Luzern
schickten, in Malters bereits eine Kapitulantenversammlung tagte. Sie
wurde von einigen Führern anderer Aemter zusammengebracht, die soeben
aus Huttwil heimgekehrt waren und in denen der Verlauf der
Landsgemeinde unter Leuenbergers Führung offensichtlich das Vertrauen
in den Erfolg der Bauernsache nicht nur nicht zu stärken,
sondern direkt zu erschüttern vermocht hatte. Durch die inzwischen
vom Luzerner Rat eifrig betriebenen Rüstungen «in Furcht und Besorgnis»
gejagt, dachten sie daher, wie Vock berichtet, «neuerdings
auf Aussöhnung mit der Regierung. Sie liessen zu dem Ende einige
Bürger der Stadt (!) nach Malters hinauskommen und wollten, durch
Vermittlung derselben und unter Mitwirkung eines Unterwaldners,
den am 18. März mit der Regierung geschlossenen Vergleich wieder
ins Leben rufen» — d. h. den von den Bauern längst als «gefälschtes
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 408 - arpa Themen Projekte
rehabilitieren!
Eine Wiederannahme dieses verworfenen Spruchs seitens der
Bauern aber hätte jetzt nicht nur ein Zurückfallen auf die Position der
Bauern vom 18. März, sondern eine vollständige Preisgabe auch dieser
Position, d. h. die bedingungslose Unterwerfung, bedeutet. Der Wolhuser
Bund, für alle Luzerner Bauern noch immer die unerschütterliche
Grundlage ihrer Zugehörigkeit auch zu dem aus ihm hervorgegangenen
grösseren Bund, hätte abgeschworen werden müssen —
und damit wäre der Hauptpfeiler auch des Sumiswalder und Huttwiler
Bundes zusammengebrochen. Klar, dass die Entlebucher, deren erstrebte
und bereits wiederholt proklamierte Souveränität auf der Tatsache
der eidgenössischen Bedeutung des grösseren Bundes beruhte —
warum sie diesen unter allen Umständen stützten, auch wenn ihnen
die Leitung Leuenbergers nicht im geringsten gefiel — herbeieilten,
um den wankenden Pfeiler wieder aufzurichten! «Allein die Entlebucher»,
berichtet Vock nach Cysat-Wagenmann, «welche auf die erste
Nachricht von dieser Unterhandlung nach Malters eilten, konnten die
Häuptlinge der übrigen Aemter von der friedlichen Gesinnung wieder
abwendig machen, und der Anlass wurde benutzt, mit den anwesenden
Stadtbürgern selbst in näheres Einverständnis zu treten und
neue Revolutionspläne zu entwerfen.»
Man kann nur immer wieder neu staunen über die Energie und
Geistesgegenwart dieser Entlebucher Bauern, die an diesem einen Tag
nach der zweiten Huttwiler Landsgemeinde so viele Aktionen nebeneinander
erfolgreich durchzuführen vermochten, um das, was ihnen
an dieser Landsgemeinde zu fehlen schien, durch eigene Kraft und auf
eigene Verantwortung beispielgebend ins Werk zu setzen. Wären sie
damit in den nächsten, entscheidenden Tagen nicht so tragisch allein
geblieben — während die Berner und Basler Bauern diese kostbaren
Tage für sinnlose Verhandlungen vergeudeten und die Solothurner,
vom Kapitulanten Zeltner missleitet, schmälich zu Kreuze krochen —
die ganze Bauernsache wäre noch jetzt zu retten, die Herren in die
Knie zu zwingen und so, wie diese fürchteten, «das Verhältnis von
Obrigkeiten und Untertanen gänzlich umzukehren» gewesen...
Aber niemand als die Entlebucher hat zu zeigen vermocht, wie
man das macht. Ihr Ultimatum vom 15. wurde von den Herren pünktlich
befolgt. Jetzt war der Luzerner Rat sogar den Bauern gegenüber
(natürlich ebenfalls nur auf Zeit!) zu jeder Selbstdemütigung bereit.
Es galt jetzt für die Herren den Rücken tief zu bücken — allerdings
nur zu dem Zweck, den versteckten Dolch im Gewande unbemerkt zurechtzurücken,
um ihn zu gegebener Zeit den Bauern in den Rücken
zu zucken... «Als am 17. Mai», schreibt Liebenau, «der demütigende
Vergleich mit der Bürgerschaft geschlossen war, zeigte der Rat von
Luzern den Landesbeamten von Entlebuch an, dass am 18. Mai die gewünschte
Gesandtschaft erscheinen werde. In einer Vorbesprechung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 409 - arpa Themen Projekte
Entlebuchern erkundigen wolle, welche Ratsherren ihnen als Gesandte
genehm wären»! Schliesslich kam eine, von einer allgemeinen Stadtgemeinde
gewählte, ganz erstaunlich «hochansehnliche» und noch erstaunlicher
zusammengesetzte Gesandtschaft zustande: «Im ganzen
bestand die Gesandtschaft aus 33 Personen zu Pferd und einigen Fussgängern»
(Boten und Bedienung ungerechnet). «Noch niemals hatte
der Rat von Luzern eine so grosse Gesandtschaft irgendwohin abgeordnet.»
An ihrer Spitze stand der Schultheiss Ulrich Dulliker; andere
Mitglieder der Regierung (Kleinräte) waren: Statthalter Laurenz
Meyer, Landvogt Kaspar Pfyffer, Hauptmann Nikolaus Bircher und
der Stadtschreiber Ludwig Hartmann, der als Aktuar der Gesandtschaft
fungierte. Der Grosse Rat der übrigen «Regierungsfähigen» entsandte
vier prominente Mitglieder. Die Vertretung der Bürgerschaft in
dieser Gesandtschaft umfasste zehn Bürger, darunter alle Wortführer
der soeben «erfolgreich» abgeschlossenen Rebellion, wie Melchior Rüttimann,
Martin Marzell, Wilhelm und Martin Probstatt etc. --- lauter
Kandidaten für Richtblock und Gefängnis. Ja, auch zwei Vertreter der
bisher völlig rechtlosen und verachteten Hintersassen der Stadt Luzern,
für die bei dem eben geschlossenen Vergleich zwischen Aristokratie
und Bürgerschaft auch einige Brosamen vom Tische gefallen
waren, ein Schuhmacher Hans Schnyder und ein Zimmermann Balz
Uli, waren als Mitglieder der Gesandtschaft gewählt und mitgenommen
worden. «Mit Empfehlung des Nuntius Caraffa zogen mit: Leutpriester
Byslig und Chorherr Wilhelm Pfyffer», und um den geistlichen
Schwanz der Gesandtschaft voll zu machen, schlossen sich «auf
Wunsch des Rates... auch die beiden einflussreichen Kapuziner», der
Guardian des Ordens, Pater Basilius, sowie der Prediger Pater Placidus,
der Abordnung wieder an, «denn sie hatten bisanhin allen diesfallsigen
Verhandlungen beigewohnt».
Aber damit noch nicht genug: «auch je vier Abgeordnete von Uri,
Schwyz und Unterwalden und sechs aus Zug, worunter auch der berüchtigte
Händelstifter Peter Trinkler» (schreibt Liebenau!), nahmen
an der Gesandtschaft in das eine Amt Entlebuch teil. Zur Erklärung
dieses Umstandes muss hier noch kurz berichtet werden, wie diese Abordnungen
zustandekamen, durch wen und zu welchem Zweck. Liebenau
berichtet darüber: «Luzern hatte schon am 14. Mai die Urkantone
um Hilfe gemahnt, ebenso den Gouverneur von Mailand; am
15. Mai wurde dann das Gesuch um Einberufung einer vierörtigen Tagsatzung
nach Brunnen auf den 17. Mai gestellt und daselbst das Gesuch
unterbreitet, die Waldstätte möchten eine Gesandtschaft ins Entlebuch
senden, um den in Huttwil am 14. Mai beschlossenen Aufbruch.
von 16000 Mann zu verhindern. Landvogt Sonnenberg schilderte daselbst
die schwierige Lage Luzerns. Allein die Gesandten waren anfangs
nicht geneigt, sofort auf das Ansuchen um Hilfeleistung einzutreten.»
(Sie fürchteten die Erhebung der eigenen Bauern!) «Als aber während
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 410 - arpa Themen Projekte
Bewegung in den Freien Aemtern, eintrafen — an welchen die Urkantone
als Mitherren» (d. h. die Aristokratenfamilien, deren Haupteinnahmequellen
die Landvogteien der Untertanenländer waren) «besonderes
Interesse hatten — da stiegen die Gesandten in die Schiffe, um
ihre Regierungen zu bitten, dass sie Gesandte ins Entlebuch schicken.»
Es waren also, mit Ausnahme Peter Trinklers und seiner Genossen,
reine Herrendeputierte aus den Urkantonen, mit dem Auftrag, im Entlebuch
mitzuwirken, «um den in Huttwil am 14. Mai beschlossenen Aufbruch
von 16000 Mann zu verhindern»! Was Peter Trinkler betrifft,
so verleumdete ihn sein Todfeind Beat zur Lauben, der Zuger Herrendiener
der Luzerner, bei Dulliker, indem er diesem schrieb, «dass
Trinkler auf eigene Faust sich wieder der zugerischen Gesandtschaft
im Entlebuch angeschlossen habe». Trinkler war eben wieder zum
Zuger Landammann gewählt worden, was beweist, dass er die volle
Zustimmung des Zuger Volkes genoss. Wenn aber zur Lauben ihm
unterschiebt, er sei ins Entlebuch gezogen, «um für die Bauern wirken
zu können», so mag er recht haben. Umso charakteristischer war
seine Wiederwahl für die allgemeine Volksstimmung im Zugerland.
Diese so geartete bunte Gesellschaft musste sich in Luzern bereits
am Morgen des 18. Mai früh um drei Uhr in Marsch setzen, um den
Tag noch zu Verhandlungen im Entlebuch ausnutzen zu können. Aber
— wie Liebenau berichtet — «als um 9 Uhr die Gesandtschaft in
Schüpfheim eintraf, da war niemand da zur Begrüssung dieser Abordnung.
Und als der Schultheiss Dulliker die Beamten des Entlebuch
ersuchen liess, man möchte die Verhandlungen rasch eröffnen, erhielt
er den Bescheid, die Abgeordneten aus Escholzmatt und Marbach
seien noch nicht da. Nicht einmal zum Nachtessen fand sich einer der
Geschworenen ein, um nach landesüblicher Weise Gesellschaft zu leisten.
Dagegen kamen einzelne rohe Burschen herbei und erlaubten sich
beleidigende Worte.» Durch dieses einheitlich ablehnende Verhalten
der Entlebucher und durch die Verweigerung jeglicher konventionellen
Gepflogenheit sollte zweifellos von vornherein eindeutig demonstriert
werden, dass das Entlebuch sich Luzern gegenüber zu nichts mehr verpflichtet
fühle, dass es «die Luzerner gar nicht brauche».
Was nun die gepflogenen Verhandlungen selbst betrifft, so verzichten
wir auf die Wiedergabe alles dessen, was eine blosse Rekapitulation
der zahlreichen früheren Beschwerden der Bauern darstellt.
Wir wollen darüber hier nur zusammenfassend sagen: alles, was wir
darüber erfahren, beweist, dass es Hans Emmenegger und der «geheime
Rat» insgesamt bei dieser Gelegenheit auf eine letzte, gründlich vorbereitete
und umfassende Generalabrechnung abgesehen hatten. Dabei
figurieren sämtliche Beschwerden hier durchaus nicht mehr als Artikel
oder Postulate, deren Bewilligung oder Nichtbewilligung durch die
Herren Gegenstand von Unterhandlungen wären, vielmehr nur noch
als Beweise für die Schuld der Herren und für das Recht der Bauern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 411 - arpa Themen Projekte
Der Untertanen-Standpunkt ist seitens der Entlebucher völlig überwunden
— sie fühlen sich als freien, selbständigen Ort der Eidgenossenschaft.
Darum kommt es ihnen in diesem geschichtlichen Augenblick
nur noch darauf an, ihr Recht darauf ein- für allemal urkundlich-historisch
nachzuweisen.
In keiner Szene des ganzen Bauernkrieges ist die geschichtliche
Grösse, die der Entlebucher Pannermeister Hans Emmenegger allen
Fehlern zum Trotz schliesslich doch erreicht, derart mit Händen zu
greifen, wie in der grossen Auseinandersetzung, die er am 18. Mai
in Schüpfheim als Wortführer der Freiheitsrechte des Entlebuchs mit
dem Schultheiss Ulrich Dulliker als Wortführer des totalitären Herrschaftsanspruchs
des Luzerner Herrenregimes vor der grossen Ratsdelegation
einerseits, der Versammlung der vierzig Geschworenen andererseits
und unter Einbeziehung der draussen vor dem Ratshaus
tagenden Volksversammlung ausgetragen hat. Emmeneggers geschichtliche
Bedeutung ist sonst schwer zu erfassen; ausser beim
Richtfest des Aufruhrs in Wolhusen steht er nie im Rampenlicht der
Geschichte, vielmehr verschwimmt das Bild seiner Persönlichkeit in
einem oft geheimnisvollen und von ihm vielleicht nicht ganz ungewollten
Dämmerlicht, auch dort, wo wir wissen, dass er an bestimmten
Tagungen und ihren Beschlüssen führend mitgewirkt hat. Wir wissen
viel weniger über seine konkreten Handlungen und seine individuellen
Ansichten und Entschlüsse als über diejenigen Leuenbergers; sie treten
meist hinter den kollektiven Handlungen und Beschlüssen der Landsgemeinden,
der Geschworenen oder des «geheimen Rats» zurück. Jetzt,
in Schüpfheim am 18. Mai, tritt uns das Bild seiner geistigen Persönlichkeit
— auch durch die missgünstigen Verzerrungen der zwei Herrenchronisten,
denen wir die Nachrichten darüber hauptsächlich verdanken,
hindurch — klar, markant und unmissverständlich entgegen.
Das Gespräch wurde, nach Liebenau, folgendermassen eröffnet:
«Schultheiss Dulliker erklärte, diese ansehnliche Gesandtschaft sei
namens der Regierung da, um den guten Willen zur Beilegung des
Konfliktes zu bezeigen; sie sei auch bereit, alles zu bewilligen, was
nach Recht und Billigkeit gefordert werden könne.»
«Pannermeister Emmenegger erwiderte: Die Ausschüsse des Entlebuchs
haben nie einen Krieg begehrt; sie seien vielmehr zum Frieden
geneigt. Sie begehren nur ihre alten Rechte und Freiheiten, Herausgabe
der ihnen abgenommenen Urkunden und Abschaffung der Neuerungen.»
Hierauf verlangte Emmenegger: «Zurückgabe der vor 57 Jahren
dem Landessiegler Dahinden abgenommenen Briefe», sowie viele andere
Einzelheiten.
«Dann ging man zur Verlesung der Verträge zwischen Luzern und
Entlebuch aus den Jahren 1405 und 1514 über. Die Entlebucher erklärten:
Diese beiden Verträge hat Luzern nicht gehalten. Schultheiss
Dulliker replicierte: warum habt ihr gegen die Einzelnen (!), welche
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 412 - arpa Themen Projekte
nicht haftbar!» Diese Finte! Als ob die «Einzelnen» nicht Beauftragte
des Luzerner Rates gewesen wären!
Nach Peter «hoffte der Rat von Luzern, mit den Entlebuchern eine
Verständigung zu erzielen auf Grund» eben dieser beiden Verträge.
«Schultheiss Dulliker legte daher den Entlebuchern das Original des
Kaufbriefes von 1405 vor», mit welchem dem Entlebuch (jedoch unter
Vorbehalt der Freiheitsrechte des Entlebuchs!) an Luzern verpfändet
worden war. Darauf aber waren die Entlebucher vorbereitet. Johann
Jakob Müller nämlich, der von jeher mit besonderem Eifer in Chroniken
und Archiven nach alten Freiheitsbriefen forschte, hatte dabei das
grosse Glück gehabt, «jene Urkunde aus dem Jahre 1858» aufzufinden,
«worin Rudolf von Oesterreich versprochen hatte, das Entlebuch nie
mehr zu verpfänden»! Zum Staunen der Luzerner legte Müller, in seiner
Eigenschaft als «Sekretär des Entlebucher Geheimrates », das Original
dieser Urkunde dem Schultheiss Dulliker vor. «Daher erklärte
jetzt Pannermeister Emmenegger der Gesandtschaft, die Entlebucher
würden die Stadt Luzern nicht mehr als ihre Herrin anerkennen, es sei
denn, dass man urkundlich beweise, sie hätten in die Verpfändung an
Luzern eingewilligt»! Nach Liebenau haben wir diesen Bericht Peters
wie folgt zu ergänzen: «Und da Luzern eine solche (Urkunde) nicht
vorweisen konnte, erklärten sie (die Entlebucher): die Verpfändung an
Luzern war niemals gültig»!
Dulliker blieb angesichts dieser überlegenen urkundlich-historischen
Beweisführung Emmeneggers nichts anderes übrig, als auf den
de facto-Besitz des Landes Entlebuch seitens Luzerns seit 248 Jahren
hinzuweisen.
«Pannermeister Emmenegger entgegnete» (nach Liebenau): «dieser
Besitz ist hinfällig geworden, weil die Stadt Luzern ihre Verpflichtung,
das Land bei seinen Rechten und Freiheiten zu wahren, nicht gehalten
hat...» . berichtet: «Vergeblich berief sich Dulliker auf
das Vorkommnis vom 13. Mai 1395 und den Vertrag von 1405. Emmenegger
verlangte von den Gesandten der IV Orte (!), dass man die völlige
Unabhängigkeit der Entlebucher von Luzern festsetze»! Dies begründete
Emmenegger nicht nur historisch, sondern auch mit einem
höchst aktuellen Grund: weil (nach Peter) «die Regierung von Luzern
ihr Land den Bernern habe ,preis geben wollen'»; weil (nach Liebenau)
die Regierung «die Berner, laut Schreiben des Schultheissen Dachselhofer
(von Bern) an den Schaffner von Trub, zum Einfalle ins Entlebuch
gemahnt hat». (Das wird einer der von den Bauern aufgefangenen
Herrenbriefe gewesen sein.)
Damit hatte Emmenegger die Diskussion auf den Boden der unmittelbaren
Gegenwart verpflanzt, um zu dem von ihm zielbewusst erstrebten
praktischen Ende zu gelangen. Sofort wurde die Auseinandersetzung
stürmisch und riss auch andere Teilnehmer der Versammlung
in die Diskussion. Als Dulliker das Hilfsgesuch der Luzerner Regierung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 413 - arpa Themen Projekte
hatte, bestritt, fiel ihm der Landeshauptmann Niklaus Glanzmann mit
dem heftigen Ausruf ins Wort: «um des jüngsten Gerichtes willen habt
ihr die Berner um Hilfe gemahnt»! Damit wollte Glanzmann wohl die
Existenz des von Emmenegger erwähnten Herrenbriefes beschwören,
von dem er, bei seinen intimen verwandtschaftlichen Beziehungen zum
Emmental, sehr wohl persönliche Kenntnis haben konnte. Dann rief
auch Hans Jakob Stürmli aus Willisau dazwischen: «man habe so
viele falsche Briefe bei banden, dass es eine Schande sei». \Voraus
übrigens zu entnehmen ist, dass die Entlebucher dafür gesorgt hatten,
auch Vertrauensmänner aus anderen Aemtern zu Zeugen dieser Verhandlungen
zu machen. «Denn auch die Rothenburger hatten», wie
Liebenau berichtet, «schon in Schüpfheim in Gegenwart der luzernischen
Abgeordneten gedroht, wenn bis am Donnerstag (der 18. war ein
Sonntag) die Sache nicht in Ordnung sei, so wolle man gegen die Stadt
Luzern marschieren und dieselbe im Sturm einnehmen»!
Hier unterbrach nun Hans Emmenegger die Verhandlungen, «um
von der Laube aus mit dem anwesenden Volke zu verhandeln und
demselben Propositionen zu machen», wie Liebenau berichtet. Damit
schaltete Emmenegger in sehr geschickter Weise die Volksmeinung in
die Verhandlungen mit den Herren ein. Er wird der draussen gespannt
harrenden Menge Bericht über den bisherigen Verlauf derselben erstattet
und dabei nicht verfehlt haben, auf die urkundlich erwiesene
Unbegründetheit der Herrschaftsansprüche Luzerns auf das Entlebuch
hinzuweisen. Denn nun wurde von dieser Volksversammlung, wie
Liebenau weiter berichtet, «beschlossen, die Abgeordneten von Luzern
anzufragen, ob sie weitere Rechte der Regierung auf das Land nach-'
weisen können und ob sie vollkommene Gewalt zum Abschluss eines
Vertrages besitzen».
Die Rückfrage bei den Herren ergab nun erstaunlicherweise, dass
diese grösste Gesandtschaft, die die Luzerner Regierung jemals an irgendeinen
Ort delegiert hatte, ohne jede Vollmacht von der Regierung
zum Abschluss eines Vergleichs ins Entlebuch gekommen war! Und
dies trotzdem doch fünf Mitglieder der Regierung und darunter der
amtierende Schultheiss selber an der Spitze der Gesandtschaft waren.
Es war den Herren also wieder einmal nur um täuschendes Hinhalten
zum Zweck des Zeitgewinns zu tun, was auch aus der Aufforderung
Dullikers an die Entlebucher hervorgeht, sie «sollen ihre Begehren in
Schrift fassen und dem Rate übermitteln».
Doch davon hatten die Entlebucher nun allgemach genug. Als daher
Dulliker sie anfragte, ob sie «die alten Urkunden über die Hoheitsrechte
anhören wollen» (womit er wohl von der brenzlichen Gegenwart
wieder ablenken wollte) — da erwiderte Emmenegger sarkastisch:
«Es sind noch viele alte Sachen zu erörtern! So besass Entlebuch
vormals den Blutbann, es wählte einen Ammann, besass das
Recht, die Garde in Rom zu besetzen...» Von den Gegenwartsforderungen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 414 - arpa Themen Projekte
dass das Ersuchen der Luzerner Herren an die von Bern, das Entlebuch
mit ihren Truppen zu überfallen, ein eklatanter «Vertragsbruch
von Seite Luzerns gegen Entlebuch» sei, und dieser gebe dem Entlebuch
«das Recht, sich von der Obrigkeit loszumachen». Landessiegler Binder
fügte hinzu: «Mit einer solchen Obrigkeit können sie nicht verhandeln.»
Darauf hatte Dulliker offenbar den genialen Einfall, Emmenegger
beiseite zu nehmen und zu versuchen, ihn unter vier Augen zu korrumpieren
— einen Emmenegger! Denn der Herrenchronist Liebenau berichtet:
«Bei einer konfidentiellen (!) Besprechung erklärte Pannermeister
Emmenegger auf die Frage des Schultheissen Dulliker, ob die
Entlebucher wirklich dem Rate gehorsamen werden, wenn dieser erweisen
könne, dass die Behauptung über den verlangten Einfall der
Fremden unrichtig sei, ganz naiv (!): auch dann nicht! Denn in diesem
Falle erklären wir: die Regierung hat durch die strengen Strafen der
Landvögte ihre Herrschaft verwirkt.»
Das war die richtige konkrete Antwort: wir wollen von eurem
Ausbeutungsregime überhaupt nichts mehr wissen! Ja, Emmenegger
ging noch weiter: er verlangte, wie Peter berichtet, 50000 Gulden an die
«aufgelaufenen Kosten», also Kriegsentschädigung, wie man sie von
einem besiegten Feind fordert. Noch mehr: wie der Nuntius Caraffa
darüber nach Rom schrieb, verlangte Emmenegger: «Es sollen alle
Schulden erlassen werden, ausser denjenigen gegenüber der Kirche und
Wittwen und Waisen.» Dieser allgemeine Schuldenerlass nämlich
hätte den ganzen riesigen Hypothekarwucher der Luzerner Herren, der
das Land zu Boden drückte, zum Einsturz gebracht und den Bauern
erst die wahre Freiheit, die ökonomische, gesichert! «Zudem sollte die
Gesandtschaft» — so schliesst Peter seinen Bericht über dieses denkwürdige
Gespräch — «ihre Zustimmung zu diesen Forderungen sofort
und in ganz befriedigender Weise erteilen, andernfalls würden die
Bauern unverweilt wiederum zur Belagerung der Stadt schreiten»!
Falls die Stadt aber vorzöge, «dem Bauernbund beizutreten» -— dann,
ja dann (sagt Liebenau) «werde man ein Vorkommnis abschliessen,
das der Obrigkeit zu grossem Nutzen gereichen werde»! Dann würde
sogar wohl «auch die Stadt Bern dem Bunde beitreten...» Mit andern
Worten: wir sind sowohl Luzern wie Bern gegenüber unter allen
Umständen entschlossen, das Ziel unseres Bundes, die völlige Erneuerung
der Eidgenossenschaft aus ihrem demokratischen Ursprung heraus
mit den Waffen zu erzwingen!
Damit war also der Zweck der ganzen Gesandtschaft, »den in Huttwil
am 14. Mai beschlossenen Aufbruch von 16000 Mann zu verhindern»,
an der nicht genug zu bewundernden Zielstrebigkeit der Entlebucher
endgültig gescheitert. Kaum dass diese, auf inständiges Bitten
und Flehen der luzernischen «geistlichen Gesandten», «dem Rate von
Luzern eine letzte Frist zur Genehmigung ihrer Forderungen bis zum
22. Mai bewilligten», wie Peter berichtet.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 415 - arpa Themen Projekte
Die grosse Ratsgesandtschaft kehrte also — bis auf diese letzte,
von den Priestern erflehte Konzession — völlig unverrichteter Dinge
nach Luzern zurück. «Da der Rat von Luzern», wie Peter weiter erzählt,
«den Begehren der Aufständischen unmöglich entsprechen konnte,
ordnete er am 18. Mai» — also noch am selben Tage — «die Verteidigungsanstalten
für die Stadt an, mahnte die IV Orte und den Abt von
St. Gallen schleunigst zum Aufbruch und zog Truppen aus den treu
gebliebenen Aemtern heran» (das waren, wie von•Anfang an, nur Weggis
und Habsburg). «Im Einverständnis mit den Vermittlern der IV
Orte und der aufständischen Bauern (?), die indessen ihre Begehren
schriftlich eingereicht, proponierte der Rat den Aufständischen nochmals,
sie möchten ihre Forderungen dem Spruche eines eidgenössischen
Gerichtes anheimstellen. Zwar war ja bestimmt zu erwarten, dass
die Bauern auch diesen letzten Vorschlag zum friedlichen Vergleich
ausschlügen; aber dem Rate von Luzern musste sehr daran gelegen sein,
etwas Zeit zu gewinnen: denn noch waren die Hilfskontingente nicht
da und noch galt es, die Vorräte in der Stadt zu vermehren, da es an
ausreichenden Nahrungsmitteln für eine längere Belagerung mangelte.
Neuerdings wandte sich Luzern mit dem Gesuch um Lieferung von
Getreide an den Vorort.» «Dem Rate von Luzern musste sehr daran
gelegen sein, etwas Zeit zu gewinnen...» Das also war der Zweck, für
den die «geistlichen Gesandten» das Schwergewicht ihrer kirchlichen
Autorität bei den Bauern in die Wagschale warfen — und also sind
Emmenegger und seine Kampfgenossen doch in diesem einen Punkt
der Verhandlungslist der Herren nocheinmal erlegen, als sie dem Rate
volle vier Tage «zur Genehmigung ihrer Forderungen», d. h. praktisch
volle vier Tage Vorsprung in der Kriegsrüstung, schenkten. Aber es
war der einzige wunde Punkt in dieser ganzen Verhandlung.
Sonst aber bewies Haus Emmenegger in dieser grossen Szene eine
Kunst der «Verhandlung», die nichts mehr zu tun hatte mit der Verhandlungssucht
so vieler anderer Bauernführer, von der auch Leuenberger
sich nie ganz zu befreien vermochte. Diese Verhandlungs-Sucht
entsprang bei der Mehrzahl der Bauernführer dem immer noch verwaltenden
schlechten Gewissen als «fehlbare Untertanen» —. und
durchgehend bei allen natürlich der echt bäuerlichen Angst und Sorge
um Haus, Hof und Ernte, von denen der Bauer nie lange weg und
nicht weit weg zu sein wünscht. Diese Verhandlungssucht war von Anbeginn
das grosse Verhängnis, das auf der Bauernsache lastete. Denn
sie liess keine rechtzeitig durchgreifenden und vor allem keine allgemeinen
Massnahmen zur Durchsetzung des doch von allen zweifellos
gewollten und feierlich beschworenen Bundeszieles aufkommen. Das
schuf in der Führerschaft selbst eine lähmende Zwielicht-Atmosphäre,
in der auch ausgesprochene Kapitulanten wie Adam Zeltner, oder gar
solch ehrgeizige, stets zum Verrat neigende Abenteurer wie Kaspar
Steiner, eine grosse, sonst unbegreifliche Rolle spielen konnten. Denn
vom schlechten Gewissen des einmal zur Rebellion übergegangenen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 416 - arpa Themen Projekte
"Friedensverhandlungen" einer nicht repräsentativen
Bauerndelegation (von Kapitulanten) mit dem Zürcher
Bürgermeister Johann Heinrich Waser im Zelt General
Werdmüllers am 4. Juni 1653
(Volkstümliche Darstellung des 19. Jahrhunderts.)
Berufung der Bauern auf das Stanser Vorkommnis zur Rechtfertigung
des Huttwiler Bundes. Waser demonstriert den verdutzten
Bauern, dass das Stanser Verkommnis kein Volks-, sondern
ein Herrenbund sei, dass er nämlich gar keine Verpflichtung
der Regierungen gegenüber ihren "Untertanen"enthalte, vielmehr
"direkt die Unterdrückung von Volksaufläufen bezwecke".
Nach einer Original-Lithographie in der Landesbibliothek in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 416 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 417 - arpa Themen Projekte
«Untertanen» bis zur kopflosen Kapitulation, ja bis zum ausgesprochenen
Verrat ist nur ein winziges Schrittchen. Dieses schlechte Gewissen
des «fehlbaren Untertanen» in Verbindung mit dem ständigen
«Heimtrieb» des Bauern bot den Herren eine stets offene Einbruchs-.
stelle für ihre Diversionen und Korrumpierungsversuche und ein ideales
Manövrierfeld für ihre Täuschungs- und Verschleppungsmanöver:
es war ihre einzige grosse Chance, die sie raffiniert auszunutzen verstanden,
die Luzerner mehr durch Falschheit, die Berner mehr durch
einschüchternde Frechheit. Auch bei Leuenberger blieb, im Widerspruch
zu seiner ganzen, an sich gewiss grossangelegten Natur, das
«Untertanen»-Bewusstsein bis zuletzt wirksam; bei ihm — und gewiss
noch bei manchen seiner Parteigänger — zudem unterstützt durch das
ständige Sündenbewusstsein des Sektierers.
Auch Emmenegger und die Entlebucher haben die Verhandlungskunst
ohne Beimischung der Kapitulantengefahr erst auf dem Umweg
über schwere Enttäuschungen erlernen müssen; die schwerste davon
war ihre Uebertölpelung mit dem «Rechtlichen Spruch» durch Zwyers
Vermittlungs-Gesandtschaft. Erst von dem Augenblick an, wo sie fest
entschlossen waren, die angemasste autoritär-absolutistische Herrenherrschaft
und Herrenwirtschaft überhaupt abzuwerfen und wo sich
der Wille zur Eigenstaatlichkeit in ihnen durchsetzte — der Wille, ein
«eigener Stand» der Eidgenossenschaft zu werden —, erst da fanden
sie auch die richtige Methode zur Verhandlung mit den Herren, wie
sie zum erstenmal erfolgreich am 3. Mai beim Heilig Kreuz hervortrat
und wie sie jetzt in Schüpfheim über die Herren triumphierte. Dieser
Wille zur Eigenstaatlichkeit, der den Entlebuchern das Rückgrat so imponierend
stärkte, hatte, mit Ausnahme der Willisauer, bei den Verbündeten,
den Berner, Solothurner und Basler Bauern, noch gar nicht
Zeit gehabt, sich zu entwickeln, und er hat sich dort bis zuletzt nirgends
durchzusetzen vermocht. Und doch wäre dies eine Voraussetzung
dafür gewesen, nicht nur auf dem Verhandlungswege mit den
Herren fertig zu werden, sondern überhaupt eine «neue Eidgenossenschaft»
zu begründen, die die Herreneidgenossenschaft hätte verdrängen
können. Denn dazu waren unter den föderalistischen Verhältnissen
der Schweiz unbedingt selbständige Glieder nötig, die erst eigentlich
den Volksbund gegen den Herrenbund hätten konstituieren können.
Vielleicht, ja sehr wahrscheinlich, hätte sich der Wille zur Eigenstaatlichkeit
und dadurch sowohl der Wille zum kompromisslosen Kampf
wie die steinharte Klassensolidarität der Entlebucher schliesslich durch
das Beispiel, das sie am 18. Mai gaben, auch bei den andern Gliedern
des Huttwiler Bundes- durchgesetzt, wenn die Verhandlungen im Stil
der Entlebucher oder ein einziger erfolgreicher Waffenkampf die Niederlage
auch nur um Wochen hinausgeschoben hätte — dann aber
wäre von einer Niederlage keine Rede mehr gewesen! Aber eben der
Mangel des zur Kompromisslosigkeit erst erziehenden Willens zur Eigenstaatlichkeit
bei den andern Gliedern des Bundes auf dieser Stufe
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 418 - arpa Themen Projekte
So blieb dieser stahlharte Wille im Entscheidungskampf nicht nur
auf das eine Glied, die Luzerner Bauern, sondern praktisch einzig auf
die Talschaft Entlebuch beschränkt — und diese allein konnte in dem
Grosskampf, der nun anhob, die Gesamtsache der Bauern nicht mehr
retten. Wohl aber hat sie die Ehre des Bauerntums insgesamt gerettet,
indem sie noch am Abend des 18. Mai, als die Herrengesandtschaft bereits
die Heimreise angetreten hatte, aber noch «in Gegenwart der luzernischen
Geistlichen», einstimmig folgende Beschlüsse abmehrte, in
denen sie das positive Ergebnis dieses Tages für das Entlebuch zusammenfasste
— und diesmal ohne jede historische oder andere Begründung,
frei, stolz und «absolut»:
«1. Sie wollen den Rat von Luzern nicht mehr als Obrigkeit anerkennen,
noch demselben gehorsam und unterthänig sein, sondern
demselben, wie die Stadt Sempach, nur noch eine Schirmherrschaft
zugestehen.
2. Sie dulden keinen Landvogt mehr.
3. Die Entlebucher seien bereit, die Stadt Luzern in Schutz und
Schirm zu nehmen und mit ihr einen neuen Vertrag abzuschliessen.
4. Alle Gülten und Zinsbriefe auf dem Lande sollen quitt sein,
wenn es sich bestätigt, dass man Entlebuch den Bernern preisgeben
wollte, mit Ausnahme derjenigen der Stifte, Gotteshäuser, Geistlichen
und Bürger.
5. Das Manifest von Baden soll widerrufen werden.
6. Die Regierung soll ihnen die Kosten vergüten, die seit 19. März
ergangen sind.
Bis am 22. sollte die Rückantwort Luzerns erfolgen.»
Und — was der grossartigen Autonomie dieses zweiten Ultimatums
die Krone aufsetzt — diese Forderungen erhoben die Entlebucher nicht
mehr auf Grund irgendwelcher historisch-juristischer Urkunden- oder
Akten-Beweise. Vielmehr, «wie Leutpriester Byslig und Chorherr Wilhelm
Pfyffer am 20. Mai vor dem Rate und den Gesandten der vier
katholischen Orte referierten», behaupteten die Entlebucher am 18.
Mai ausdrücklich, «dass sie ,nach göttlichem Recht' zu diesen Forderungen
berechtigt seien»! Das aber war in der Sprache der Zeit und der
Bauern genau das, was einzelne erleuchtete und verfolgte philosophische
Köpfe wie Descartes bereits in jener Zeit, die Welt allgemein jedoch
erst ein Jahrhundert später, kurz vor der französischen Revolution,
als das «Naturrecht der Vernunft» erkannt haben...
Noch einmal tritt an diesem denkwürdigen Tag in Schüpfheim, am
18. Mai 1653, das freie und stolze Bauerntum — in den Gestalten Hans
Emmeneggers und seiner wie ein Block um ihn geschlossenen Entlebucher
Genossen — in seiner ganzen Grossartigkeit aus dem Hintergrund
einer mächtigen Vergangenheit hervor, um sogar den Todfeind
der Gegenwart «in Schutz und Schirm» zu nehmen. Vor allem aber, um
seinen Klassengenossen in aller Welt zu zeigen, wie man auch mit den
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 419 - arpa Themen Projekte
entschlossenen Rechtlichkeit, der natürlichen Intelligenz und der klassenmässig
geschlossenen Solidarität über die unrechtmässig aufgeworfene
Gewaltherrschaft einer kleinen Minderheit hätte sie gen können, über
eine Herrenklasse, deren Waffen die wirtschaftliche Ausbeutung und
der demagogische Betrug waren. Sie nahmen dabei sogar, auch hier zuletzt
noch, die Bürgerklasse von den gegen die Herrenklasse verhängten
wirtschaftlichen Sanktionen aus. Aber auch das grossartige Beispiel
dieser Handvoll Bauern vermochte das Morgenrot einer neuen Zeit
nicht mehr herbeizuzwingen — weil dieses Beispiel nur isoliert im
hintersten Entlebuch, nicht mehr in der ganzen schweizerischen
Bauernklasse und erst recht nicht in der Bürgerklasse der damaligen
«Eidgenossenschaft» wirksam zu werden vermochte...
Inzwischen hatte sich der Luzerner Rat fieberhaft nach militärischer
Hilfe umgetan; nicht nur bei den IV Orten (schon am 14.) und
bei den andern eidgenössischen Ständen, die er alle unausgesetzt «um
bundesgemässen Beisprung» anflehte; vielmehr, wie wir sahen, auch
bei ausländischen Mächten. So beim Papst; so auch beim spanischen
Gouverneur von Mailand, dem Marchese di Caracena, von dem der
Luzerner Rat «gemäss dem Vertrage mit Spanien» 200 Reiter und 300
Mann zu Fuss verlangte. Dieser war aber so bereitwillig, dass er sich
von sich aus sogar zur Entsendung einer doppelten Anzahl von Mannschaften,
nämlich von «1000 Reitern», anerbot.
Am 16. Mai, unter dem Eindruck der «äusserst schlimmen Nachrichten»
über die stolze Abweisung der geistlichen Gesandtschaft am 15.
seitens der Entlebucher und über deren erstes Ultimatum, schritt man
in Luzern zur Wahl des Oberkommandanten. «Luzern hatte», wie
Peter berichtet, «auf der zweiten Badener Tagsatzung in der Frage der
Wahl des Oberkommandanten freie Hand bekommen. Der Gegensatz
der französischen und der spanischen Partei im Luzerner Rate und
wohl auch die Erwägung, die Truppen der IV Orte würden einem Kommandanten
aus einem neutralen Orte am meisten Ergebenheit beweisen,
bewirkten», dass man Sebastian Bilgerim Zwyer statt den Luzerner
Eustachius von Sonnenberg wählte, den der Luzerner Lokalpatriotismus
gern an der Spitze gesehen hätte. Zweifellos war Zwyer
der gegebene Mann für den Posten eines Generals der Luzerner Herrentruppen.
«An Kriegsruhm stand damals kein Eidgenosse katholischer
Konfession höher», sagt Liebenau. Nur war Zwyer eben auf der
Reise nach Augsburg zum Kaiser begriffen, dessen erster Agent in der
Schweiz der österreichische Feldmarschall-Lieutenant ja war. Seine
Ernennung erreichte ihn auf der Hinreise in Konstanz, zugleich mit
einem flehentlichen Schreiben des Luzerner Rats, «zu Ehren Gottes,
dem allgemeinen lieben Vaterlande zu Liebe und der ganzen Posterität
zu einer Wohltat» doch ja seine Reise zu verschieben. Doch Zwyer
schrieb von Konstanz aus am 19. an den Rat, <dass er alles tun werde,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 420 - arpa Themen Projekte
die Reise sei nun einmal nötig» (also noch nötiger als die «Rettung
des Vaterlandes»!); «er werde aber beförderlich zurückkehren.» (Er
kam erst Anfang Juni wieder.) Selbst Liebenau kann sich nicht enthalten,
dazu zu bemerken: «So hatte Luzern zwar einen tüchtigen
Oberbefehlshaber, der aber zur Zeit der grössten Gefahr noch seine
Privatgeschäfts im Auslande besorgte.»
Doch wir können zu Zwyers Ehre begründetermassen annehmen,
dass es nicht lediglich «Privatgeschäfts» waren, um deretwillen er das
«Vaterland» und die «Freiheit» hintansetzte. Vielmehr sind es vermutlich
sehr wichtige Obliegenheiten seines Pflichtenkreises als oberster
Agent des Kaisers in der Schweiz gewesen, die ihn dazu zwangen, da
seine und vieler anderer Schweizer Herren Macht- und Einkommensquelle
die Erfüllung dieser Pflichten war. Da gab es nämlich — was
Liebenau entgangen sein mag — gerade in diesem Augenblick einen so
dringlichen Grund zu «Staatsgeschäften» wie den, von dem der Nuntius
nach Rom berichtete: dass über das Hülfsgesuch Luzerns an den
spanischen Statthalter in Mailand im Luzerner «geheimen Rat» selbst
ein Zwist ausgebrochen war; denn «die Kunde von militärischen Rüstungen,
die der Erzherzog in Innsbruck an der Grenze angeordnet,
verursachte solchen Argwohn und solche Niedergeschlagenheit, dass
man davor zurückschreckte, sich gänzlich den Spaniern anzuvertrauen».
Es scheint also, dass man selbst unter den so willigen Pensionennehmern
des Hauses Habsburg fürchtete, dieses könnte die abgründige
Verlegenheit der Schweizer bezw. Luzerner Herren dazu benutzen,
seine Hausmacht in der Schweiz wiederherzustellen und eben dies als
Preis für den den Herren geleisteten Dienst fordern! Und Luzern selbst
war ja einmal habsburgischer Hausbesitz gewesen und hatte sich nur auf
revolutionärem Wege daraus befreien können... (Das waren eben
noch nicht Pensionenempfänger gewesen!) So mag es denn sein, dass
Zwyer mit einer Geheimmission über diese brenzliche Angelegenheit
betraut war und zum Kaiser reisen musste — denn das gehörte nun
wirklich in seinen engsten Aufgabenkreis als erster Agent des Kaisers...
An seinen Freund Dulliker schrieb Zwyer noch besonders und riet
ihm, «im Notfalle das Werk mit Ernst anzugreifen, damit man nicht
Schimpf aufhebe». Er machte Dulliker damit gewissermassen zu seinem
Stellvertreter, und gab ihm dabei noch die strategisch wichtige
Anweisung, «man müsse sorgen, dass die Last und der Bauern Furia
nicht auf einen Ort falle»! In der Tat ist dann die Katastrophe der
Bauern, rein militärisch gesehen, deshalb eingetreten, weil diese ihre,
zusammengenommen, erdrückende Macht auf viele, weit auseinanderliegende
Orte verzettelten und zwischen diesen Orten rat- und sinnlos
hin- und herliefen. Denn ein Stratege war kein einziger der Bauernführer,
weder Leuenberger, noch Emmenegger, noch gar ein Schybi.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn sich weniger nervöse Herren
als die Luzerner Gernegrosse «vermittelst göttlicher Hilf eines guten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 421 - arpa Themen Projekte
«da es den Aufrührern an Oberhauptleuten und anderen guten
Beamteten, wie auch Munition, Proviant und Geld sehr mangelt», wie
der Schaffhauser Bürgermeister Ziegler am 17. Mai an Waser schrieb.
Einstweilen liess Dulliker am 19. Mai, nach der schmälichen
diplomatischen Niederlage der grossen Regierungsdelegation in Schüpfheim,
sämtliche Verteidigungsanlagen der Stadt Luzern eiligst instandsetzen.
«Es war dies umso notwendiger, weil bereits am 19. Mai die
ganze Grafschaft Rothenburg in Waffen stand.» «Auf das Ansuchen
des Rates von Luzern vom 20. Mai bewilligte Zürich», wie Liebenau berichtet,
«schon am 21. Mai Hilfe und die Zufuhr von 1000 Stück Getreide»
(?soll wohl heissen: 1000 Mütt; welche übrigens, wie Peter
meldet, «bereits auf einem grossen Umwege transportiert und auf dem
See in die Stadt Luzern geführt werden mussten»), «mahnte Bern um
Hilfe und berief die Kommandanten der von den eidgenössischen Orten
aufzustellenden Armee auf den 26. Mai nach Basel. Jetzt wurde
auch das von der Tagsatzung in Baden am 8. Mai erlassene Manifest
gedruckt und am 20. Mai publiziert.» Die verhängnisvolle Wirkung dieses
zweiten Schimpfmanifestes des Herrenbundes gegen den Bauernbund
werden wir kennen lernen, sobald wir den Verlauf der Berner
Ereignisse bis zu diesem Zeitpunkt aufgeholt haben werden. Einstweilen
verzeichnen wir nur die Nachricht Liebenaus: «Die Publikation
dieses Mandates tadelte der Rat von Zug den 20. Mai, weil dadurch die
Friedensverhandlungen erschwert würden.» Das hatten zweifellos der
Mut und die Volkskenntnis des «Händelstifters» Peter Trinkler bewirkt.
Die Publikation dieses Manifestes war eine ausgesprochene Kriegsmassnahme:
sie trat genau in dem Augenblick in die Lücke, als sowohl
die Luzerner wie die Berner Regierung ein Ultimatum der Bauern zu
beantworten hatten! Das der Entlebucher war am 18. gestellt und lief
am 22. ab; das der Berner aber, am 17. gestellt, lief bereits am Tage
der Veröffentlichung des Manifestes selbst, am 20., ab. Darum erfolgte
der allgemeine kriegerische Aufbruch der Berner Bauern früher als
der der Luzerner, obschon hier die Entlebucher bereits am 15. einen
entschlossenen Auszug zur Besetzung der Brücken bei Sins und Gislikon
getan hatten. Aber die Entlebucher hatten sich ja am 18. in Schüpfheim
durch die geistlichen Spürhunde Caraffas zu einer Fristerstreckung
ihres Ultimatums bis zum 22. übertölpeln lassen. Das erwies sich
jetzt als kapitalen Fehler: es war ein Bleiklumpen, den die Herrenpfaffen
ihnen ans Bein gebunden hatten! Denn die Entlebucher fühlten
sich an diese Frist gebunden und wenn die Entlebucher nicht marschierten,
so marschierten die andern Aemter auch nicht.
Noch dazu boten am 20. Mai das Entlebuch und Willisau ihre aktivsten
revolutionären Streitkräfte, die auf den Kampf brannten, auf,
um am 21. unter Führung des Pannermeisters Emmenegger selbst und
Schybis ins Bernerland abzumarschieren, wo an diesem Tag der Landsturm
erging. Das war die wörtliche Erfüllung der Bundespflicht und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 422 - arpa Themen Projekte
und Leuenberger verabredet worden, zu der Emmenegger am 19.
nach Schönholz gereist war. Es scheint bei den Entlebuchern sogar der
Plan bestanden zu haben, überhaupt zuerst mit vereinter Kraft Bern
zu bezwingen, um erst dann mit ebenso vereinter Kraft Luzern einzunehmen.
Das war ein kühner und richtiger Gedanke, wie wir schon
aus Zwyers strategischem Rat an Dulliker entnehmen können. Aber er
war nur sinnvoll, wenn man ihn entschlossen und einmütig und mit
ganzer Kraft sofort durchführte. Die Entschlossenheit fehlte in katastrophalem
Masse beim massgeblichen Obmann Leuenberger, der in
bernischen Dingen noch besonders massgeblich war; und um die ganze
Kraft des Bundes einzusetzen, war die Schar von allerdings ausgewählten
400 Entlebuchern und 300 Willisauern doch wohl zu gering; wenn
auch Leuenbergers Armee von 20000 Bauern bei tatkräftigem Zielbewusstsein
in der Führung vielleicht für sich allein schon zur Erreichung
des Ziels genügt hätte.
Wenn so also, vor allem wegen Leuenbergers gewaltigen Fehlern,
die er vor Bern beging — deren Erkenntnis uns erst das nächste Kapitel
bringen kann —, der Zweck in Bern nicht erreicht wurde, so war
andererseits die Entblössung des Luzernischen vom Kern der entschlossensten
Streiter, an der Spitze Hans Emmeneggers selbst, angesichts
der unmittelbar bevorstehenden Entscheidungen ein Aderlass, der nicht
wiedergutzumachen war. Jetzt fehlten während den entscheidenden
Tagen im Luzernischen die entscheidenden Männer! Und das hätte nur
durch einen raschen, siegreichen Schlag im Bernischen ausgeglichen
werden können, der es ermöglicht hätte, sich unverzüglich vereint mit
einem gleichen Schlag gegen Luzern zu wenden, — wenn sich die
Entlebucher, aus Achtung vor den Fristen, nicht schon vorher dazu
entschliessen konnten, an der Spitze der zehn luzernischen Aemter
allein und auf eigene Faust das jämmerlich sich windende Luzern in
die Gewalt zu bringen, was unmittelbar nach dem Tag zu Schüpfheim
noch ein leichtes Spiel für sie gewesen wäre...
Aber, wie Peter nach einem Bericht Caraffas erzählt: «So brachen
unter den luzernischen Bauernführern Meinungsverschiedenheiten über
das Vorgehen aus: Die einen wollten sich der Stadt mit List bemächtigen;
andere zuerst den Bernern zuziehen, um nachher gemeinsam mit
diesen gegen Luzern vorzugehen. Dieser letztere Vorschlag drang zum
Vorteil der bedrohten Regierung nicht durch; der erstere wurde zwar
versucht: Eine grosse Anzahl der aufständischen Untertanen veranstaltete
eine Prozession; ,Kreuze vor sich hertragend', wollten sie in die
Stadt hineingehen, indem sie ,eine Andachtsveranstaltung' vorschützten,
um vom Himmel eine günstige Ernte zu erflehen, wie dies tatsächlich
ihrer Sitte entsprach. Die Tore wurden ihnen aber, da man
ihnen nichts Gutes zutraute, nicht geöffnet und so ihr Vorhaben vereitelt.
» Es muss zwar aus guten Gründen bezweifelt werden, ob dies
wirklich ein Versuch war, sich der Stadt mit List zu bemächtigen und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 423 - arpa Themen Projekte
Tagen höchst verängstigten Luzerner Herren. Es waren nämlich nicht
«eine grosse Anzahl der aufständischen Untertanen», sondern, wie Liebenau
berichtet, nur «die Leute von Emmen», die am 21. Mai, wie
jedes Jahr in der sogenannten «Bittwoche», «nach Luzern kommen
wollten, um die seit ältesten Zeiten in der Hofkirche üblichen Gebete
zu verrichten». Und sie kamen nur «mit Kreuz und Fahnen» — dass
sie Waffen mit sich geführt hätten, weiss niemand zu berichten. Wenn
es aber ein solcher Versuch war, dann war er wahrlich ein schlechter
Ersatz für einen entscheidenden Sturm auf die Stadt und kein besserer
für die Entblössung des Landes von seinen entschlossensten Kräften,
die durch den Abmarsch Emmeneggers und Schybis mit den Entlebuchern
und Willisauern nach Bern am gleichen Tage stattfand.
Aber in der Zwischenzeit, am 20. Mai, als man im Entlebuch eben
für Bern aufmahnte, am selben Tag, als doch durch die Publikation
des Tagsatzungsmanifestes eigentlich bereits der Krieg an die Bauern.
erklärt und also auch die Ultimatumsfrist der Bauern vom 22. durch
die Herren abgebrochen worden war — da noch machten die schlauen
Luzerner Herren ein neues grosses, wiederum geistlich aufgezogenes
«Friedens»-Theater zurecht, zu dem einzigen Zweck, neuerdings Zeit
zu gewinnen. Sie versammelten Rät" und Burger in einer grossen Gemeinde»,
stellten die gesamte «Ehrengesandtschaft», die am 18. in
Schüpfheim gewesen war, mitsamt den vielen Abgeordneten der vier
katholischen Kantone, einschliesslich Peter Trinklers, vor sie und liessen
ihr durch die vier Geistlichen, die ebenfalls Mitglieder dieser Gesandtschaft
waren und die von den Bauern die Fristverlängerung für
das Ultimatum erzielt hatten, lang, breit und beweglich über Alles berichten.
Und dann heisst es über die Ergebnisse dieser «Gemeinde»
bei Liebenau: «Die Gemeinde Luzern beschloss; die streitigen Punkte
durch eidgenössische Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Die eidgenössischen
Abgeordneten (d. h. die der vier katholischen Orte) aber
wurden' ersucht, von dem Ergebnis der Verhandlungen (in Schüpfheim)
ihren Regierungen Kenntnis zu geben und dieselben zu bitten,
unverweilt Luzern Hilfe zu leisten., Die Gesandten mahnten die Entlebucher
(d. h. sie schrieben ihnen; denn Entlebucher waren natürlich
keine an dieser Gemeinde) gleichfalls, dem Spruche eines eidgenössischen
Schiedsgerichtes zuzustimmen und drohten, wenn die Entlebucher
Leute auf mahnen, so werden ihre 'Regierungen der Stadt Luzern zu
Hilfe ziehen. Bis am Sonntag, 25. Mai, sollte Entlebuch sich über die
Annahme eines Schiedsgerichtes' aussprechen.» Das war also ein neues
Ultimatum, und zwar ein von den Herren gestelltes, das dem alten
Ultimatum der Bauern unterschoben wurde, um diese drei Tage länger
über dessen Frist hinaus hinzuhalten!
Diese drei Tage nun, genau vom 22. bis zum 25. Mai, wurden von
den Herren zu einer grossangelegten Zersetzungsaktion ausgenützt. Und
zwar schoben sie dafür jetzt raffinierterweise die Bürgerschaft vor, der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 424 - arpa Themen Projekte
eingeräumt hatten. Als die Bürger aber merkten, dass sie von den Herren
gebraucht wurden, schraubten sie ihren Preis etwas höher hinauf.
«Am 21. Mai» nämlich — so berichtet Peter — «stellten einige Bürger
neue Forderungen auf, und es wurde den Bürgern namentlich das
Stimmrecht für die Wahl des Stadtschreibers zuerkannt. Jetzt waren
die Bürger zufriedengestellt»! «Endlich ist völlige Einigkeit zwischen
Rat und Bürgern hergestellt», schrieb der Nuntius Caraffa am 22. nach
Rom; und zwar wiederum «durch Vermittlung seiner Ehrwürden, des
Nuntius» selber. «Voller Freude darüber», fährt Peter fort, «gab der
Rat sofort Bericht an Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, war er doch
durch seine Nachgiebigkeit einer grossen Gefahr entronnen.»
Bevor wir in unserer Erzählung weiterfahren, sei hier eine Einschaltung
über das Worthalten der Luzerner Regierung erlaubt, weil
wir auf den Ausgang des «Bürgerhandels» später nicht mehr ausführlich
zurückkommen können. Peter merkt zu der eben zitierten Stelle
an: «Es scheint (!) aber, dass die Regierung von Luzern, als die Gefahr
von Seiten der Bauern vorüber war, nicht gewillt war, sich an die ,Regimentsänderung'
zu halten; denn sie wandte sich in dieser Frage um
Rat an Zürich und Bern, und aus der Antwort der beiden Städte» (am
10. Juli) «geht hervor, dass der Rat von Luzern mit der ,Exekution und
Werkstellung der neuen Regierungsform' noch zugewartet (!) hatte,
weswegen Bürgermeister, Schultheiss und Räte von Zürich und Bern
der Meinung Luzerns vollkommen beistimmten, sich wieder ,an die alte
Form zu halten'.» Und da gibt es noch Leute, die diesen Krieg nicht
für einen Klassenkrieg halten!
Kurz und gut, die derart «zufriedengestellte» Bürgerschaft wurde
nun vom Luzerner Rat — dem beflissenen Anschein nach ohne geringste
eigene Beteiligung — auf die Bauern losgelassen. Das bot einen
doppelten Vorteil: erstens dass die Bauern die Bürger, mit denen sie
sich verschworen hatten, noch immer als ihre Bundesgenossen betrachteten,
mit denen zu verhandeln es jetzt für sie umsomehr Sinn zu haben
schien, als deren Macht in der Stadt nun immerhin bedeutend erweitert
war; also konnte der Rat damit rechnen, dass die Bauern auf diesen
Köder zur Hinausschiebung der Ultimatumsfrist unbedingt anbeissen
würden. Zweitens aber konnte man eventuelle Zusagen, die die
Bürgerschafts-Vertreter den Bauern machten, später besser desavouieren,
ja, bei der von den Herren erhofften Entwicklung der Dinge,
gleichzeitig mit der Wiederentmachtung der Bürger ebenfalls ausradieren.
So kam es zur Einberufung einer Versammlung der Ausschüsse
aller zehn Aemter nach Malters just auf den 22. Mai, an dem das Ultimatum
der Entlebucher ablief und gerade als Hans Emmenegger, Christian
Schybi und zahlreiche andere Führer der Aemter Entlebuch und
Willisau mit ihrer Kriegsschar in Lützelflüh eingetroffen waren, um
Leuenberger zuzuziehen! Von Luzern waren zur Verhandlung zahlreiche
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 425 - arpa Themen Projekte
«Bürgerhandels», wie die beiden Brüder Nikolaus und Wilhelm Probstatt,
Melchior Rüttimann, Jakob Schürmann, Anton Marzell, Moriz
Kappeler u. a. m. Sie hatten aber auch zwei bei den Bauern im Ruf der
Bauernfreundlichkeit stehende Honoratioren des Standes Nidwalden
mitgebracht, den Statthalter Leu und Hans Blättler von Hergiswil;
diese sollten offensichtlich eine «eidgenössische Vermittlung» repräsentieren,
von einer Art, wie sie den Bauern sympathisch war.
Schliesslich war interessanterweise auch eine Frau aus Luzern
mitgekommen, die sich, wie Liebenau meldet, «zur Vermittlung des
Verkehrs zwischen den Bürgern und den Bauern verwenden liess»,
eine Rarität in diesen Zeitläuften! Dies umsomehr, als es sich um
Anna Bircher, aus dem «regierungsfähigen» Geschlecht dieses Namens,
handelt, von dem gleichzeitig mehrere Mitglieder in den Räten
sassen, davon eines, Nikolaus Bircher im Kleinen Rat, d. h. in der
Regierung, während der Grossrat Franz Bircher an der Bürgerverschwörung
teilnahm und dafür später auch hingerichtet worden ist.
Anna Bircher nun ist sogar, wie Liebenau berichtet, «wahrscheinlich
die älteste Tochter des Kleinrats Nikolaus Bircher» selbst und «spätere
Gemahlin des Hauptmanns Melchior Rüttimann», also des Hauptanführers
der Bürgerrebellen, der später ebenfalls zum Tod verurteilt
wurde und der jetzt mit Nikolaus Probstatt zusammen an der Spitze
der Bürgerdelegation in Malters stand. Anna Bircher soll, nach Liebenau,
«allen ihren Zeitgenossen weit vorauseilend», gesagt haben:
«Die Bauernsame hat gerade soviel Rechte als irgendein Stadtbürger»!
Und über den «Bürgerhandel» soll sie sich geäussert haben: «Beim ganzen
Handel spielen gewisse verborgene Sachen mit, die Gott allein
kennt.» Damit hat sie «vielleicht den Kampf der französischen und
spanischen Partei» gemeint, diesen endlosen Korruptionsskandal um
die Verteilung der fremden Fürstenpensionen, deren Geldstrom ja auch
die Bürger in ihre Taschen zu leiten strebten. Dies aber war einer der
Hauptgründe, warum die Bürgerschaft sich gar nicht ernstlich für die
Befreiung der Bauern einsetzen konnte, da deren möglichst hindernisloser
Verschleiss als Söldner an die fremden Fürsten — die umgekehrte
«Fremdenindustrie» jenes goldenen Zeitalters der Herren — die Voraussetzung
für die Pensionszahlungen war... Ferner soll Anna Bircher
gesagt haben: «Die Bauern haben niemals in die städtischen Sachen
sich einzumischen gesucht, obwohl sie oft dazu Gelegenheit hatten.»
Item, diese «kleine Anna Bircher, eine der angesehensten Patrizierinnen»,
scheint sich in der Tat durch einen aussergewöhnlich scharfen
politischen Blick und durch persönliche Zivilcourage ausgezeichnet zu
haben, was man von keinem einzigen der damaligen «Staatslenker»
Luzerns auch nur entfernt sagen kann.
Doch nun zu den «Friedensverhandlungen» in Malters. Sie sind in
einem besonders tragischen Sinne grundlegend für Alles, was danach
im Luzernischen noch folgte. Nicht nur erreichten die Herren damit
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 426 - arpa Themen Projekte
Hilfstruppen inzwischen in Luzern einmarschieren zu lassen;
— das allein hätte sie noch nicht gerettet, denn die Zahl der bewaffneten
Bauern betrug das Vielfache dieser Hilfstruppen. Vielmehr legten
diese «Friedensverhandlungen» zugleich den Grund zu der unheilvollen
inneren Verwirrung in den Bauernreihen selbst, die in der Folge zur
Spaltung und schliesslich zur Anarchisierung und Lähmung der an sich
gewaltigen, aber in den entscheidenden Augenblicken völlig rat- und
führerlosen Bauernmacht geführt hat. Dass die Bauern in Malters der
Führung ihrer besten Köpfe, der Entlebucher und Willisauer, ermangelten,
kann dabei nicht genug betont werden. Und dass dafür, nach
Liebenau, «das Haupt der Bauern in Malters» ausgerechnet Kaspar
Steiner war, der noch dazu «dem Trunke sehr ergeben und wohl kaum
für jedes seiner Worte haftbar» gewesen sein soll — das konnte das
Unheil nur umso sicherer auf die Bauern herabziehen...
Zwar scheinen diese gleich am ersten Tag, am 22., sehr offensiv
in die Verhandlungen eingetreten zu sein: sie schlugen der Bürgerschaft
vor, sofort in den Bauernbund einzutreten! Man erlebt an diesem Vorschlag
förmlich die edle Illusion der Bauern, die Bürger seien immer
noch, gemäss allen früheren Abreden, ihre berufenen Bundesgenossen.
«Allein einen Eintritt der Bürgerschaft in den Bund», sagt Liebenau,
«wollten die Bürger nie befürworten, weil sie sonst verloren wären.»
Das klingt sehr rätselhaft, ist es aber nicht. Denn mit Hülfe der Bauern
hatte die Bürgerschaft inzwischen, wie sie meinte, ihr Schäfchen ins
Trockene gebracht. Hatte sie, wie Liebenau meint, «die Herrschaft des
Patriziats so ziemlich vernichtet»? O nein! Sie hatte vielmehr nur ihre
Teilhaberschaft an den Privilegien des Patriziats errungen, oder glaubte,
sie errungen zu haben! Das aber bedeutete, dass die Bürgerschaft jetzt
hoffen durfte, endlich auch an die Hauptfutterkrippe der Herrenwirtschaft
im Landesinnern herangelassen zu werden: zu den Landvogteien!
Die landvogteiliche Ausbeutung der Bauern aber war nicht nur
eine der beiden Haupteinnahmequellen neben den Pensionen — sie war
zugleich das Herrschaftsinstrument, um die Lieferung der Söldner ins
Ausland, mithin die Haupteinnahmequelle im Ausland selbst, die Söldnerpensionen
an die Herren, im Fliessen zu halten. All das, und noch
viele andere Privilegien, wie beispielsweise das Zunftrecht auf dem
Lande, das jetzt erst, nach Zürcher Muster, eine Haupteinnahmequelle
für die Bürger zu werden versprach, wäre mit einem Eintritt derselben
in den Bund der Bauern dahingefallen. Sie konnten ja nicht zugleich
die Bundesgenossen der Bauern und deren Landvögte sein!
Darum ist es wohl zu glauben, dass die Bürgerführer in Malters,
wie Liebenau sagt, «wenig Lust zeigten, die Vogteien an die Bauern abzutreten»!
So demokratisch waren diese Stadtbürger noch lange nicht,
auch der künftige Gemahl der Anna Bircher, Melchior Rüttimann,
nicht; obschon sie noch am 16. Mai, als sie des Drucks der Bauern
zur Durchsetzung ihrer Kampfziele gegen die Ausschliesslichkeit des
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 427 - arpa Themen Projekte
und länderisch sein»! Entscheidend für sie war jetzt allein die bereits
am 14. erhobene Forderung: «alles sei eine Stadt, eine Bürgerschaft, in
einen Sockel falle alles»! Alles! Auch die Früchte des Schweisses und
Blutes der Bauern... «Dagegen liessen einzelne wohl durchblicken, sie
wollten den Bauern die Tore öffnen und ihnen bestimmte Ratsherren
ausliefern» — d. h. dazu wären ihnen die Bauern gut genug gewesen,
die Bürger noch schnell von den hartnäckigsten patrizischen Gegnern
und Konkurrenten in der Ausbeutung der Bauern zu befreien!
Der Schock der Enttäuschung über das Verhalten der Bürger
scheint bei vielen Ausgeschossenen der Bauern so heftig gewesen zu
sein, dass diese die Verhandlungen bereits am 23. Mai kurzerhand abbrechen
wollten. «Schon wollten die Bauern führer mit Glocken und
Feuerzeichen das Volk zum Aufbruch mahnen und den Landsturm gegen
die Stadt führen» — als die beiden Nidwaldner, Leu und Blättler,
intervenierten, «ihnen die Folgen eines solchen unheilvollen Unternehmens
nochmals vorstellten und dadurch die nochmalige Aufnahme der
Verhandlungen mit der Stadt erwirkten.» «Mit der Stadt» — d. h. es
war nun völlig klar, dass die Bürger keineswegs Rebellen gegen die
«Stadt», die Regierung, vielmehr ein Werkzeug der Regierung waren
und anstelle derselben handelten. Konsequenterweise scheinen die
Bauern sofort verlangt zu haben, dass unter diesen Umständen eine
Deputation der Regierung selbst nach Malters herauskomme, um Verbindliches
abzumachen. Wer sollte sie rufen gehen? Die Bürger jedenfalls
nicht, denn das hätte ja ihre Abdankung als Bevollmächtigte der
«Stadt» bedeutet. Da wurde zunächst — wahrscheinlich auf Vorschlag
der Nidwaldner — der Beschluss gefasst, Fridolin Bucher und der Däywiler
Bauer Hans Häller «sollen zu diesem Zweck sich in die Stadt verfügen».
Allein diese beiden senkrechten Willisauer erklärten, «sie wollen
sich eher in Stücke hauen lassen, als diesem Auftrag nachzukommen»!
So mussten die beiden Nidwaldner selbst in die Stadt eilen, um
«einen Ratsausschuss nach Malters zu bitten».
Während deren Abwesenheit beschlossen die Bauern, getreu der
Botschaft der Entlebucher an die Tagsatzung, «den Streit durch die
Landsgemeinde von Ob- und Nidwalden entscheiden zu lassen», mithin
nicht durch «Ehrengesandte», sondern durch das Volk selbst.
Als die beiden Nidwaldner mit dem Bescheid des Rates zurückkehrten,
«dass zu neuen Unterhandlungen eine Ratsbotschaft in Malters eintreffen
werde» und von dem neuen Beschluss der Versammlung hörten,
rieten diese Landsgemeinde-«Demokraten» heftig von diesem Beschluss
ab: «denn eine so wichtige Sache eigne sich nicht für eine Landsgemeinde
(!), wo Junge und Alte zu mehren haben, und noch viele minderjährige
Knaben (!) erscheinen, welche die Wichtigkeit der Sache
nicht erfassen und nach Notdurft erwägen können...» — kurz mit dem
ganzen Scheingründe-Plunder von Scheindemokraten, wie er immer im
Interesse der Herren vorgebracht wird. Aber «die Bauern erwiderten:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 428 - arpa Themen Projekte
Zahl der Landleute werde sicher den Beschwerden der Bauern abhelfen».
Immerhin brachten es die beiden Nidwaldner zu einer richtigen
Diversion, nämlich zu dem Kompromissbeschluss, «vorerst zu gewärtigen,
welche Rechtsame die Obrigkeit für jedes Amt aufzuweisen
habe, und dann je nach Umständen Gewalt zu brauchen». Die beiden
Laufbuben der Herren liefen mit diesem Bescheid abermals nach Luzern.
Auf ihrem Rückweg aber «begegnete ihnen zwischen Blatten und
Malters ein ,grosses Geschwader' der Bauern mit einer offenen Fahne,
teils mit Gewehren, teils mit Knütteln bewaffnet, fest entschlossen, gegen
die Stadt zu ziehen. Den Nidwaldnern gelang es nochmals, die
Bauern zur Umkehr nach Malters zu bewegen und den Entscheid über
die neuen Vorschläge zu gewärtigen»! Damit hatten diese verhängnisvollen
Nidwaldner eine weitere Spaltung der Bauern erreicht. Denn «als
die einen zum Vergleich mit Luzern geneigt waren, die andern aber den
Krieg fortsetzen wollten», kehrten viele von den Ausgeschossenen, trotz
der Beschwörung der Nidwaldner, «nicht von einander zu fallen»,
nicht zurück; viele hatten schon tagsüber die Versammlung verlassen
und waren zu den Waffen geeilt, und am Abend des 23. war diese Versammlung
bereits ein blosses Rumpf parlament der zehn Aemter, in
dem naturgemäss eher die Kapitulanten als die Revolutionäre sitzen geblieben
waren — ganz wie ehemals in Ruswil!
Und ganz wie damals, so ging auch jetzt, am Tag nach dem Ablauf
des Entlebucher Ultimatums, im ganzen Luzernerland ein spontaner
Landsturm los. Leider auch jetzt ohne jeden Oberbefehl, ohne
dass eine zentrale Leitung das Zeichen dazu gegeben hätte — und
darum planlos, anarchisch, ohne einen andern als instinktiven Zusammenhang.
Wie von selbst gingen in allen Dörfern die Sturmglocken
los, ein Geläute löste das andere aus. Bitter vermissten die in Malters
anwesenden Entlebucher und Willisauer ihre besten Führer, die mit
den beiden Fähnlein Leuenberger zugezogen waren. Darum beschlossen
sie am 23., Friedli Bucher als Eilboten nach Bern zu schicken, um die
Truppen von Entlebuch und Willisau unverzüglich heimzumahnen!
Sie gaben ihm, und zwar im Namen aller zehn Aemter, ein von diesem
Tag datiertes Schreiben an Hans Emmenegger mit, in welchem sie ihn,
trotz der kriegerischen Eile, ermahnten: «er solle bei der Verhandlung
mit Bern darauf dringen, dass die Regierung sagen müsse, wer (von
den Luzerner Herren) das Gesuch gestellt habe, mit den Truppen von
Bern durch das Entlebuch nach Werthenstein zu ziehen und alles zu
verderben». Sie wollten offenbar mit diesem «wer», und wenn es der
ganze Hat von Luzern gewesen wäre, blutig abrechnen!
Gleichfalls noch am 23. haben die Willisauer, wie Vock berichtet,
«durch Zuschrift an die Oltener die Bauern des Kantons Solothurn um
Zuzug ermahnt und sie zugleich ersucht, Stuck und Munition mitzubringen».
Am gleichen Tag, am 23. Mai, überfielen die Bauern von
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 429 - arpa Themen Projekte
höheren Befehl, das «schöne, dem Staate gehörige» Schloss Castelen,
das sie als eine Zwingburg der Luzerner Herren schon lange hassten
und machten es beinahe dem Erdboden gleich. «Die rasenden Bauern»,
erzählt Vock, «übten nun ihre Wut an dem herrschaftlichen Gebäude;
sie hoben das Dach ab, zerschlugen die Ziegel in tausend Stücke, rissen
vom alten Gemäuer, so viel sie konnten, zu Boden und trugen und
führten die Ruinen und Bruchstücke triumphierend im Lande herum».
Das war der «Sturm auf die Bastille» der Luzerner Bauern und gab
dem ganzen Land das Signal zur Erhebung. So kam es, da Alles auf
Luzern zu eilte, noch am 23. Mai zu einer — sicherlich ganz ungewollten
— «Konzentration der Truppen der Bauern an der Brücke von
Gislikon».
Inzwischen aber waren einige Hauptkontingente auswärtiger Hilfstruppen
der Luzerner Herren bereits in Luzern eingerückt, darunter die
am 20. von den Herrengesandten der vier katholischen Orte angedrohten,
ausser Unterwalden: zusammen immerhin an die 3200 Mann,
die zu der bereits vorhandenen Besatzung und zu der mobilisierten
Bürgerwehr hinzukamen. «Bereits am 22. Mai», berichtete der Nuntius
nach Rom, «rückten Truppen in Luzern ein». Das war ja der Zweck
der Uebung aller Diversionen der Herren, inbegriffen die «Friedensverhandlungen»
in Malters, gewesen. Die Herren waren nur wegen der
Landesabwesenheit ihres erwählten Oberkommandanten Zwyer in
Sorge, und zwar aus einem für sie ganz besonders charakteristischen
Grund. Derselbe Nuntius Caraffa verschmähte nicht, auch dies nach
Rom zu berichten: «Denn obwohl die Behörden über eine bedeutende
Zahl Soldaten verfügen und weitere erwartet werden, entbehren sie
eines Anführers, der die Führung eines Krieges versteht, welcher ohne
Verlust und Blutvergiessen vor sich gehen sollte; da nämlich der grösste
Teil der Bauern den Städtern grosse Summen schuldet, fürchtet man
die Guthaben zu verlieren...»! Man wollte doch nicht das Huhn
schlachten, das einem die goldenen Eier legt...
Am 23. wurde in Luzern auch der grosse Kriegsrat endgültig konstituiert.
Aus ihm wurde ein «engerer Kriegsrat» ausgeschossen, dem
von Luzernern Jost Pfyffer, der schneidige Landvogt von Willisau,
Venner Kaspar Pfyffer und Alphons von Sonnenberg angehörten; sowie
die beiden Urner Burkard zum Brunnen und Oberlieutenant Arnold
und die beiden Schwyzer Oberstwachtmeister Büeler und Landesfähnrich
Betschart; der Urner Karl Anton Püntiner sollte mit 150 Mann
nach Mellingen ziehen, offenbar um die Verbindung mit der in den
Freien Aemtern geplanten Konzentration der grossen Tagsatzungsarmee
herzustellen. Am 23. gelangten zwei dringende Hilfsgesuche der Berner
Herren nach Luzern; aber dieses musste antworten, «dass Luzern, weil
selbst bedroht, nicht Hilfe leisten könne».
«In der Nacht vom 23./24. Mai hatten die Luzerner die Schwelle
(der Reuss) geöffnet; mächtig strömten die Wogen der Reuss gegen die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 430 - arpa Themen Projekte
Nun «suchten die Luzerner durch kleine Ausfälle die Bauern
zu erschrecken und von der Belagerung der Stadt abzuhalten. Einen
solchen Ausfall machten die Luzerner am 24. Mai gegen Rothenburg.
Sofort wurden alle Aemter gegen Rothenburg zu Hilfe gemahnt.» Am
gleichen Tag mahnte Sebastian Steiner im Namen des Amtes Rothenburg
«in II in II, — in II» die «Herren zu Willisau und Bundesbrüder»:
«Wir wollen zu Sursee Stuck und Munition, alles, mit uns
nehmen; denn wir sind der Sachen gar mangelhaft und vonnöthen,
Stein und Pulver; und wollet nichts dahinten lassen...»
Kurzum: trotz der vollkommenen Abwesenheit irgendwelcher bemerkbaren
Führung bei den Bauern, einfach durch die natürliche
Gravitation aller Kräfte gegen die Hauptstadt hin, kam innert kürzester
Frist doch so etwas wie eine Belagerung der Stadt Luzern zustande.
Wir geben hier den Bericht Vocks darüber wieder, der vielleicht
den Stand der Dinge, wie er etwa am 24. und 25. Mai, teilweise
auch noch etwas später, zustandekam, beschreibt und der nach den
zeitgenössischen Herrenchronisten Cysat-Wagenmann und Zurgilgen
gearbeitet ist. Vock schreibt: «Im Kanton Luzern war beinahe die
sämtliche waffenfähige Mannschaft in's Feld gezogen, und die Gegenden
um Luzern bis hinab zur Brücke von Gislikon wimmelten von
Kriegsscharen. Da die Bauern bei ihrer Ankunft vor Luzern den untern
Gütsch, den sie während der Belagerung im März inne gehabt hatten,
schon durch die Truppen der Stadt besetzt fanden, nahmen die Entlebucher
ihre Stellung auf dem obern Gütsch, fast eine halbe Stunde von
der Stadt; die beiden Seiten dieser Anhöhe waren durch eine Abteilung
der Truppen aus dem Amte Willisau besetzt; die andere Abteilung derselben
war nach der Gisliker Brücke gezogen. Die aus dem Amte Russwil
lagen in der Ebene und bewachten die Strassen. Die Rothenburger
hielten die Emmenbrücke und das linke Ufer der Reuss bis weit hinab
besetzt. Die Stadt Luzern hatte ihre Wachposten bis zum rechten Ufer
der Reuss vorgeschoben, die Bewohner des Amtes Ebikon entwaffnet,
und mehrere der dortigen Aufrührer gefangen genommen.»
Während aber sogut wie das gesamte Luzerner Volk in solch
grossartiger und zugleich erschütternder, weil führungsloser Einmütigkeit
aufstand, blieb wahrhaftig das Rumpf parlament der Ausschüsse der
zehn Aemter ruhig in Malters sitzen und führte «Verhandlungen» —
mit wem von der andern Seite, wissen wir nicht. Dies allein schon
zeigt eindeutig, wer das war, die da zusammenblieben — bis und mit
dem 25., ja vermutlich auch noch am 26. Mai. Denn an diesem Tag erfolgte
ein Beschluss, der nur von diesem Rumpfparlament gefasst worden
sein kann. Vermutlich hatte eben die klare Entscheidung der
Volksmehrheit für den Krieg die Kapitulanten umso sitzfester und hartnäckiger
gemacht in ihrem Bestreben, der Verantwortung und der Gefahr
durch ein Abkommen mit den Herren zu entrinnen. Die innere
Spaltung vom 23. erwies sich als unheilbar; sie brach vielleicht schon
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 431 - arpa Themen Projekte
so weit es die hier besonders verwehten Spuren der Geschichte noch
festzustellen erlauben — etwa folgendermassen.
Vielleicht bereits am 25., sicher am 26. Mai kehrten die 700 Entlebucher
und Willisauer, die Leuenberger am 21. zugezogen waren, in
Eilmärschen über das Gebirge zurück und stürmten Luzern zu. Friedli
Bucher, der am 23. von der Kriegspartei in Malters abgeordnet worden
war, sie heimzumahnen, muss sie am 24. noch in Leuenbergers Lager
vor Bern angetroffen haben, oder vielmehr — da Leuenberger sie aus
Angst vor ihrem revolutionierenden Einfluss auf seine Truppen vom
eigentlichen Lager derselben fernzuhalten suchte — in dessen weiterer
Umgebung, in Habstetten und am Bantiger. War schon dies eine bittere
Erfahrung für sie, so waren sie alle am 24. Mai noch an Ort und
Stelle Zeugen einer niederschmetternden Tatsache gewesen: Leuenberger
machte an diesem Tag, ohne gekämpft zu haben, auf dem Murifeld
seinen ersten, vorläufigen «Frieden» mit den Herren von Bern,
und dies zwar ohne weder sie, die Luzerner, noch die anderen Bundesgenossen
in den Frieden mit einzuschliessen oder auch nur zu befragen!
Noch dazu enthielt dieser «Frieden» die ausdrückliche Bedingung der
—Abschwörung des Huttwiler Bundes! Wie es dazu kommen konnte,
kann uns erst die Geschichte Leuenbergers und der Berner Vorgänge
dieser Tage im nächsten Kapitel begreiflich machen.
Jedenfalls also kam diese Kampfelite der Entlebucher und Willisauer
mit schweren Erfahrungen belastet zurück. Wohl mag das sie
selbst dazu getrieben haben, sich umso erbitterter in den heimatlichen
Kampf zu stürzen, als sie sich einmal mehr allein auf ihre eigene Kraft
angewiesen sahen. Die Tatsachen jedoch, deren frische Kunde sie mit
nachhause brachten, waren geeignet, allen Kapitulanten im Luzernischen
einen starken und vielleicht entscheidenden Auftrieb zum raschen
Handeln in ihrem Sinne zu geben. Darin konnten die Kapitulanten
durch den Umstand nur bestärkt werden, dass die 700 Luzerner bei
ihrer Rückkehr auch von einigen Hundert Berner Bauern begleitet
wurden. Denn diese können — da das übrige Berner Bauernheer noch
bis zum Abschluss des definitiven Murifeld-Friedens, bis zum 28. bezw.
29. Mai, vor Bern liegen blieb — nicht gut andere, als von Leuenbergers
Politik enttäuschte, dafür mit derjenigen der Entlebucher sich solidarisierende
Truppen gewesen sein. Sie waren auch nicht etwa von Leuenberger
selbst abgeordnete Hilfstruppen; denn dieser hat wenige Tage
danach, als ihm die Berner Herren daraus einen Bruch des Murifeld-Friedens
machen wollten, energisch abgeleugnet, etwas mit dem Zuzug
nach Luzern zu tun zu haben. Nein, es waren enttäuschte Revolutionäre,
die ihre Pläne im Bernischen durch Leuenberger wenn nicht
verraten, so doch durchkreuzt glaubten und die eben deshalb mit den
Entlebuchern ins Luzernische zogen. Dort werden gerade sie mit ihrer
Erbitterung über den Lauf der Dinge zuhause am wenigsten zurückgehalten
haben. Und eben dadurch konnten sie den luzernischen Kapitulanten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 432 - arpa Themen Projekte
Der Kampf an der Gisikoner Brücke am 5. Juni 1653
(Letzte Kriegstat Schybis.)
Volkstümliche Darstellung aus dem Schweizerischen Bilderkalender
des Jahres 1840 von Martin Disteli.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 432 - arpa Themen Projekte
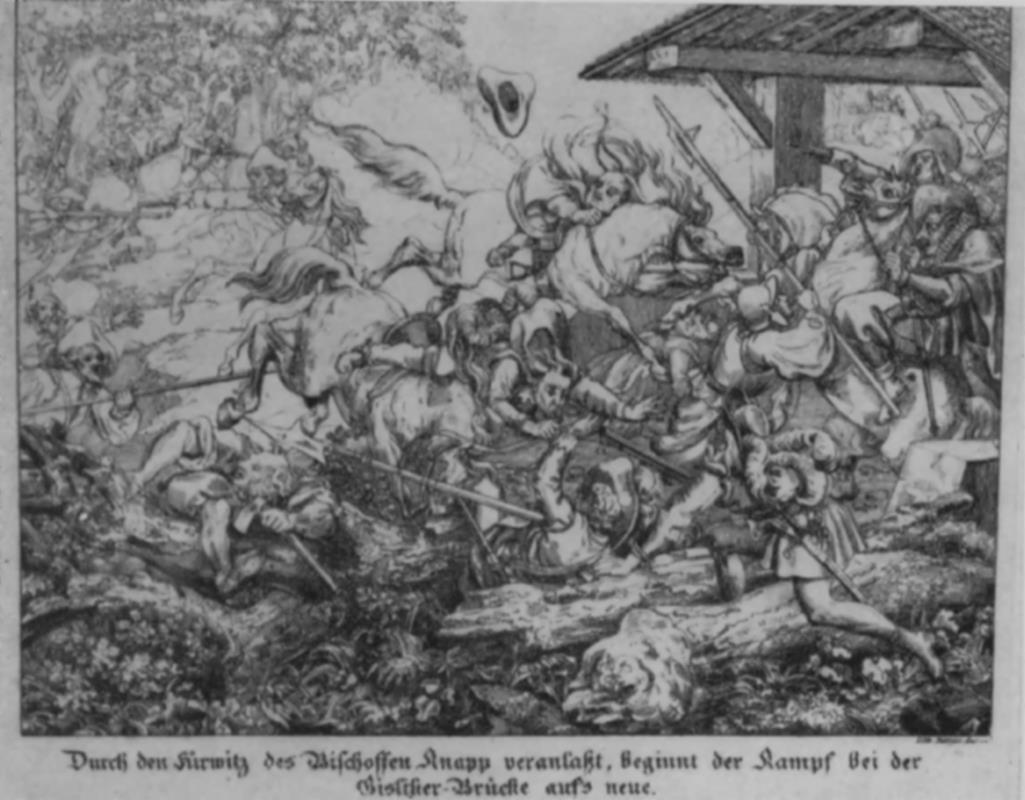
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 433 - arpa Themen Projekte
erst recht den Stoff liefern, der für diese ein Argument zum
entscheidenden Eingreifen abgab.
Diese von Bern zurückgekehrte Kriegsschar nun platzte auf ihrem
Eilmarsch nach Luzern mitten in das Rumpfparlament der Ausschüsse
in Malters. Die Wirkung muss «schlagartig» gewesen sein. «Noch tagten
am 25. Mai», berichtet Liebenau, «die Ausschüsse der zehn Aemter in
Malters. Als aber die Entlebucher eintrafen, schien der Ausgleich unmöglich.
Denn diese erklärten, von Luzern sei doch nichts zu erwarten...»
An einer andern Stelle: «Als die Entlebucher in Malters eintrafen,
begann der Krieg in der gehässigsten Weise!» Man ahnt: die
Entlebucher wollten eine Kapitulation wie die Leuenbergers verhindern.
Dabei aber wollten sie, «wie die Berner, mit der Obrigkeit nur
auf freiem Felde verhandeln» (wenn auch gewiss anders als Leuenberger!).
Hans Emmenegger, von dem man in diesen Tagen sogut wie nichts
erfährt, muss ebenfalls erst mit seinen Truppen in Malters eingetroffen
sein, selbst wenn er bereits etwas früher aus dem Bernischen ins Entlebuch
heimgekehrt sein sollte. Denn noch am 26. Mai versahen die
«Hauptleute und Kriegsräte der X Aemter» einen Brief aus dem Lager
vor Luzern «an den Herrn Obmann Leuenberger im Bernbiet bei dem
Kriegsvolk zu erfragen» mit dem ausdrücklichen Vermerk in der
Adresse: «wie auch von Unserm um. Lieutenant Joh. Emmenegger, so
er noch vorhanden ist, zu eröffnen». Emmenegger kann daher frühsten. s
am 25., mit Sicherheit erst am 26. Mai, in Malters gewesen sein,
und davon waren die Hauptleute im Lager vor Luzern nur noch nicht
unterrichtet, als sie am gleichen Tag den eben erwähnten Brief schrieben.
Zu diesem Zeitpunkt allein konnte sich also in Malters eine Szene
abspielen, in der Emmenegger auftritt und die Liebenau, unbekümmert
um dessen Abwesenheit im Bernischen, schon zu Beginn der Verhandlungen
in Malters berichtet. Diese Szene zeigt uns Hans Emmenegger
—als fast einzige Nachricht über ihn in dieser Krise —in seiner ganzen
geistigen Ueberlegenheit sowohl über die Mehrzahl der illusionsfreudigen
Bauern, die über ihre Rechte mit den Bürgern glaubten verhandeln
zu können, wie über die Bürgerführer, die vom vermeintlichen Besitz
ihrer neuen Macht verblendet waren. Diese scheinen sich auch an Emmenegger
herangemacht zu haben, um ihn zu Verhandlungen mit
ihnen zu verlocken. Aber Liebenau berichtet: «Als Anton Marzell sich
brüstete, die Luzerner haben jetzt schon so grosse Freiheiten, bemerkte
ihm der Pannermeister Emmenegger: ich gäbe euch um diese Errungenschaften
doch nichts zu trinken; solange ihr nicht die Kleinen Röte
selbst wählen könnet, hat alles nichts zu bedeuten»! Das war denn zugleich
auch die richtige Antwort an die anwesenden bäuerlichen Kapitulanten
über die Zwecklosigkeit weiterer «Verhandlungen» mit den
Bürgern. «Am 26. Mai zogen die Bauern von Willisau und Entlebuch
gegen Kriens und besetzten den oberen Gütsch.»
Es war wohl bestimmt das entschlossene Eingreifen der von Bern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 434 - arpa Themen Projekte
Hans Emmeneggers persönlich, was auf dem Durchzug zur Belagerung
von Luzern das Rumpfparlament der zehn Aemter in Malters
sprengte. Aber sie kamen — durch den, ausserdem zwecklos gewordenen.
Zuzug nach Bern um die entscheidenden Tage betrogen — in jeder
Hinsicht zu spät: militärisch, diplomatisch und volkspsychologisch.
Noch am Tag ihrer Ankunft im Lager der Bauern vor Luzern
hatten die dort kommandierenden Hauptleute und Kriegsräte der
X Aemter in guten Treuen an Leuenberger jenen Brief abgefertigt, der
auch an den immer noch in Bern vermuteten Emmenegger gerichtet
war. Es war ein Hilfsgesuch: «Ihr wolltet uns mit Kriegsvolk behelfen
sein, etwa mit 10000 Mann, oder so viel Euch je möglich ist; denn wir
es vonnöthen sind, weil wir in grosser Weite belagern müssen, und
wenn Ihr uns den Mehrtheil Musquetiere schicktet, wäre es uns sehr
lieb und angenehm, und sobald und geschwind als es Euch möglich
ist.. . so hätten wir die Hoffnung, wir könnten in kurzer Zeit mit unserer
Oberkeit wohl abschaffen (!) . Dessgleichen wollen wir (dann)
auch gegen Euch gewiss thun (!)...» Nun kamen statt dessen nur die
700 Entlebucher und Willisauer und einige Hundert Berner — und
mit diesem Tropfen auf den heissen Stein zugleich die lähmende Kunde:
dass es Leuenberger keineswegs auf die «Abschaffung» der Obrigkeit
abgesehen habe, dass er vielmehr mit dieser einen faulen Frieden
machen wolle, in dem sogar der grosse Bund abgeschworen werden
sollte! Damit brach auch die Hoffnung auf die «10000 Mann» Zuzug
augenblicklich zusammen...
Am gleichen Tag noch kam nun der in Malters ausgebrütete Verrat
der Kapitulanten als Dolchstoss in den Rücken der Kriegspartei zur
Ausführung. Die Kapitulanten waren jetzt ja völlig unter sich, da auch
die letzten überhaupt noch Kampfwilligen, die dort gesessen hatten,
durch die Entschlossenheit der Entlebucher naturgemäss mit fort, ins
Bauernlager vor Luzern, gerissen worden waren. Das machte die Gefahr
für die Kapitulanten im Fall eines Sieges der Bauern unmittelbar
akut. Schon im Rücken der Abziehenden schlossen Ausgeschossene aus
sieben Aemtern sich eiligst zur Tat zusammen: durch einen Landvogt
(!) namens Ostertag, liessen sie beim Luzerner Rat (!) «das Ersuchen
um Abschluss eines Waffenstillstandes stellen; sie verlangten
Entscheid der Streitigkeiten durch eidgenössische Schiedsrichter in
Stans» — das war die Einflüsterung des Nidwaldner Statthalters Leu -—,
sowie, zur Wahrung des Gesichts, die «Auflegung der Urkunden durch
den Rat». «Schon am 26. Mai begann der Schriftenwechsel wegen der
neuen Verhandlungen in Stans, indem Rothenburg» (das Amt Kaspar
Steiners!) «12 Artikel aufstellte» und der Rat von Luzern — das war
seine erste Sorge, weil das den Geldsäckel betraf — «die Gründe angab,
warum das Gesuch um Schadenersatz abgelehnt werden müsse»...
Unverzüglich auch «erliess der Rat von Luzern am 26. Mai ein Manifest,
das Allen Schutz versprach, die vom Aufstande sich abwenden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 435 - arpa Themen Projekte
vielleicht nur geheime und mündliche — Bedingung der Kapitulanten
gewesen sein...
An diesem gleichen traurigen 26. Mai begann das anonyme Bauernvolk
weit draussen auf dem Lande, wohin noch keine Kunde von alledem
gedrungen war, den eigentlichen Krieg; wiederum völlig spontan,
ohne Befehl und Plan von irgendeiner Leitung her. Denn «die Bauern
suchten nun die Sache rasch zu beenden». Im Norden des Kantons
stürmten die Bauern von Knutwil das «schöne Schloss Wykon» und
machten zwei Kanonen «und einige Doppelhaken» zur heissersehnten
Beute. «Weil der Rat von Sursee das abgeforderte Geschütz nicht freiwillig
ausliefern wollte, so zog eine Kriegsschar» — es waren «Bauern
von Willisau und Knutwil» — «am 26. Mai in diese Stadt.» «5 Kanonen,
453 Pfund Pulver, 25 Feuerseile und 130 Pfund Kugeln wurden den
Bauern ausgeliefert, gegen Verschreibung, dieselben nach dem Kriege
zurückzustellen.» «Diese 7 Geschütze führten die Bauern mit den in
Sempach weggenommenen Waffen nach Gisikon.» «Die Luzerner dagegen
machten mit 200 Mann und 2 Geschützen einen Ausfall nach
Rathhausen; die Bauern zogen sich mit Verlust von vier Mann nach
Perlen und Gisikon zurück, nachdem sie aus dem Kirchturm zu Emmen
zwei Bürger von Luzern verwundet hatten.»
Als so das Volk eben erst begann, den Führern auf eigene Faust
zu zeigen, dass es für den Endkampf um seine Freiheit zu allem bereit
war —da kam am 27. Mai aus dem Zentrum des Aufstandes nicht etwa
der zündende Funke eines alle Streitkräfte kühn zusammenfassenden
Kampfbefehls, sondern die lähmende Kunde vom abgeschlossenen
Waffenstillstand! Der einzige «Tagesbefehl», den wir von der Leitung
der luzernischen Bauernarmee in diesen Tagen überhaupt vernehmen,
lautet: «Wir wohlbeamtete Landespannerherr, Landshauptmann, Landsfehndrich
sammt aller X Aemter Ausschüssen befehlen allen und jeden
Hauptleuten, Wachmeistern und Kaporalen, dass sie das Volk allenthalben
in einem Stillstand halten, weil nun, Gottlob! heutnächtigen
Abend der Anfang zu einem friedliebenden, heilsamen, glücklichen
Frieden angeschlagen worden, also dass Wir glücklicher Hoffnung
sind, es werde sich die Sache nach und nach wohl lassen einrichten.
Also sollet ihr wissen, dass ihr diesem Befehl des Stillstands fleissig
nachkommt, damit nicht etwann ein grosses Uebel daraus erfolgen
möchte. Hiemit Gott und Mariä Fürbitte befohlen. Geben den 27. Mai
1653.» Unterzeichnet aber ist dieser Befehl nicht vom Landespannerherr
Emmenegger, nicht vom Landeshauptmann Glanzmann, nicht vom
Landesfähnrich Binder, von keinem Entlebucher oder Willisauer, auch
nicht vom Bundes- und Kriegsratsschreiber Johann Jakob Müller —
sondern einzig und allein: «Von mir Kaspar Steiner, Gerichtschreiber
im Amte Rothenburg»!
Was da in Wirklichkeit vor sich gegangen ist, wird uns wohl für
immer ein Rätsel bleiben. Zwar vernehmen wir noch allerhand Details
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 436 - arpa Themen Projekte
sein soll. Dabei tat sich vor allem der Nidwaldner Leu hervor, der ja
dabei hoffen durfte, eine grosse Rolle für seine eigene Person als «eidgenössischer
Schiedsrichter» in Stans zurechtmachen zu können; neben
ihm, neu, der Landammann Reding von Schwyz. Sie wurden am 27.
«zu den Vorposten der Bauern nach Kriens geschickt, um ernstlich anzufragen,
ob sie Krieg oder Frieden wollen». Sie haben «endlich um
Mitternacht» «eine Vereinigung in dem Sinne» zustandegebracht, «dass
der Kriegsrat (!) der IV Orte» — also einseitig die eine der kriegführenden
Parteien, die Herrenpartei — «die Schiedsrichter zu ernennen
habe». Zwar hatten die Bauern zuerst verlangt, es «dürfe keiner
Schiedsrichter sein, der bei dem früheren Spruche oder bei dem Mandate
von Baden mitgewirkt habe»; ja, sie forderten auch, «unbedingt
müsse die Fortsetzung des Bundes garantiert werden»! Aber das waren
nur die letzten Zuckungen des revolutionären Gewissens einer offensichtlich
hoffnungslos in die Minderheit gedrängten Partei. Denn der
Luzerner Rat «wollte absolut vom Bauernbunde nichts wissen und sich
auch die Beschränkung in der Wahl der Schiedsrichter nicht gefallen
lassen». Und dabei blieb es der Sache nach.
Wo aber bleiben bei alledem Hans Emmenegger und sein ganzer
«geheimer Rat», die doch durch den grossen Tag in Schüpfheim am
18. Mai diese Phase des Aufstandes, in der die ganze luzernische Revolution
ihren bisherigen Gipfel erreichte, erst überhaupt geschaffen
hatten? Sie alle, und auch die Willisauer Führer, sind bei diesem entscheidenden
Akt des Waffenstillstandes auf einmal wie aus der Geschichte
verschwunden! Als hätte sie der Höllenrachen des Hasses verschluckt,
zu dem sich alle Herrenchronisten der Zeit gegen sie verschworen
haben...
Aber der Waffenstillstand sollte ja nur «bis zum 3. Juni, abends,
dauern», weil man «hoffte, bis dahin würde das Schiedsgericht in
Stans die Streitigkeiten beenden können». Es war also noch eine Frist
gegeben, und im Freiheitskampf der Luzerner Bauern noch nicht -—
noch nicht ganz —aller Tage Abend angebrochen. Da ermutigt es uns,
zu hören: «Auch die Macht der Bauern vor Luzern verstärkte sich. So
marschierten am 27. Mai die Brittnauer durch das Gebiet von Luzern,
am. 28. die Leute von Olten, Aarburg und Umgebung.»
Besonders ermutigend aber ist es, sofort nach dem Abschluss des
Waffenstillstandes wieder etwas echt Emmeneggerisches von Hans
Emmenegger zu hören. Gewiss, die Mehrheit der Ausschüsse — nicht
das Volk —hatte ihn, verwirrt wie sie waren, im Stich gelassen. Gewiss,
die Bürger hatten ihn um der Silberlinge willen feige an die Herrenklasse
verraten. Aber da blieb immer noch das Volk, auf das er baute
und das eben erst gezeigt hatte, dass es anfing zu begreifen, was bisher
nur die Entlebucher und teilweise die Willisauer zu begreifen gelernt
hatten: für die Freiheit und das «göttliche Recht» im Busen jedes
Menschen müssen wir entschlossen sein, auch das Blutopfer auf uns
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 437 - arpa Themen Projekte
werden konnte, zu diesem Volk zu stossen und für das eigene Menschenrecht
zu kämpfen: da blieb die entrechtetste und unterdrückteste
Klasse in Stadt und Land: die bürgerrechtslosen Hintersassen!
Und tatsächlich berichtet Liebenau: «So hatte Landespannermeister
Emmenegger verkünden lassen, dass alle Hintersassen, welche den Feld-Zug
gegen Luzern mitmachen, als Landleute» (z. B. ins Entlebuchische
Landrecht!), «aufgenommen würden. Und diese Zahl war nicht unbeträchtlich,
da seit vielen Jahren keine Landleute mehr aufgenommen
worden waren. . waren...»
Nein, auch wenn ihn und seinen «geheimen Landrat» die Mehrheit
seiner eigenen Klasse unwissend im Stich liess und die verbündete
Bürgerklasse ihn verriet; selbst wenn Niklaus Leuenberger schliesslich
wirklich kapitulieren sollte, was er trotz allem von ihm nicht glaubte:
ein Hans Emmenegger gab den Kampf um das «göttliche Recht» nicht
auf; er verweigerte, wie alle seine Getreuen, die Unterschrift unter ein
erschlichenes Dokument der Schmach und ging mit ihnen tapfer in
die Opposition der revolutionären Minderheit; er und sein «geheimer
Landrat» kapitulierten niemals — «auch dann nicht»!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 438 - arpa Themen Projekte
XVII.
«Wir, Euer Gnaden kleinfügige Unterthanen...»
Leuenberger muss wider Willen den Landsturm ergehen
lassen, durchkreuzt den Kriegsplan der Entlebucher —
und sprengt, er weiss nicht wie, den Bund!
Auch im Bernbiet war die Volksstimmung bedeutend revolutionärer,
als die Huttwiler Landsgemeinde sie auswies. Wenn auch die
Entwicklung des politischen Bewusstseins, sogar des revolutionären
Flügels der Berner Bewegung, weit hinter derjenigen der Entlebucher
zurückblieb, so ist doch kein Zweifel daran möglich, dass es einzig der
vorwärts stossende Massendruck eines Teils der Bauern war, was die
Dinge im Kanton Bern — wenn auch anonym und oft schwer greifbar
— selbst über den Kopf Leuenbergers hinaus ins Rollen brachte und
zur Entscheidung trieb.
Aus Selbsterhaltungsinstinkt fühlten dies die Berner Herren durchaus
richtig heraus und trafen danach ihre Massnahmen. Schon am
16. Mai hatte, nach Peter, der Rat von Bern an den von Zürich berichtet,
«die Bauern legten grosse Frechheit, Trotz, Uebermut und ,Verachtung
gegen die Obrigkeit' an den Tag ,und anders Nut Alsa ein gesetzliche
verharrung uff den gefassten und inn ihrem bussen steckenden
büssen vorhaben der angreift- und an sich bringung des oberkeitlichen
gwalts ze verspüren und hiemit die thetligkeit selbst zu erwarten',
und den Vorort ersucht, nicht nur selbst eiligst seine Truppen zu
besammeln, um auf ,ferneres Anmahnen' sofort aufbrechen zu können,
sondern auch alle übrigen evangelischen Orte und die drei Bünde zu
mahnen. Sodann wurde Freiburg gebeten, es solle sich nicht bloss ,in
guter Postur halten', sondern allgemach seine Truppen bis zur Sense
vorrücken lassen, und an Bünden wurde berichtet, nicht nur die tausend
Mann, die Bern ,laut Badischem Abscheid' besolden solle, sondern
so viele Truppen als möglich auf Berns Kosten zu stellen; Biel, Neuenstadt,
Münstertal und Neuenburg sollten ebenfalls ausrücken, und Genf
wurde angegangen, 600 Mann nach Moudon marschieren zu lassen.
Oberst von Diessbach erhielt Anweisung, seine im Waadtland gewordenen
Hilfsvölker nach Yverdon zu legen, und Oberst Morlot, sein
Regiment in Peterlingen einzuquartieren.»
So gefährlich also schätzten die Berner Herren die Volksstimmung
unter ihren eigenen Bauern unmittelbar nach dem Huttwiler Tag ein
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 439 - arpa Themen Projekte
zu können. Dabei hat auch im .Bernerland der Verlauf dieser Landsgemeinde
die Revolutionäre mindestens teilweise eher entmutigt und
dafür die Kapitulanten ermutigt, ähnlich wie wir dies bei jenem Teil der
Luzerner Bauernführer feststellen mussten, der sich am 15. in Malters
versammelt hatte, um zum «rechtlichen Spruch' zurückzukehren;
welche Versammlung dann allerdings durch die sofort herbeigeeilten
Entlebucher wieder in eine revolutionäre verwandelt wurde. Von der
unmittelbaren Rückwirkung der grossen Landsgemeinde im Bernischen
berichtet Vock: «Die Gesandten der Regierung von Bern» — d. h. die
in Huttwil gewesenen, die sich unverrichteter Dinge nach Wynigen zurückziehen
mussten — «vernahmen bei ihrer Ankunft in Wynigen am
14. Mai Abends, dass die zu Huttwil versammelten Berner Bauern in
ungleiche Gesinnungen und Ansichten geteilt seien und viele derselben,
besonders die aus dem untern Aargau, geäussert haben sollen, dass sie
ihrerseits mit den von der Regierung anerbotenen Artikeln befriedigt
sein würden.»
Ein ideales Feld für «Verhandlungs»-Manöver zum Zwecke des
Zeitgewinns und der Tarnung der Rüstungen! Und richtig: «Aus dieser
Mitteilung schöpften die Gesandten neue Hoffnung auf Abschliessung
eines gütlichen Vergleichs...» Sie bekamen auch, wie Peter berichtet,
a tempo vom Berner Rat die Instruktion nach Wynigen: «damit
noch ein übriges zu allein hinzugetan und die Gütigkeit (!) auch im
äussersten Falle nicht gespart werde, wollen wir uns genügen lassen
und hiemit eure Vollmacht dahin erweitert haben, dass ihr euch wiedrum
zu den Bauern nach Huttwil begebet und mit ihnen in der Unterhandlung
fortfahren sollet» — genau zur gleichen Zeit, zu der der Berner
Rat das eben geschilderte militärische Gewitter um die Bauern zusammenzog!
Man hoffte offensichtlich, mit dem Hinausziehen der Verhandlungen
auf dem Lande die Bauern lange genug von der Waffenergreifung
und von einem Zug nach Bern abhalten zu können, um die
Stadt inzwischen mit einer erdrückenden Truppenmacht versehen zu
können.
Da nun gewisse Aargauer, von deren Neigung zur Kapitulation
wir soeben gehört haben, dringend wünschten, dass Langenthal statt
Huttwil als Verhandlungsort gewählt werde und der Berner Rat
«diese bequemere Malstatt» gerne annahm, so setzte Leuenberger einen
Verhandlungstag zwischen den Berner Ausschüssen und der Regierungsdeputation
auf den 16. Mai nach Langenthal an. Da waren es besonders
gewisse Lenzburger, die — wie Peter, nach einem Bericht des
bernischen Amtsmanns von Königsfelden an den Berner Rat, erzählt —
«den Auftrag (!) hatten, die Emmentaler nochmals zu friedlicher und
gütlicher Unterhandlung zu ermahnen und falls ihre Mahnung nichts
fruchten sollte, sich von ihnen abzusondern und ihre eigene Sache
Gott und der Obrigkeit anzuvertrauen». Und «so sollte womöglich jedes
Amt veranlasst (!) werden, seine Beschwerden einzeln vorzubringen».
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 440 - arpa Themen Projekte
und die «Veranlassung» gegeben hatte. Doch das ist nicht schwer zu
erraten; diese «Lenzburger» erinnern zu sehr an jene «Oberländer», die
zu demselben Zweck an die erste Huttwiler Gemeinde geschickt worden
waren! Schlimm aber ist, dass Leuenberger von Anfang an den Wünschen
solcher Leute offensichtlich Gehör schenkte, als er die Verhandlungen
von dem durch Revolutionstradition in den Augen der Bauern
bereits geheiligten Huttwil nach Langenthal verlegte.
Wer aber waren nun wohl jene «Emmenthaler», von denen die
Berner Regierung in ihrer Instruktion an die Gesandten in Wynigen
befürchtete, dass die Verhandlungen «wegen iren ungereimbten und
gar unbilligen und theils unmüglichen Anmutungen und allerweg steiffem
Verharren sich zerschlagen wurden»? Gewiss meinte die Regierung
damit in erster Linie auch Leuenberger selber, den sie von ihrem
Standpunkt aus natürlich für einen vollwertigen, ja ganz besonders
«gefährlichen Ertzrebellen» hielt. Denn dieser hatte ihr am 15. zu
schreiben gewagt (welch ein «Wagnis» neben den wirklichen Wagnissen
der Entlebucher!): «Wir bitten Euer Gnaden, Ihr wollet mit demütigen
Reden uns begegnen, und nicht mit Rüche (Schärfe), damit die
Landleute nit etwann in Zorn gerathen möchten.» Damit aber baute
ja Leuenberger selber vor, dass keine revolutionäre Sprache auf der
Versammlung aufkommen konnte; somit glaubte er wirklich an die
Möglichkeit eines «Vergleichs»!
Aber in den Augen der Berner Herren war schon die blosse Tatsache
«eine unmögliche Anmutung», dass der «Untertan» Leuenberger
ihnen, wenn auch mit noch so untertäniger Bitte, Verhaltungsmassregeln
erteilen wollte. Findet doch sogar noch der um fast 200 .Jahre
später schreibende Herrenchronist Vock die Sprache dieses Briefes
Leuenbergers eine «anmassende Sprache»! Vielleicht mit deshalb, weil
dieser in dem Briefe auch schrieb: «Die Action soll unter dem heitern
Himmel geschehen», während die Instruktion des Berner Rates an die
Gesandten lautete: «darauf zu dringen, dass die Versammlung zu Langenthal
in oder bei der Kirche abgehalten werde». Um solche Dinge
ging es im Bernerland zu genau derselben Zeit, als die Entlebucher in
Schüpfheim sich anschickten, den freien, souveränen Volksstaat zu errichten..
Nein, die «Emmenthaler», die revolutionären Schwung nach Langenthal
brachten, oder die ihn dort wenigstens auslösten, waren —
Entlebucher! Gewiss gab es auch echte Revolutionäre unter den Emmentalern,
wie Uli Galli oder Hans Rüeggsegger, der Weibel von
Röthenbach, beide von der alten Garde des Thuner Handels; sie drangen
jedoch bei der Bundesleitung offenbar noch nicht durch. Nach
Langenthal «strömten von Huttwil her», wie Vock berichtet, «am
16. Mai Morgens in aller Frühe nicht nur die Berner Bauern, sondern
auch viele Luzerner». Unter ihnen wahrhaftig die beiden hitzigsten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 441 - arpa Themen Projekte
der luzernische Tell selbst, wie ihn der Herrenknecht und
Hauslehrer im Schloss Aarwangen, Markus Huber, in seiner Chronik
spöttisch nennt; sowie der so lange aus allen Berichten verschwundene
«tolle Landsknecht» Christian Schybi.
Die Entlebucher waren also selbst hier auf scharfer Wicht; sie
folgten Leuenberger dicht auf den Fersen und sorgten dafür, dass er
nicht schwach werden konnte! Das besorgten die beiden Heissporne —
natürlich nicht allein — in sehr drastischer Weise: «Wie sie zu Langenthal
ankamen, liessen sie viele Männer von Rohrbach, Dietwil und
Langenthal, die als ,Linde' verdächtig schienen, verhaften und im
Kaufhause zu Langenthal gut bewachen», «welches die Bauern zu
ihrem Hauptstaatsgefängnisse gemacht hatten.» Diese Aktion setzt natürlich
ein sehr weitgehendes Zusammenwirken mit den Berner Bauern
selber voraus — und dies lässt den Schluss zu, dass eben doch die
Volksstimmung im Bernbiet und jedenfalls im Oberaargau ungemein
viel revolutionärer war, als sie in Leuenbergers Führung zum Ausdruck
kam. Um diese Volksstimmung, im Dienst der gemeinsamen
Sache, als treibenden Faktor hinter Leuenberger zu stellen — zu diesem
Zweck sind zweifellos die Entlebucher nach Langenthal geschickt
worden.
Nun war aber unter den Verhafteten auch der regierungstreue
Kreuzwirt David Wild von Langenthal, bei dem die Gesandten des
Berner Rats abzusteigen pflegten und auch jetzt ihre Zimmer bestellt
hatten. Das bot diesen den Vorwand, jede Verhandlung an diesem Tag
und Ort zu verweigern, sich entrüstet wieder nach Wynigen zurückzuziehen
und dadurch eine sehr im Interesse der Herren gelegene weitere
Verzögerung einzuschalten! Als weitere Begründung dafür diente
die nicht weniger entrüstet gemachte Feststellung der «Anwesenheit
vieler Bauern aus anderen Kantonen».
Jetzt erst wurde Leuenberger einigermassen «anmassend», um im
Stil der Herrenchronisten zu sprechen. Das heisst: jetzt ermannte er
sich genau in dem Masse wie die Volksstimmung auf ihn einzuwirken
vermochte. Als die Landsgemeinde, die sich auf freiem Feld bereits
versammelt hatte und die Berner Herren erwartete, von deren plötzlicher
Umkehr erfuhr, muss sie sehr rabiat geworden sein. Denn am
17. frühmorgens schrieb Leuenberger folgenden, für sein Verhältnis
zur revolutionären Volksstimmung höchst bezeichnenden Brief an die
Berner Herren: «Euer Gnaden wollen ermahnt sein, auf unsere vollkommenen
(sämtlichen) Klagen bis Morgen satten und redlichen Bescheid
zu geben. Beschieht solches, ist's mit Heil; wo nicht, wird ein
grosser Tumult und Aufruhr daraus unter dem gemeinen Volk erwachsen;
denn solches gar ergrimmt ist, ob gleichwohl die Ausgeschossenen
gern ihr Bestes thäten (!!)...» Exakt so weit war man im Luzernischen
bereits mit dem Ruswiler Rumpfparlament gewesen, als
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 442 - arpa Themen Projekte
«rechtlichen Spruch» verhandelten und sich dabei so verhängnisvoll
übertölpeln liessen. Nur dass dort Hans Emmenegger und die Entlebucher
bereits das Aufgebot gegen Luzern erlassen hatten und mit dem
«ergrimmten Volk» selber gegen die Herren ins Feld gezogen waren.
Während Leuenberger hier ganz auf der Seite der verhandlungsbereiten
Ausschüsse stand und die Herren geradezu warnte, er werde dem
Druck der ergrimmten» Masse leider nachgeben müssen, wenn sie
nicht mehr Entgegenkommen bewiesen. Das konnte den Herren unmöglich
Respekt einflössen oder gar Schrecken einjagen!
Dieselbe Landsgemeinde, die die Berner Herren vergeblich erwartete,
fasste übrigens — zweifellos nur unter dem Druck der «ergrimmten»
Masse, nicht auf die Initiative Leuenbergers — auch kriegerische
Beschlüsse. Es steht fest, dass, wie Vock nach einem eigenen späteren
Verhör Leuenbergers berichtet, «für den Fall der Not die Kriegsordnung
beraten und unter anderm beschlossen wurde, nicht die kleinen
Städte und Schlösser, wie vor zwei Tagen zu Huttwil verabredet
wurde, sondern die Stadt Bern selbst, als die Hauptstadt, zu belagern
und die Pässe bei Gümmenen und Aarberg zu besetzen, damit so alle
Zufuhr abgeschnitten und niemand weder heraus noch hinein gelassen
werde'. Das war ganz offensichtlich eine Korrektur, die die Entlebucher
gegen den Huttwiler Beschluss durchsetzten, um den Kriegsplan
der Berner Bauern dem der Luzerner anzugleichen, der sich, wie
wir sahen, ebenfalls auf die Hauptstadt konzentrierte. Trotzdem wurden
von derselben Landsgemeinde vier gleichlautende Schreiben an die
Landvögte auf den Schlössern von Thun, Burgdorf Aarwangen und
Aarburg angesandt. Darin kommt vielleicht Leuenbergers ursprünglicher,
beschränkterer und bloss passiv-defensiver Kriegsplan, der dem
Huttwiler Beschlusse zugrunde gelegen hatte, als Beschluss zur «Wahrung
seines Gesichts» zum Ausdruck. Aber dieser hatte nun, innerhalb
des soeben beschlossenen erweiterten Kriegsplans, ebenfalls eine neue,
gesteigerte Bedeutung. [)er Text der vier Schreiben lautete: «Es nimmt
uns Wunder, warum Ihr bei dieser schweren, betrübten Zeit und Gefahr
Kriegsvölker in das Schloss nehmet. Desswegen Ihr ernstlich ermahnt
sein sollet, alsobald selbige abzuschaffen, sintemal Wir solche
nicht dulden können, und im Fall das nicht geschieht, wollen Wir
dieselbigen wohl dannen (weg) bringen. Wisset Euch hiemit zu verhalten.'
Leuenberger will nur ein paar Dornen beseitigen, die das Volk
irritieren; und zwar deshalb, weil er immer noch an eine «Verständigung»
mit den Gnädigen Herren glaubt. Von einem Ultimatum, oder
gar von einem kühnen, positiven politischen Plan, wie bei den Entlebuchern,
ist bei Leuenberger keine Rede.
Jedoch, durch den von derselben Landsgemeinde angenommenen
Kriegsplan, die Hauptstadt anzugreifen, war für Leuenberger eine völlig
neue Lage geschaffen. Ueberhaupt bedeutet dieser Vorschlag und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 443 - arpa Themen Projekte
kampfentschlosseneren Revolutionäre. Sie haben damit die kommenden
Ereignisse in der Tat vorausbestimmt und Leuenberger die Marschroute
und das Gesetz des Handelns vorgeschrieben! Dass dieser von
vornherein ein derart Geschobener war, konnte allerdings für den Gang
der Ereignisse selbst nicht viel Gutes verheissen. Dass Leuenberger den
Auftrag durchführte, war keine Garantie für ein Gelingen im Sinne
des ganzen Bundeszieles. Denn dessen Durchführung blieb nach wie
vor durch Leuenbergers Untertanen-Hoffnung auf einen, allen eigentlichen
Kampf vermeidbar machenden Kompromiss mit den Herren
belastet...
Schon am Abend des 16. hatte Leuenberger die Berner Gesandten
schriftlich ersucht, die Verhandlungen in Langenthal wieder aufzunehmen,
«wo nicht, werden wir verursacht werden, andere Mittel vor
und an die Hand zu nehmen». Als er am 17. den Herren das oben wiedergegebene
Billet schickte, liess er ihnen durch den Ueberbringer
mündlich zusichern, «dass Niemand anderer als Berner Landleute der
Unterhandlung beiwohnen werden». Diese Konzession ermöglichte es
dem Prestige der Berner Gesandten, die Verhandlungen wieder aufzunehmen;
'ausserdem hatten sie strikten Befehl von Bern, ihren deutlich
gezeigten Widerwillen zu überwinden und die Bauern so lang wie
möglich hinzuhalten, d. h. vom Landsturm abzuhalten.
So fand am 18. Mai in Langenthal — genau zu derselben Zeit,
da in Schüpfheim Emmenegger und der «geheime Landrat» die Luzerner
Herren so überlegen meisterten — folgende Verhandlung zwischen
den Ausgeschossenen der Berner Bauern und den Berner Herren
statt. Die Herren brachten von der Regierung bewilligte «Konzessionen»
mit, die sie Leuenberger schon am Tag zuvor in Abschrift hatten
zustellen lassen. «Die übersandten Artikel», berichtet Vock, «wurden
vor der versammelten, nur aus Berner Landleuten bestehenden Landsgemeinde
in Gegenwart der Regierungsabgeordneten verlesen und hierauf.
von diesen freundliche Zusprüche an die Landleute getan.» Weder
von Vock, noch von Bögli erfahren wir, welchen Inhalts diese Artikel
waren. Dagegen sagt Peter kurz und bündig: die Ratsabgeordneten
«eröffneten den Bauern, die Regierung sei entschlossen, das Trattengeld
(!) abzuschaffen und dem Begehren betreffend Salzverkauf (!) zu
entsprechen, auch einige Begehren der einzelnen Aemter (!) anzunehmen».
Den Hohn des Angebots solcher Lappalien in einem derartigen
Augenblick scheinen Leuenberger und die Mehrzahl der Berner Bauern
gar nicht empfunden zu haben! Und dies trotzdem diese «von der Regierung
anerbotenen Artikel» allem nach tatsächlich nur einen winzigen
Bruchteil sogar jener «April-Konzessionen» enthielten, wegen
deren wortbrüchiger Nichtausfertigung in Brief und Siegel die Berner
Bauern, und speziell Leuenberger, vor allein wieder in Aufstand getreten
waren! Zwar waren die Bauern offensichtlich unzufrieden und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 444 - arpa Themen Projekte
schwach vorgetragen worden sein; denn wir erfahren nichts Zuverlässiges
darüber. Bögli sagt nur: «Aber die Verhandlungen scheiterten,
weil die Gesandten einige allgemeine Forderungen nicht zugeben durften
und daher wieder nach Bern abreisten.» Peter allerdings sagt:
«Allein diese Versicherungen genügten den Aufständischen nicht; sie
verlangten eben vor allem Anerkennung des Huttwiler Bundes und
forderten das Recht, Lands gemeinden halten zu dürfen. So zerschlugen
sich die Verhandlungen.»
Wir atmen auf: also doch einigermassen politische Forderungen!
Wenn auch keine, die nicht bereits früher schon, und damals mit ganz
anderem Nachdruck, erhoben worden wären. Leider aber kann auch
Peter dafür keinerlei Nachweis geben; vielmehr stellt seine Behauptung
nur eine Abteilung eben aus jenen früher erhobenen Forderungen
dar; eine blosse Vermutung, die wir zur Ehre der Bauern gern als
wahrscheinlich annehmen möchten. Vock aber erzählt direkt: «Die
Bauern erklärten, dass sie die anerbotenen Artikel annehmen (!), fügten
aber, nachdem sie sich unter sich selbst eine Zeitlang beratschlagt
hatten, hinzu, dass mit jenen Artikeln nicht alle ihre Wünsche befriedigt
seien (!), und sie übergaben den Gesandten eine von Leuenberger,
als Obmann des Bundes, unterzeichnete, schon vorher verfasste und
vom 17. Mai datierte Schrift.»
Wir stürzen uns also mit brennender Neugier auf diese von Vock
in Wortlaut wiedergegebene Schrift, in der Hoffnung, hier endlich
das politische Glaubensbekenntnis Leuenbergers und der Mehrheit der
Berner Bauernführer zu finden! Wir finden es auch — aber leider ein
sehr trauriges, das unsere schlimmsten Befürchtungen rechtfertigt.
Umsomehr als diese Schrift offensichtlich unmittelbar nach Erhalt der
am 17. Leuenberger überbrachten «Konzessionen» der Regierung, als
Antwort auf diese, niedergeschrieben und jedenfalls jetzt, am 18., als
solche den Herren offiziell überreicht wurde.
Allerdings ziehen die Bauern in Artikel 1 ihres Schreibens vom
17. Mai vor, anstelle der jetzt bewilligten mageren «Konzessionen» auf
den umfassenderen Forderungen der Artikel zu beharren, die sie nach
dem ersten Huttwiler Tag niedergeschrieben und am 7. Mai den Herren
eingesandt hatten — aber mit welch ängstlichen Kautelen bezüglich
ihrer urkundlichen Begründbarkeit: «insofern nicht...»! Allerdings
wollen die Emmentaler in Artikel 2 nicht als Leibeigene gelten
— «es werde denn...» urkundlich bewiesen! Allerdings soll nach Artikel
3 das Recht, Landsgemeinden zu halten, «nicht aufgegeben» werden
— aber wie fern von jedem positiven Glauben an ein politisches
Programm ist diese negative und defensive Form einer solchen Forderung!
Und allerdings soll in Artikel 4 an einigen Forderungen des
Huttwiler Bundes festgehalten werden — aber ohne ausdrücklich zu
diesem zu stehen oder ihn auch nur richtig zu verstehen! Ja, dieser
vierte Artikel windet sich in seiner endlosen Bandwurmform vom Anfang
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 445 - arpa Themen Projekte
Strafe der Obrigkeit und mündet auch folgerichtig in das verklausulierte
Angebot der Huldigung, d. h. der Kapitulation vor den Gnädigen
Herren!
Wie Tag und Nacht stehen sich die beiden politischen Bekenntnisse
dieses entscheidenden — eben durch diese Diskrepanz das Verhängnis
entscheidenden — 18. Mai gegenüber: das Hans Emmeneggers
und der Entlebucher und das Niklaus Leuenbergers und der Berner
Bauern. Die Nacht darf neben dem Tag nicht fehlen — wie wäre sonst
die Katastrophe begreiflich! Darum lese man hier, wie man das der
Entlebucher las, auch das Bekenntnis Leuenbergers und seiner Bauern
im Wortlaut, so wenigstens, wie es von Vock wiedergegeben worden ist:
«1. Die Landleute wollen bei den der Oberkeit mitgetheilten Klagen
und Artikeln gänzlich verbleiben, seien es die gemeinschaftlichen Klagen
des Landes oder diejenigen besonderer Vogteien, Kirchhörinen
und Gemeinden, insofern nicht die Obrigkeit den Ungrund des einen
oder andern Artikels aus alten Urbanen und Bundesbriefen darthun
könne.
2. Die Emmenthaler können die Behauptung nicht zugeben, dass
sie verkauft und leibeigen seien, es werde denn der urkundliche Beweis
hiefür vorgelegt.
3. Das Recht, Landsgemeinden zu halten, werden sie nicht aufgeben.
4. Wenn nun ihre GH Herrn und Obern ihnen die begehrten Artikel
gewähren, wenn ihre Bundesbrüder, die Unterthanen von Luzern,
Solothurn und Basel, gleichfalls in ihren Artikeln befriedigt und
der Neuerungen entledigt sein werden, wenn man keinen der Bundesbrüder,
wie sie sich einander versprochen, weder an Ehre, Leib, Hab
und Gut, noch zu Tisch, zu Bett, zu Wasser oder zu Land beleidige,
sondern, ohne allen Angriff oder Verweis, sicher reisen lasse, und wenn
Jemand hiewider thäte, diese die Oberkeit gebührend abstrafe, und,
wenn das nicht beschähe, die Bundesbrüder, einen solchen zu strafen,
Gewalt haben sollen, — wenn man ihnen die alten Bundesbriefe, von
Wort zu Wort abgeschrieben und besiegelt, ausliefere, damit dieselben
alle fünf Jahre zu Stadt und Land, vor Jung und Alt, abgelesen, und
die Dawiderhandelnden abgestraft werden können, — wenn man ferners
ihnen, den Landleuten, gestatte, ihren zu Sumiswald und Hutwyl
beschwornen Bundesbrief, der nichts wider die oberkeitlichen
Rechte enthalte, und von welchem sie der Regierung nächstens eine
Abschrift zuschicken werden, alle zehn Jahre an einer Landsgemeinde
abzulesen, damit man wisse, wer dawider handle, — wenn dress alles
geschehe und bewilligt werde, dann erst werden sie der Oberkeit wieder
huldigen, wie ihre Altvordern gehuldigt haben.
5. Ueber diese Artikel verlangen sie sogleich, und während sie
noch versammelt seien, den Bescheid der Gesandten.»
Der Bescheid der Gesandten war, «dass solche Forderungen zu
bewilligen nicht in ihrer Macht stehe» — und dass sie daraufhin unverzüglich
nach Bern zurückreisten. Aber nicht weil sie — wie Dulliker
durch Hans Emmenegger — durch Leuenberger gemeistert worden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 446 - arpa Themen Projekte
sich in Kürze, sobald man eine zweifellose militärische Uebermacht
zuende gerüstet haben würde, diesen Bauern gegenüber jede Schmach
und Schandtat werde leisten können! Denn das Schreiben, das sie
nachhause trugen, war ein kaum verhüllter Schrei nach Gnade, der die
Gewalttat der Herren förmlich herbeilocken musste. Dieses Schreiben
der Bauern vom 18. Mai ist ein geradezu klassisches Manifest des
schlechten Gewissens des durch die Rebellen — nicht wissend wie ihm
geschah — «fehlbar» gewordenen «Untertanen»... Leuenbergers!
Und doch war derselbe Leuenberger dazu bestimmt, den ersten
allgemeinen Landsturm im Bauernkrieg ergehen zu lassen! Nicht durch
ein mystisches Schicksal, das gerade ihn dazu — zum Heil der Herren
— erkoren hätte; vielmehr durch das Eingreifen der revolutionären
Massenstimmung unter den Bauern, die nun von Tag zu Tag, ja
von Stunde zu Stunde zunahm. Wie das herging, bis der Landsturm
erscholl, wollen wir nun, so gut es geht, an Hand der gerade dafür
spärlich fliessenden — oder schamhaft zugedeckten — Quellen Stufe
für Stufe verfolgen.
«Durch die plötzliche Abreise der Gesandten erbittert, schrieben
die Bauern noch am Abend des nämlichen Tags (des 18. Mai) an die
Regierung von Bern» — so berichtet Vock —: «Damit sie aus den
Kosten kommen und wissen, woran sie seien, so verlangen sie bis künftigen
Dienstag, den 20. Mai, eine runde Antwort auf die schriftliche
Eingabe an die Herren Gesandten vom 17. Mai, und man solle sie an
den Obmann Leuenberger nach Schönholz schicken. Wenn das nicht
geschehe, so werde der Stadt Bern alle Zufuhr von Lebensmitteln abgeschnitten
werden.» Die gleiche Drohung, und zwar zwecks Erzwingung
des freien Passes über die Aare, erging übrigens am gleichen Tag,
unter dem heftigen Druck revolutionärer «Ausschüsse des Lenzburger
Amtes», auch an die Stadt Aarau, die sich jedoch, nach Peter, herausredete,
«dass die Gestaltung des freien Passes ein Regalrecht ihrer gnädigen
Herren in Bern sei»; was einer Untertanenstadt ja auch wohl anstand.
Das war das Ultimatum der Bauern, das die erbitterte Volksstimmung
Leuenberger abgenötigt hatte. Aber noch dieses Ultimatum
wurde in der ehrlichen, zweifellos von Leuenberger stammenden Illusion
abgegeben, die Herren würden die Hand zum «gewünschten Frieden»
bieten, ohne dass es zum Landsturm zu kommen brauche! Denn
dem Ultimatum wurde, nach dem Text Vocks, hinzugefügt: «Insofern
aber der gewünschte Friede zustande komme, dürfen die Gnädigen
Herren versichert sein, dass alsdann die Bauern, als getreue Unterthanen,
Zins und Zehnden, Renten und Gülten ihnen gebührend und
von Allein her werden verabfolgen lassen»! Ausser einigen Erleichterungen,
sollte es also, nach dem Willen Leuenbergers, auch jetzt noch
politisch wie wirtschaftlich durchaus beim Alten bleiben —wobei man
sich dann allerdings das Weiterbestehen des Bundes, das ja erwartet,
wenn auch nicht ausdrücklich gefordert war, nur noch als harmlose
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 447 - arpa Themen Projekte
Herren, dass sie darauf nicht eingingen —sie hätten auf diese Weise
Alles, restlos Alles bekommen und viel billiger bekommen können...
Aber mit diesem Schreiben der Bauern kreuzte sich ein solches
der Herren, die ebenfalls noch an diesem 18. Mai, sofort nachdem die
Gesandten von Langenthal nach Bern zurückgekehrt waren, sich hinsetzten,
um die mitgebrachte Schrift der Bauern vom 17. zu beantworten.
Der Tenor dieser Antwort war, nach Vock, folgender: die Regierung
«müsse nach allem, was vorgegangen, glauben, dass sie, die
Bauern, den Frieden nicht wollen»! Zwar versichere sie ihnen, «dass
sie es bei den bewilligten Artikeln, und sonst überhaupt jede Gemeinde
insbesondere bei allen Freiheiten, Briefen und Siegeln, alten Urbanen
und guten Gewohnheiten verbleiben lasse» weil die nämlich, bei der
schon jahrhundertealten Unfreiheit der Berner Bauern, sehr zugunsten
der Privilegienrechte der Herren lauteten! «Was aber nicht urkundlich
darzuthun sei», das wolle die Regierung «dem Worte Gottes (!) und
aller Billigkeit (!) zum Entscheid anheimstellen»; d. h. der Willkür
der Herren und der ihnen sklavisch ergebenen Kirchendiener. Speziell
aber «inbezug auf die Abhaltung von Landsgemeinden solle es fortan
gehalten werden wie von Altem her» — d. h. es soll, bei Strafe Leib
und Lebens für Hochverrat, keine geben! Da hatte Leuenberger schon
im voraus den Lohn dafür, dass er Alles beim Alten bleiben lassen
wollte! Denn auch die vor Jahrhunderten üblichen «Volksanfragen»,
die schon im 16. Jahrhundert ausstarben, waren nie autonome Landsgemeinden
gewesen. Die Regierung schloss ihr Schreiben mit einer
Drohung: «Sie (die Bauern) werden hiemit noch einmal vor allen Tätlichkeiten
und unerlaubten Mitteln gewarnt und dafür verantwortlich
gemacht. Sie, die Regierung, begehre nur Frieden und Ordnung» (ihren
«Frieden» und ihre «Ordnung» natürlich) «und nichts Unrechtes» (nur
ihre rechtswidrige, ganze und unteilbare Gewaltherrschaft!). «Das sollen
sie wissen, und sie mögen dieses Schreiben in allen Gemeinden
verlesen lassen. Beinebens werde die Regierung nun, zu nöthiger Abtreibung
unbilliger Gewalt» (der Volksrechte!), «der von Gott ihr gegebenen
Macht sich bedienen und jede ungerechte Bedrückung» (der Regierung
durch das Volk!) «von sich und den treuen Unterthanen abzuwenden
wissen»! In der Tat stellte der Berner Rat schon tags darauf
die Sache dem «Worte Gottes» anheim. Bögli berichtet: «In Bern erliess
die Regierung am 19. Mai auf die Forderungen der Bauern ein von
Geistlichen abgefasstes Manifest und gab die Ansicht kund, nach erschöpften
Friedensversuchen zu den Waffen zu greifen.»
Auch die Herren also hatten, und zwar ganz gleichzeitig, ein Ultimatum
an die Bauern geschickt, wenn auch ohne Kalenderfrist. Als
Leuenberger es am 19. Mai aus seiner Heimreise von Langenthal erhielt,
antwortete er von Niedergoldbach bei Burgdorf aus im Namen
der Bauern nur kurz: «dass sie es lediglich bei ihrer vorigen Tags gegebenen
Resolution» (ihrem, auf den 20. befristeten Ultimatum) «und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 448 - arpa Themen Projekte
Leuenbergers Verhöhnung in den Strassen Berns bei
seiner Einbringung als Gefangener am 12. Juni 1653
Volkstümliche Darstellung aus dem Schweizerischen Bilderkalender
des Jahres 1840 von Martin Disteli.
"Vor Eintritt in die Stadt Bern ward ihm ein hölzerner Degen
und eine aus Stroh geflochtene Schärpe angelegt, und es wurde
sonst noch allerlei Spott mit ihm getrieben."(Vock). "Am 12. Juni
hat man Niclauss Löwenberger, den Ertzrebellen und Landtshauptmann
mit noch 37 anderen Rebellen gfängklich alherr,
durch 100 Musquetirer gebracht, Löwenberger ward an einer
Kette angefesslet, die andern alle an einem Seil an einanderen
gebunden, in die Gefangenschaft by dem oberen Spital, Titligers
Thurm genampt, gelegt worden. Löwenberger hat man von dem
Thurm wider die Statt hinab zu dem Statschlosser gefürt, der
ihm beide Armen hatt zusamen verschlossen."(Tagebuch eines
Augenzeugen, des Berner Griechisch-Professors Berchtold Haller;
publiziert: Berner Taschenbuch 1904, S. 123 ff.)
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 448 - arpa Themen Projekte
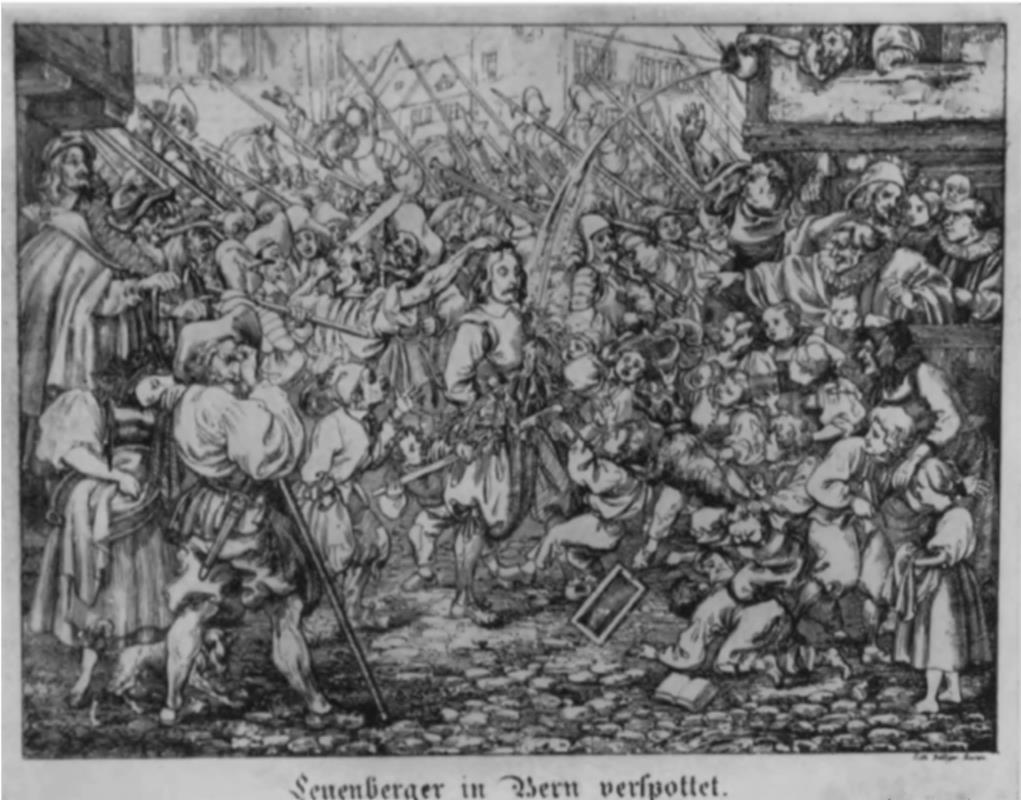
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 449 - arpa Themen Projekte
dem Inhalte ihres Schreibens vom 18. (soll heissen: 17.) Mai verbleiben
lassen». Als Mitverfasser dieser kurzen Mitteilung werden in dieser
selbst erwähnt: Uli Galli und Hans Rüeggsegger! Diese beiden Kämpfer
der alten Thuner Garde also, Exponenten des revolutionäreren
Flügels der Bauern, beides Kriegsräte Leuenbergers, treten damit zum
erstenmal in diesen Tagen als unmittelbare Mitverantwortliche und
zweifellos als revolutionäre Gewissenschärfer der Bundesleitung hervor.
Ihnen wird es zu verdanken sein, dass wenigstens das Ultimatum
in Kraft blieb und keine Wiedererwägung auf Grund des neuen Herrenbriefs
den Zögerer Leuenberger wieder ins Schwanken brachte.
Ausserdem fällt auf diesen 19. Mai eine Zusammenkunft zwischen
Leuenberger und Emmenegger! Eben zu diesem Zweck wird Leuenberger
an diesem Tag von Langenthal nach Schönholz zurückgekehrt
sein. Gern wüssten wir mehr über diese sicherlich sehr wichtige Unterredung.
Aber Liebenau, als Einziger, weiss darüber nur zu berichten:
«Nach dem Tage in Schüpfheim begab sich Pannermeister Emmenegger
zum Obmann des Bauernbundes, einerseits um denselben von
den Verhandlungen mit Luzern zu unterrichten und andrerseits um
die gemeinsamen Massregeln gegen Bern und Luzern zu besprechen.»
Nach dem zu schliessen, was Hans Emmenegger am Tag zuvor dem
Schultheiss Dulliker gegenüber geleistet hatte, kann jedoch auch diese
Unterredung für Leuenberger nichts anderes als eine revolutionäre Gewissensschärfung
gewesen sein. Im übrigen wurde hier zweifellos auch
der Zuzug der Entlebucher und Willisauer zu dem für den 21. geplanten
allgemeinen bernischen Landsturm verabredet.
Die im Ultimatum der Berner Bauern gestellte Frist, der 20. Mai,
lief ab, ohne dass ein weiteres Wort von den Berner Herren eingetroffen
wäre. Dafür hatten diese sich inzwischen mit dem Vorort in
Verbindung gesetzt — und jetzt wurde, genau am 20., jenes zweite
Badische Schimpf mandat gegen die Bauern, das am 8. Mai von der
Tagsatzung beschlossen, aber noch zurückbehalten worden war, in
allen eidgenössischen Orten losgelassen und auch im Ausland publiziert.
Das war das Sturmzeichen, dass die Herren jede Hoffnung aufgegeben
hatten, die Bauern ohne Krieg unterwerfen zu können. Darin
hiess es ja, erinnern wir uns hier nur an diesen Kernsatz: «Weil...
Unsere Unterthanen... diese Unsere, bei hohen Ständen althergekommene
Submission (Unterwerfung!) in den Wind geschlagen und verworfen...,
haben wir anders der Sache nicht helfen können, als die
Waffen mit Gottes Hilfe zu ergreifen»! Weit entfernt davon aber, die
Bauern einzuschüchtern, goss das Manifest überall nur Oel ins Feuer.
Genau dasselbe bewirkten natürlich die nun von den Herren offen und
fieberhaft betriebenen Kriegsrüstungen.
Unter den zahlreichen Nachrichten und Gerüchten darüber, die
das Land kreuz und quer durcheilten und die durch die von den
Bauernwachten aufgefangenen Herrenbriefe immer neue und immer
aufregendere Nahrung erhielten, hat nichts die Volksstimmung in der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 450 - arpa Themen Projekte
Gerücht, «dass fremde Völker aus Burgund und Lothringen ins Land
eindringen» wollten, «um alles zu verwüsten», wie Vock sagt. Dass dies
kein «leeres Gerücht» war, wie manche Herrenchronisten jener und
unserer Zeit gerne Glauben machen möchten, geht schon aus den Verhandlungen
hervor, die, wie wir wissen, die Basler Regierung bereits
im April mit dem französischen Gouverneur von Breisach, dem Grafen
d'Harcourt, betreffend Hilfstruppen führte, die von diesem damals
denn auch «auf erstes Verlangen zugesichert wurden». Nun wurde
aber, wie Heusler berichtet, vom Basler Rat neuerdings am 17. Mai zu
demselben Zweck der «Ratsherr Ben. Socin nach Breisach abgeordnet,
wo er folgenden Tags vom Kommandanten, Henry de Lorraine, comte
d'Harcourt, grosser Dienstwilligkeit versichert wurde». Und zwar
handelte es sich diesmal um einen ganz anderen Umfang der Hülfe:
wie der venezianische Gesandte in der Schweiz in einem Bericht an
seine Regierung von Ende Mai schrieb, um nicht weniger als «zweitausend
Reiter»! Das waren natürlich schwer bewaffnete, modernst
ausgebildete und kriegsgewohnte Truppen, wie es sie in der Schweiz
gar nicht gab und die für sich allein ein ganzes Bauernheer aufgewogen
hätten. Die Furcht der Bauern gerade vor solchen Hilfstruppen der
Herren war also vollauf gerechtfertigt. Uebrigens machte sich der
Graf d'Harcourt noch dazu anheischig, sie persönlich in die Schweiz
zu führen.
Noch am Mittwoch, den 21. Mai, «befasste sich», wie Peter berichtet,
der Basler Rat — unter der Führung des sittenstrengen «Patrioten»
Wettstein! — «mit der Frage, ob man das Anerbieten des Grafen
d'Harcourt, persönlich mit einer Anzahl» (2000!) «Reiter zur Unterstützung
der Regierung herbeizueilen, annehmen wolle»! Dass es
nicht dazu kam, liegt nur daran, dass zufällig in Basel eine eidgenössische
«Ehrengesandtschaft» — zum Zwecke einer, allerdings völlig
vergeblichen, weil von den Basler Bauern rundweg abgeschlagenen
«Vermittlung» — anwesend war. Erst nachdem diese Gesandten,
Statthalter Hirzel und Bergherr Lochmann von Zürich und Bürgermeister
Ziegler und Oberst Neukomm von Schaffhausen, den Basler
Rat inständigst beschworen hatten, «ja jede Einmischung Fremder in
die Angelegenheit abzulehnen», stand der Rat von diesem Landesverbrechen
ab, das für die ganze Schweiz unabsehbare Folgen hätte haben
können. Davon aber konnten die Bauern, die schon am frühen
Morgen dieses selben Tages zum Landsturm aufbrachen, natürlich
nichts wissen.
So also steht es mit dem «leeren Gerücht» von dem selbst der
Herrenchronist Peter zugeben muss, dass es begründet und dass es
sogar grundlegend für die ganze Haltung der Basler Bauern in der
eben angebrochenen entscheidenden Krise war. Denn Peter schreibt
darüber, und zugleich über die Auswirkung auch auf die Haltung der
übrigen Aufständischen der Schweiz: «Die Untertanen der Stadt Basel
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 451 - arpa Themen Projekte
als sich bei ihnen, wie wir wissen nicht gänzlich grundlos,
die Nachricht verbreitete, die Regierung sei geneigt gewesen, den Grafen
von Harcourt mit zweitausend Berittenen ins Land kommen zu
lassen. Sie gingen daher die Berner und Luzerner Bauern um Hilfe an.
Die Bauern des Schenkenberger Amtes und der Grafschaft Lenzburg
wollten ihnen hierauf sofort zu Hilfe ziehen.»
Ein derart fundiertes 'Gerücht» von einem neuerdings drohenden
«Ueberfall fremder Truppen» — und in diesem Fall noch dazu wirklich
landesfremder Truppen — kam also auch im Bernerland zu
allem übrigen hinzu, um die Volksstimmung zur Explosion zu bringen.
Ganz und gar von dem endlich allgemein ausbrechenden wirklichen
Verzweiflungssturm des Volks gedrängt, gestossen, getragen, musste
Leuenberger am 21. Mai 'den Landsturm ergehen» lassen! Er gab, wie
Vock erzählt, «Befehl, dass schleunigst der Pass bei Gümmenen besetzt
und die Stadt Aarberg wo möglich eingenommen, oder doch streng
eingeschlossen werde». Dies wohl als Sicherung gegen den Einfall aus
Burgund, den man sich als unmittelbar bevorstehend dachte. Denn
Bögli berichtet: «Die Rüstungen der Stadt (Bern) hatten das Gerücht
veranlasst, als ob viele lothringische Truppen von Biel her gegen Bern
zögen. Die Bauern aus den Landgerichten verlangten daher mit Drohungen
das Reisgeld, griffen die Soldaten zu Gümmenen an und waren
entschlossen, alles fremde Volk an den Pässen aufzuhalten.» Vock
erzählt weiter: «In allen Dörfern ertönten die Sturmglocken und liefen
bewaffnete Boten herum, die Bauern aufzumahnen, indem sie vorgaben,
dass fremde Völker aus Burgund und Lothringen ins Land eindringen,
um alles zu verwüsten. Alles Volk rannte Bern und Aarberg
zu...»
Wie das zuging, möge uns hier der echte Bericht eines wirklichen
Augenzeugen berichten, wie ihn Vock abgedruckt hat. Der Verfasser
dieses Berichtes ist der einzige Bauer der Zeit, der eine Chronik des
Bauernkriegs verfasst hat: Jost von Brechershäusern. Aber — das darf
man auch bei diesem Bericht nicht vergessen — es ist ein erklärter
Herrendiener, der ihn schreibt und der sich darin selbst als treuen
Diener «Miner Gnädigen Herren» zu Bern bekennt. Jost schreibt:
«Niemand ist der Meinung g'syn, dass man vor Bern ziehe, solches
ynzenehmen, sondern es war damals ein seltsam Geschrei im
Land, dass viel fremde Völker usa Burgund und Lothringen hat in's
Land fallen wollen, und verderben und durchstreifen. Von dress Geschrei's
wegen hatte man styfe Wacht über und über. Selbige Zyt kam
Minen Gnädigen Herren ein wenig Volk vom Welschland her. So bald
es aber die Dütschen inne wurden, machten sie einen Lärm uff die
Welschen hin. Also fieng es do innen an stürmen und ufmahnen, dass
man es hört und sah von einer Wacht zu der andern, so wyt, dass viel
tausend Mann ufgemahnt wurden, und wussten's mehrern Theils nit,
wo us noch an. Domalen gedachten's mehrteils, es wär das Best, uff
Bern zu; die gemeldten Burgunder, oder wohar sie denn' syen, syen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 452 - arpa Themen Projekte
um Bern und Aarberg, wohl by fünf Tagen, fit zwar der Meinung,
dass man Mine GHerren zu schädigen gedächte. Die Anführer und
Ufwiegler möchten wohl bösen Sinn gehabt haben, aber die andern
nit also, und wussten nit, wie sie endlich wieder mit Glimpf heimziehen
konnten.» —
So also zog Niklaus Leuenberger am 21. Mai als Feldherr an der
Spitze einer Bauernarmee von (nach Peter u. a.) 20000 Mann, meist
Emmentaler und Oberaargauer, mit 14 Kanonen über den Weggisen
auf Bern zu und schlug auf dem Murifeld, zwischen Muri und Ostermundigen,
das Heerlager auf. Trotz der echt bäuerlichen Anarchie im
Aufmarsch, wie sie Jost von Brechershäusern drastisch genug schildert,
hätte diese Bauernmacht zu diesem Zeitpunkt noch genügt, um die
Herren von Bern — vielleicht sogar ohne einen Schwertstreich — nicht
nur zur uneingeschränkten Anerkennung des grossen Bauernbundes zu
zwingen, sondern sogar für immer aus dem Sattel zu heben.
Für einen Bauernführer an der Stelle Leuenbergers, der nur ein
bischen militärischen Schneid, geschweige ein klares politisches Ziel
und einen eisernen Willen zu seiner Durchsetzung gehabt hätte, wäre
tatsächlich in diesem Moment die stolze Bärenstadt, die am meisten
gefürchtete Militärmacht der Schweiz, eine leichte Beute gewesen!
Denn, wie Peter berichtet: «Bern befand sich in einer recht schwierigen
Lage. Zwar waren ja die Rüstungen im Welschland im Gange;
aber noch waren die Truppen weit von der Stadt entfernt, die nur
eine geringe Besatzung, indessen eine willige, kriegstüchtige Bürgerschaft
besass. . besass...»
So «willig» und «kriegstüchtig», wie sie unser Herrenchronist gern
haben möchte, war jedoch auch die Bürgerschaft nicht. Das wird sich
uns aus den Eintragungen eines zeitgenössischen Augenzeugen in sein
Tagebuch über einzelne Ereignisse während der Belagerung erweisen.
Es ist dies ein gänzlich unverdächtiger Zeuge, der Professor Berchtold
Haller, Inhaber des griechischen Lehrstuhls an der damaligen «Oberen
Schule» in Bern, der sicherlich zu den allerwilligsten Bürgern gehörte
und der sich in diesem Tagebuch nicht genug tun kann, auf die «meineidigen
Ertzrebellen» von Bauern zu schimpfen. Vorläufig sei aus dem
Tagebuch nur erwähnt, dass schon am 14. Mai, unter dem Eindruck
der blossen Tatsache der Huttwiler Landsgemeinde, nach Professor
Haller «die ganze Bürgerschaft in grosser Sorg und Kummer gestanden».
Am 21. Mai aber, so trägt er ein, «ward ein grosser Schräcken
und Jammer in der Stadt, wyl die Landlüth by der Gümmenen Bruggen
mit grosser Schwal zusammen geloffen; item die Emmenthaler
sich gegen Münsingen und nach der Statt mit Macht gelassen.. . » Daher
seien Reiter zum Rekognoszieren ausgesandt und die neue Brücke
mit 200 Studenten und Bürgern besetzt worden.
«Indessen», so fährt Peter fort, «begann nun die Belagerung durch
die Bauern, ohne dass Hoffnung auf rasch zu erwartende Hülfeleistung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 453 - arpa Themen Projekte
und der ganzen Ostschweiz, wo der Vorort die Hauptarmee der Tagsatzung
erst noch zu sammeln hatte, war man in Bern vollständig abgeschnitten.
Denn mit Ausnahme von Aarau und Brugg, die aber bald
ebenfalls von Bauerntruppen eingeschlossen und belagert wurden, war
damals, wie Peter berichtet, nicht nur im Oberaargau, sondern auch
im untern Aargau «bereits die ganze Bevölkerung gut bauernbündlerisch
gesinnt». «Nur äusserst spärliche Nachrichten konnten auf Umwegen,
meist durch das Fricktal über Basel und durch das Gebiet des
Bischofs von Basel, ausgetauscht werden. Denn gemäss dem Beschlusse
des Huttwiler Bundes hielten die Bauern, die überall Wachen
aufgestellt hatten, die Läufer der Regierungen auf und nahmen ihnen
die Schreiben ab; auch alle Privatschreiben, die in fremder Sprache
geschrieben waren, wurden zurückgehalten, weil sie möglicherweise
zur Verständigung unter den Regierungen dienen konnten.» Der venezianische
Gesandte in Zürich schrieb darüber an seine Regierung bereits
am 17. Mai: «Der eben zurückgekehrte Kurier berichtet..., es
könne ganz sicher niemand unbeobachtet und undurchsucht durchkommen,
und zugleich habe man, falls diese Canaillen (!) Verdacht
schöpften, das Schlimmste zu gewärtigen.» Daraus erhellt übrigens,
dass wenigstens diese Seite der militärischen Organisation der Bauern
hervorragend gut funktioniert hat.
Zudem bekam Leuenberger ja sofort den Zuzug von seiten der
Entlebucher und der Willisauer, was zweifellos das Ergebnis der persönlichen
Besprechung zwischen Leuenberger und Emmenegger am
19. Mai gewesen ist. Und es muss sich bei dieser Verabredung um eine
dem entlebuchischen Kriegsplan entsprechende, sehr ernsthafte Aktion,
um eine Belagerung bezw. rasche Einnahme der Hauptstadt gehandelt
haben, wenn die Luzerner dazu eine ausgewählte Schar ihrer
besten Kämpfer zur Verfügung stellten. Noch dazu führte der Pannermeister
des Entlebuchs und erwählter «General-Oberster» des Kriegsrats
des Sumiswalder und Huttwiler Bundes Hans Emmenegger persönlich
die Hilfstruppen schon am 21., am Tag des bernischen Landsturms
selbst, ins Emmental. Der Schock muss hart, die Enttäuschung
der Entlebucher und Willisauer, insbesondere Emmeneggers persönlich,
muss gross gewesen sein, als sie da die Gegenbefehle Leuenbergers
erhielten, «am 22. Mai vorläufig nicht über Lützelflüh hinauszuziehen»
und «am 24. bei Habstetten und am Bantiger zu halten». «Leuenberger
liess sie», wie Peter schreibt, «nicht bis ins Lager der Berner Bauern
herankommen... ,da er sich mit den Herren friedlich vergleichen
werde'»!
Da muss inzwischen das schlechte Gewissen und die Furcht des
«fehlbaren Untertanen» in Leuenberger die Oberhand gewonnen haben,
dass er, trotz allem, was er am 19. durch Emmenegger selbst über
die Lage und die Absichten der Luzerner Bauern erfahren hatte, den
ganzen Kriegsplan derselben umstiess und ihnen den Zeitverlust von
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 454 - arpa Themen Projekte
dunklen Episode hat sich vermutlich die entscheidende Tragödie des
Bauernkriegs abgespielt, und alles übrige ist nur eine Folge davon gewesen.
Die Geschichtschreibung weiss uns aber gerade über diese Episode
so gut wie nichts zu berichten; was vielleicht nicht so erstaunlich
ist, da sie sich eben, in ihrer durchgehenden Abhängigkeit von der
Herrentradition, überhaupt nie ernsthaft in die Lage der Bauern zu
versetzen versuchte. Nur gerade Liebenau, der am konsequentesten
auf dem Herrenstandpunkt stehende Geschichtsschreiber des Bauernkriegs,
der ausserdem Alles und Jedes einseitig auf das Interesse der
Luzerner Herren bezieht, verrät wenigstens in diesem partiellen Sinne
etwas von dem Geheimnis dieser Tragödie, die für ihn allerdings eher
eine Komödie ist, über deren Ausgang zugunsten der Luzerner Herren
er naturgemäss frohlockt. Was Liebenau über den Zuzug Emmeneggers
und Schybis zu Leuenbergers Marsch nach Bern schreibt, gibt
zwar nur eine äussere Folge dieses geheimnisvollen Vorgangs an, setzt
durch die Tragweite dieser Folge aber auch die Tragweite der Ursache
ins Licht. Er schreibt: «Durch diese Diversion wurde die Stadt Luzern
aus der grössten Gefahr befreit, die Antwort des Landes Entlebuch auf
das Ultimatum Luzerns wurde verzögert, die Aemter trennten sich und
die Hilfstruppen der Luzerner konnten anrücken.» Wie sehr Liebenau
mit alledem Recht hat, haben wir schon im vorigen Kapitel erfahren.
Aber die Tragödie liegt nicht darin, dass der kampfentschlossenste
Auszug der Entlebucher und der Willisauer momentan von Luzern
ab- und Bern zugezogen war; vielmehr darin, dass Leuenberger, der
Oberbefehlshaber der ersten, zum geschichtlichen Zuge gelangten
Bauernarmee, mit den Entlebuchern zugleich alle Kampf entschlossenheit
von seiner Armee fernhielt! Statt nämlich nach dem Plan der
Entlebucher die Stadt Bern sofort mit gesamter Macht zu berennen,
um sich dann, nach demselben Plan, vereint gegen Luzern zu wenden
— dem einzigen Kriegsplan, der selbst jetzt noch einen siegreichen
Ausgang für die Bauern versprach —, legte Leuenberger seine ganze
militärische Macht brach und begann vom ersten Tag an mit den Herren
zu «verhandeln»! «In der Tat», schreibt Peter, «knüpfte Leuenberger
mit dem Rate von Luzern sofort Unterhandlungen an und befahl
seinem Heere, sich ruhig zu verhalten.» «Sobald Leuenberger am
21. Mai», schreibt Vock, «mit seinem Heerhaufen in Ostermundingen
angekommen war, sandte er sogleich einen Boten nach dem andern in
die Stadt an die Regierung, mit der Erklärung, er sei mit seinen Verbündeten
vor die Stadt gekommen, um die noch streitigen Artikel zu
erörtern (!) und womöglich Frieden mit der Oberkeit zu schliessen; sie
sollten daher Gesandte zur Unterhandlung mit ihm herausschicken.
Sie tat es noch am nämlichen Tage, und die Zusammenkunft fand in
einem Landhause bei Ostermundigen statt; allein die Forderungen der
Bauern, die durchaus auf ihrem Ultimatum vom 17. Mai» (d. h. auf
der oben im Wortlaut wiedergegebenen Beschwerdefrist von diesem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 455 - arpa Themen Projekte
befunden (!), und die Gesandten der Regierung kehrten unverrichteter
Dinge zurück.» Leuenberger aber hatte ihnen einen derart ungefährlichen
Eindruck gemacht, dass der Rat nicht einmal für nötig hielt,
die Stadttors schliessen zu lassen.
So ging es nun Tag für Tag zwischen Leuenberger und dem Berner
Rat hin und her — ein wahrhaft vom Himmel gefallenes Glück
für die Herren! Denn diese konnten nun hinter der künstlichen, von
Tag zu Tag verdichteten Nebelwand der «Verhandlungen» über die
«noch streitigen Artikel» ihre Truppenzusammenziehung im Rücken
der Bauern ungestört vollenden. Dadurch aber vermochten die Herren,
das ganze Machtverhältnis, das sich durch die plötzliche Massenerhebung
erdrückend zugunsten der Bauern gewandt hatte, im Verlauf von
kaum einer Woche völlig ins Gegenteil umzustürzen!
In den ersten Tagen der «Belagerung» allerdings wuchs die Heeresmacht
der Bauern sogar noch ständig an. Noch «am 22. Mai wurde»,
wie Vock berichtet, «Leuenbergers Heer durch den Zuzug der Bauern
aus den Aemtern Wangen, Aarwangen und Bipp bedeutend verstärkt.
Erst am 23. Mai, als die mit jeder Stunde anwachsenden Kriegsscharen
der Bauern in den der Stadt nahe gelegenen Häusern zu plündern
(?) anfingen, liess die Regierung die bisher immer offen gebliebenen
Stadttors schliessen und die umliegenden Anhöhen mit Truppen
und grobem Geschütz besetzen. Leuenberger, hierüber erschrocken (!)
bat am gleichen Tage durch wiederholte Zuschriften um Abordnung
einer neuen Regierungsdeputation, damit man sich vergleichen könne..»
Wahrlich, ein Stratege, gar ein Feldherr oder ein Kriegsheld war der
fromme Stündeler nicht! Von einem Revolutionär gar nicht zu reden...
Weder mit den ihm in den ersten Tagen von allen — und oft ganz
unerwarteten — Seiten zuströmenden militärischen Hilfskräften, noch
gar mit den im eigenen Bauernlager sich entfaltenden revolutionären
Kräften wusste Leuenberger auch nur das geringste anzufangen. Die
Entlebucher und die Willisauer, die beides waren, hielt er, wie wir
sahen, durch Gegenbefehle absichtlich von seinem Lager auf dem
Murifeld fern — als wären sie die Pest für seine Leute! Als die Lenzburger,
die im Verein mit den andern Unteraargauern Aarau und
Brugg eingeschlossen hatten, Leuenberger aufragten, «ob sie die Stadt
Aarau angreifen sollten», da befahl er ihnen, wie Bögli berichtet, «Niemand
zu beleidigen, da man Frieden schliessen werde»! Schon am
21. Mai sammelten die rührigen Steffisburger, unter Leitung der beiden
Kriegsräte Statthalter Hans Berger und Seckelmeister Christian Zimmermann,
Zuzug aus dem ganzen Oberland, das gar nicht im Huttwilerbund
war, und liessen sie «zu Almendingen campieren». Dabei
gingen ihnen eine ganze Reihe hervorragender Helfer in allen Teilen
des Oberlandes in unerwartet eifriger Weise an die Hand. So Jakob
Rieder, der Grossweibel von Frutigen, der «gegen die Obrigkeit das
Mehr ergehen» liess und dem Landesvenner befahl, «dem Kastlan (von
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 456 - arpa Themen Projekte
hatte Rieder in dem überzeugten Parteigänger des Bauernbunds
Hans Gämpeler, ebenfalls in Frutigen, eine tatkräftige und offenbar
besonders kluge Stütze; sagte dieser doch: «die Obrigkeit schicke Gesandte
und Schreiben ins Land, (nur) um sie (die Bauern) aufzuhalten,
damit sie (die Obrigkeit) ,fremdes Volk' hineinbringen und sie (die
Bauern) zu Leibeigenen machen könne». Aehnlich wirkte in Zweisimmen
Benedikt Zeller, der durch das Volk beschliessen liess, «dass man
«die glattig und gleissner ausreutte». Ganz ebenso in Faltschen bei
Aeschi Kaspar Rubin, der sagte, «die Buwren sollen die Häupter nur
zusammenhalten; sie zu Aeschi fragen weder Landesvenner noch
Statthalter Nut nach... Die Herren von Bern in der Statt und uff dem
Land seien alle Verräter an den Landlüten worden»! In gleichem Sinne
wirkte der «Ertzrebell» Hans Gorner in Grindelwald, der den vom
Berner Rat zur Abmachung ins Oberland delegierten Venner Stürler
schmähte, dutzte und ihm zurief: «er halte sich selbst für ebenso gut
wie er sei». Eine ganz besonders starke Stütze zur Mobilisierung des
Oberlandes hatten die radikalen Steffisburger Kriegsräte in Hans Rieser
in Oberried bei Brienz. Das war ein echter Revolutionär mit kühner,
selbständiger Initiative. Rösli berichtet von ihm: «Er organisierte den
Aufstand im Oberland. Er hatte sich von der Gemeinde Brienz zur
Landsgemeinde nach Sumiswald abordnen lassen, wo er den Bund beschwor.
Zu Hause las er eine Abschrift desselben vor, liess die Gemeinde
ebenfalls schwören, schickte in alle Gemeinden Kopien, auch
ins Haslital, und suchte die Bauern gegen das ,frömde Volck' bei der
Gümmenenbrücke zu mobilisieren... Am Sonntag vor der Auffahrt
(alten Stils) versammelte er die Brienzer, Grindelwaldner, Ringgenberger,
Böniger u. a. und liess sie schwören, der Obrigkeit keine Hilfe zu
leisten»! Er erlitt dafür dann auch den Henkertod...
Von all diesen völlig neu in den Kampf eintretenden Kräften
wusste Leuenberger nicht den geringsten Gebrauch zu machen —
kein Befehl Leuenbergers erreichte sie, ihm sofort zuzuziehen! Dagegen
schickten die Berner Herren schon am 21. Mai Ratsgesandte nach allen
Seiten, um die Bauernaufgebote zu sabotieren: so den Schultheissen
Dachselhofer und den Seckelmeister von Werbt «zu den uff Gümmenen
zu gerochleten unsinnigen Bauten..., dieselben zu appaisieren...»;
aber auch den Ratsherr Huser, um «ein gleiches by den zu
Almendingen campierten Völckern zeverrichten».
Was den «Feldherrn» der grössten je in der Schweizergeschichte
zu revolutionären Zwecken zusammengeströmten Bauernarmee in diesen
entscheidungsvollen Tagen beschäftigte, waren lächerliche Lappalien.
Ein Beispiel dafür gibt Bögli: «Vor der Stadt Bern kam es zu
keinen Tätlichkeiten. Bloss einige Gefangene wurden beiderseits gemacht.
Am 23. Mai forderte Leuenberger die Herausgabe von drei Gefangenen
aus Langnau und eines Trommelschlägers, da das Volk ergrimmt
sei»! Ein schlagender Beweis dafür, wie Leuenberger gar nicht
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 457 - arpa Themen Projekte
zugleich dafür, dass er noch weniger begriff — und vielleicht noch
weniger begreifen wollte —, was der «Grimm» der Bauern bedeutete,
den er sich durch Befreiung dreier Gefangener und eines Trommelschlägers
glaubte vom Hals schaffen zu können...
Aus allem geht hervor: Leuenberger fürchtete Alles, was er als
Kraft in den Kampf hätte werfen sollen! Ihm war das Anwachsen der
bäuerlichen Heeresmacht geradeso unheimlich wie das Anschwellen
des revolutionären Volksgrimms. Vor der Notwendigkeit der Gewaltanwendung
schrak der «fehlbare» Untertan in ihm im entscheidenden
Augenblick zurück. Der religiöse Sektierer in ihm zeigte dem «fehlbaren»
Untertan einen trügerischen Ausweg zur Flucht vor der furchtbaren
Verantwortung; den Weg in eine Welt, in der Lamm und Leu
friedlich nebeneinander grasen: er wollte die «gerechten» Forderungen
der Bauern durch den «Frieden» und die «Versöhnung» mit dem, was
den Gnädigen Herren «gebührt», verwirklichen. In panischer Angst vor
der Gewaltanwendung, vor Krieg und Revolution, wich Leuenberger
auf diesen Weg aus, den es in der Wirklichkeit gar nicht gab — und
rannte blindlings mitten in die Kapitulation, der Gewalt der Herren in
die Arme! Denn den «Frieden» mit den Herren konnte er nur gegen
Niederlegung der Waffen und neue, bedingungslose Huldigung — und
das hiess: gegen Abschwörung des Bundes erhalten! In beides willigte
Leuenberger ein — und damit brach er sich selbst moralisch das Genick,
der ganzen Macht des Bundes aber politisch und militärisch das
Rückgrat!
So kam also der 24. Mai, der in diesem tragischen Sinn durchaus
entscheidende Tag im ganzen Bauernkrieg. Dabei schien kein anderer
Tag die Macht, ja den Sieg der Bauern über die Herren nach aussen
hin strahlender und handgreiflicher zu verkünden. Die Herren von
Bern hatten eine besonders feierlich-geistlich aufgezogene Ratsdeputation
ins Bauernlager auf dem Murifeld herausgeschickt — als hätten
sie den spezifisch religiös gefärbten Respekt Leuenbergers vor der
Obrigkeit zur Leimrute für diese entscheidenden Verhandlungen machen
wollen. An der Spitze der Delegation stand der eine der beiden
Bürgermeister, und zwar nicht etwa das amtierende Haupt der Kriegspartei,
Graffenried — der hatte inzwischen fieberhaft die militärische
Uebermacht zu organisieren —; vielmehr der Altbürgermeister Dachselhofer,
den man stets für besondere «Friedens-Zwecke in Bereitschaft
hielt. Ihn begleiteten die beiden obersten Theologen der bernischen
Staatskirche, die bereits der Gesandtschaft nach Huttwil und
Langenthal angehört hatten (und dies natürlich auch dort nicht ohne
schlaue Berechnung der geistlichen Hörigkeit der grossen Masse der
Bauern, inbegriffen Leuenbergers): der Stadtpfarrer Heinrich Hummel,
der «Vorstehende göttliches Worts», und Christoph Lüthard, «der
Theologie Professor», das grosse gelehrte Kirchenlicht der bernischen
Kirche. Aber es haben, wie der damalige Griechisch-Professor Berchtold
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 458 - arpa Themen Projekte
«etliche der Räthen wie auch der Zweihunderten (des Grossen Rates)
noch etlicher Puncten halben by dem Muri-Hölzli unter dem frien
Himmel parlamentiert und daselbst den Fryden uff Ratification der
Oberkeit geschlossen».
Aber die Herrenquellen — Bauernquellen gibt es ja nicht — verstummen
merkwürdig hartnäckig, sobald es sich um die Schilderung
dieser entscheidenden Verhandlungen dreht. Nur aus späteren, höchst
zufällig und fragmentarisch auf diese Vorgänge sich beziehenden Verhörprotokollen
über Aussagen gefänglich eingezogener Bauern lassen
sich einige Streiflichter darüber gewinnen; sowie, wenn auch indirekt,
durch Schlüsse aus einigen nachträglichen Reaktionen der Herren; vor
allem aber aus dem sehr zwiespältigen Verhalten der Bauern unmittelbar
während und nach diesen Verhandlungen.
Allein nach scheint Leuenberger grosse Mühe gehabt zu haben, den
Zorn und den Uebermut der Bauern soweit zu zügeln, dass die Verhandlungen
überhaupt durchgeführt werden konnten. Andererseits
muss die Herren «Ehrengesandten» des Rats die ihnen zugemutete Demütigung
nicht weniger hart angekommen sein. Doch hatten die Berner
Herren gar keine Wahl: sie mussten um jeden Preis einen möglichst
raschen Abzug der Bauern von der Stadt und womöglich deren
Waffenniederlegung zu erzielen suchen, wenn sie eine wirklich schützende
Armee in ihre Mauern bekommen wollten. Denn selbst wenn
die vom Westen her anrückende Truppenmacht der Herren bereits
angriffsbereit gewesen wäre, so hätte sie die Bauern doch nur vom
Rücken her überfallen können; ein solcher Ueberfall aber hätte vorläufig
nur den grollenden Vulkan der Volkswut im Bauernlager vor
Bern unverzüglich verheerend in die nur ganz unzulänglich bewehrte
Stadt entladen, und dabei wäre sicherlich kein Stein auf dem andern
und kein Herr am Leben geblieben! Nur wenn die Bauern, wie auch
immer, zum Abzug bewogen werden konnten, war es möglich. Bern
zur uneinnehmbaren Basis für die kriegerische Niederwerfung der
Bauern zu machen.
Andererseits aber befürchteten auch die Bauern von Tag zu Tag
das Eintreffen der Herrentruppen in ihrem Rücken. Es ist sehr verständlich,
ja selbstverständlich, dass unter dem Druck dieser Situation
gerade der revolutionäre Flügel im Bauernlager einen mächtigen Aufschwung
nahm! Denn es ist klar, dass die Revolutionäre nicht erst
einen Angriff im Rücken abwarten konnten, wenn sie, wie das zweifellos
ihr Plan war, sich der Stadt bemächtigen und auch im Besitz
derselben bleiben wollten, um eine Neuordnung der Macht im Sinne
der Bauernziele zu errichten. Ebenso klar aber ist, dass alle Geschichten,
die uns die Herrenfedern darüber zu berichten wissen — und
dazu gehören auch sämtliche Verhörprotokolle, die sogenannten «Vergichte»
der später gefangenen und unter unmenschlichen Marterqualen
zu Aussagen gepressten Bauernführer —, nichts als grobe Entstellungen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 459 - arpa Themen Projekte
die sich die Revolutionäre im Bauernlager auf dem. Murifeld gemacht
haben mögen. Sie spiegeln getreu nur die ausgestandene Angst der
Herren und ihr moralisches Niveau in der Beurteilung dessen wieder,
wessen die Bauern möglicherweise fähig gewesen wären. Immerhin
können wir diesen Nachrichten wenigstens ungefähr entnehmen, wer
die Führer des revolutionären Flügels waren; oder vielmehr nur:
welche von den Bauernführern den Herren als solche erscheinen.
Manche, die durch ihr wildes, anarchistisches Gebaren nur am meisten
Geschrei um sich verbreiteten und den Herren den grössten Schrecken
einjagten, sind von diesen letzteren zweifellos überschätzt worden; die
wahren Führer der revolutionären Partei aber haben sie ebenso zweifellos
nicht ihrem eigentlichen Wesen nach erkannt, sondern sie mit den
Hauptkrakeelern zusammen in denselben Kratten geworfen.
Nur unter all diesen unerlässlichen Vorbehalten können wir hier
das Zerrbild von der revolutionären Partei der Bauern im Feldlager
vor Bern wiedergeben, wie es die Herrentradition geschaffen hat, und
zwar in der relativ noch milden Form, wie der mit den Bauern (jedoch
ganz spezifisch mit der verhandlungsseligen «Friedens»-Partei
Leuenbergers!) «sympathisierende» Bögli das Bild zeichnet. Es ist
hauptsächlich nach dem «Vergicht» Johann Konrad Brönners gearbeitet.
Wir müssen deshalb hier noch einen weiteren Vorbehalt anbringen,
den Bögli zu machen vergisst, den aber Rösti in den Worten formuliert:
«Die Angaben Brönners im Verhör sind allerdings mit Vorsicht
aufzunehmen, da nicht ausgeschlossen ist, dass er andere vor Gericht
belastete, um sich zu entlasten.» Das ist leider ein durchgehender
Zug bei fast allen «Vergichten' der Bauernführer, so wie sie uns von
den Herren hinterlassen worden sind! Eine Garantie für deren objektive
Richtigkeit haben wir aber in keinem einzigen Fall. Bögli also
schreibt:
«Die Kriegsräte (Leuenbergers) waren zum Teil Hitzköpfe, die mit
Mühe vom Obmann im Zaum gehalten wurden. Die verwegensten Ratschläge
gingen von ihnen aus. Statthalter Berger, Uli Galli, der Bergmichel
(Michel Aeschlimann), Christen Zimmermann und Andere sprachen
davon, die Stadt Bern auszuplündern (sic!), die Gültbriefe vernichtet
herauszuverlangen' (das war der springende Punkt, vor dem
die Berner Herren nicht weniger zitterten als die Luzerner Herren!),
«ja in Bern vollständige Anarchie einzuführen (sic!). Laut dem Vergicht
Brönners sollten nach ihren verderblichen Plänen nach der Eroberung
der Stadt Leuenberger und Daniel Küpfer Schultheisse werden,
Uli Galli Seckelmeister, der Bergmichel Venner und Brönner Gerichtsschreiber.
Alle Männer der Bürgerschaft sollten niedergemacht,
die alten Weiber fortgeschafft und nur die jungen Weibspersonen in
der Stadt behalten werden» (sic!). Besonders dies letztere ist eine typische
Panik-Phantasie der Herren, die sie sich bei späteren Verhören,
zur Rechtfertigung ihrer Grausamkeit bei der Niederschlagung und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 460 - arpa Themen Projekte
«Geständnisse», die durch Marterverhöre, bei denen Suggestivfragen
eine entscheidende Rolle spielten, leicht zu erpressen waren.
Zweifellos war Uli Galli von Eggiwil, der erste Urheber der ganzen
Bauernbewegung im Kanton Bern, auch der führende Kopf des
revolutionären Flügels im Kriegsrat Leuenbergers vor Bern. Er war es
gewesen, der — wie Rösli berichtet — zusammen mit Statthalter Hans
Berger von Steffisburg auf der Landsgemeinde in Langenthal am 16.
Mai gegen den beschränkteren Plan Leuenbergers den Plan der Belagerung
Berns — und damit den Kriegsplan der Entlebucher — durch
gesetzt hatte. Hans Berger war es nun, der im Sinne der revolutionären
Partei bei den Verhandlungen mit der Ratsdeputation am 24. Mai den
Antrag stellte, den Berner Herren 50000 Pfund Kriegsentschädigung
abzufordern und damit auch bei Leuenberger durchdrang. Hans Berger
war überhaupt, nach Rösli, «einer der einflussreichsten Kriegsräte
Leuenbergers; seine Vorschläge wurden meistens angenommen». Darin
sind beide, Uli Galli und Hans Berger, zweifellos durch Christen Zimmermann,
den Seckelmeister und Wirt von Steffisburg, «einen der
eifrigsten ,Rebellen'», heftig unterstützt worden, der ein alter Mitkämpfer
Uli Gallis schon beim «Thuner Handel» war. Aber auch andere,
von Bögli in der eben zitierten Stelle nicht als Urheber des
Greuelplans genannte alte Thuner Kämpfer, gehörten im Bauernlager
vor Bern zu den ausgesprochen revolutionären Kriegsräten: der uns
wohlbekannte Hans Rüeggsegger, der Weibel von Röthenbach, der auch
mit Hans Berger nah befreundet war, ganz ebenso wie natürlich Daniel
Küpfer. der alte Schmied von Grosshöchstetten, jetzt in Pfaffenbach
bei Langnau, der ebenfalls dem Kriegsrat angehörte und ausserdem
in der Bauernarmee den Rang eines Hauptmanns bekleidete;
aber auch der «sehr reiche Bauer» Hans Wüthrich, der Seckelmeister
«des Landes Aemmenthal» aus Brandösch bei Trub, der das ganze
Trüber Tal auf die revolutionäre Seite brachte und ebenfalls bereits
1641 an Uli Gallis Seite gekämpft hatte. Ja sogar Leuenbergers intimer
Freund Lienhart Glanzmann, der Wirt von Ranflüh, gehörte «als
eifriger ,Rebell'» dem Kriegsrat an und war Kommandant der Bauerntruppen
bei der Neubrücke vor Bern, bis er dort verwundet und von
Daniel Küpfer im Kommando abgelöst wurde. Offensichtlich schlossen
sich diese und viele andere revolutionäre Führer eng um Uli Galli als
ihr anerkanntes Haupt zusammen, als welches er auch in der grossen
Masse der Bauern galt. Drang ein Vorschlag der revolutionären Partei,
wie die Forderung der Kriegsentschädigung, durch, so hiess das «ein
durch Uli Galli gemachtes Mehr»; auf welches sich beispielsweise der
Wirt von Walkringen, Hans Grüssi, berief, als er später — wie noch
so manche andere — deshalb «ins Schellenwerk verurteilt» wurde, weil
«er sich gegen die Ehrengesandten der Stadt auf dem Murifelde unehrerbietig
und ,bösartig' benommen habe».
Ganz und gar nicht in die Kategorie der eben aufgeführten, ausgesprochen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 461 - arpa Themen Projekte
gehört der von Bögli und von allen Herrenchronisten stets in einem
Atemzuge genannte «Bergmichel», wenn er auch — als einer der
Jüngsten — dem Kriegsrat angehörte. Michel Aeschlimann von Blasen
im Amte Trachselwald war gewiss in seiner Art ein Mords- und
Prachtskerl. Aber in ihm brach stets nur die völlig ungezügelte, anarchische
Volkskraft hervor, der blosse Rohstoff einer jeden Revolution.
Insofern kommt ihm sicherlich gerade in einer bäuerlichen Revolution
eine gewisse symbolhafte und seinen Handlungen eine symptomatische
Bedeutung zu: als Verkörperung des oft erstaunlich falsch
funktionierenden Instinktes der grossen Masse der Bauern; gepaart
mit einer überdurchschnittlichen Kraft und Tollkühnheit, aber auch
mit berserkerhafter Wut bis zur sinnlosen Raserei.
Bezeichnend für seine Art, auf die Ereignisse zu reagieren, ist eine
Szene, die Rösli erzählt und die am 25. Mai, mithin direkt nach dem
Abschluss des ersten Leuenberger «Friedens» vom 24., passierte: «Am
Sonntage während der Belagerung Berns wollte er (der Bergmichel)
zur Predigt-Zeit mit einigen Gleichgesinnten, gegen den Willen Leuenbergers,
das Schänzli, wo sich der Vogelherd befand, stürmen und
konnte nur dadurch zurückgehalten werden, dass man ihn fesselte»!
Einer der «Gleichgesinnten» war beispielsweise Christen Augsburger,
ein 40 jähriger, «ganz schwarzer», baumstarker Mann, ein Salpetergraber
und der «fürnembste unter den Zöümeren zu Langnauw, auch
der flyssigste Botschaftstreger ins Aendtlibuch», mithin ein offenbar
am entlebuchischen Beispiel, und zwar nach dem Vorbild des Haudegens
Schybi im benachbarten Escholzmatt, geschulter, echter Rebell.
Ueberhaupt kann das Verhältnis des Bergmichels und seiner Schar zu
Uli Galli und den Seinen füglich mit dem Schybis zu den anderen
Entlebucher Führern verglichen werden: er war der Berner Schybi!
Da der Bergmichel der Truppe Lienhart Glanzmanns, die die Neubrücke
bewachte, angehörte und dieser sein militärischer Vorgesetzter
war, so wird es Glanzmann selbst gewesen sein, der ihn überwältigen
lassen musste. Das wäre jedoch nicht die einzige Distanzierung eines
der revolutionären Häupter vom Bergmichel. Eine solche liegt vielmehr
auch in einem Ausspruch Uli Gallis selbst vor, der von ihm sagte:
«dass der Bergmichel eine rawe Haut gsyn sye, so jederwylen angriffen
und dreinschlagen wollen».
Natürlich hatte Leuenberger erst recht allen Grund, sich über
diese «rauhe Haut» zu beklagen. Solche «rauhen Häute» in stets wachsender
Zahl — nicht nur auf dem Murifeld, sondern weit im Schweizerland
herum — haben ihm ja schliesslich den ganzen schönen, von
ihm vermeintlich unter Dach gebrachten «Frieden» mit den Herren
von Grund aus wieder verdorben. Es ist darum wirklich von symptomatischer,
ja geschichtlicher Bedeutung, was Leuenberger in seinem «Vergicht»
später über den Bergmichel aussagte: «dass er auf dem Murifelde
,alzyt angestiftet' und ihm gedroht habe, wenn er es nicht mit
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 462 - arpa Themen Projekte
redete der Bergmichel, seinem Wesen gemäss, nur brutal offen heraus,
was eine grosse Masse anderer, ganz gewiss aber die gesamte revolutionäre
Partei im Bauernlager, in dem Augenblick dachte, als ihnen
klar zu werden begann, was Leuenberger an diesem 24. Mai aufs Spiel
setzte, als er seinen ersten «Frieden» mit den Herren machte...
Es musste für Leuenberger qualvoll peinlich sein, die Herren
«Ehrengesandten» des Rats in dem von Tausenden aufgeregter Bauern
wimmelnden Lager auf Schritt und Tritt vor Insulten oder gar Tätlichkeiten
schützen zu müssen. Ueber den «Frieden» wurde ja im Beisein
Aller «unter dem freien Himmel parlamentiert». Da fielen wohl
etwa Sprüche wie der des «argen Aufwieglers» Hans Wali von Bolligen:
«die Herren seien einist gnug Herren gsin, es werd jetz an den
Bauten auch sein!» Oder Drohungen wie die des «Provianttransportierers»
Jost Greller aus Niederwil bei Wichtrach: «Die Herren müssen
jetzt auch thun, was wir, die Buren, wollen, oder die Stadt werde
in drei Tagen under obsich kehrt werden, denn der Gwalt seye vorhanden!»
Wenn nicht gar ein stämmiger Senn aus dem Berner Oberland,
wie der Hildebrand Burgener aus Grindelwald, dabeistand und
jedem, der zur Obrigkeit halte, mit trockenem Grimm drohte, «die Hosi
aben ze lassen»! Das sind zwar alles Aussprüche, die vielleicht nicht
exakt bei dieser Gelegenheit gefallen sind, aber echte Bauernsprüche
dieser Tage, die für die allgemeine Volksstimmung charakteristisch
sind. Und diese wird auf dem Murifeld eher «rässer» als sanfter gewesen
sein. Und wenn der Bauer Bendicht Göüffi von Bibern ganz zu
gleicher Zeit bei der Wacht an der Gümmenenbrücke «den Vogt von
Laupen beim Kragen genommen» und ihm ins Gesicht geschrien hat:
«Und Ihr habt lang genug regiert, wir wollen auch einmal regieren!»'
— so könnte sich genau dasselbe am 24. Mai auch auf dem Murifeld
ereignet haben.
Besonders schienen es die Bauern bei diesem Spiessrutenlaufen
der Herren auf dem Murifeld darauf abgesehen zu haben, das Haupt
der Ratsdelegation selbst, den Schultheissen Dachselhofer, aufs Korn
zu nehmen. Der war ja derselbe, der die Bauern schon anno 1641 in
Thun und dann soeben am 4. und 9. April wieder in Bern in die Knie
gezwungen hatte. Darum sind später so manche eingefangenen Bauern
wegen «ungebührlicher» oder «unehrerbietiger» Worte hart bestraft
worden, die sie sich auf dem Murifeld speziell dem Schultheissen
Dachselhofer gegenüber geleistet hatten.
Ein inhaltlich interessanter Bericht über einen solchen Einzelfall
betrifft den Hans Bürki, aus dem Winkel bei Langnau, den wir als
einen der ersten und feurigsten Parteigänger Uli Gallis und Teilnehmer
an der ersten illegalen Versammlung in dessen Haus in Eggiwil
schon kurz nach Weihnachten 1652 kennen lernten und von dem
wir bereits erzählten, wie er später von einem Prädikanten auf gemeine
Weise an die Regierung verraten worden ist. Ueber diesen jungen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 463 - arpa Themen Projekte
Lienhart Glanzmann an der Neubrücke angehörte und jeden mit dem
Tode bedrohte, der die Bauern «nicht hie ihren Rechten und Freiheiten
lassen wollte», erzählt Rösli: «Auf dem Murifeld widersprach er
Schultheiss Dachselhofer mit ,rouwen ungebührlichen' Worten. Gegenüber
Herrn Morlot drang er darauf, dass den Bauern der durch die
falschen Bern batzen erlittene Schaden ersetzt werde, sonst würden sie
nicht von der Stadt abziehen, Schultheiss Dachselhofer habe vor Jahren
versprochen, ,Berner Batzen werdind Berner Batzen verblieben',
was dieser aber energisch bestritt. Er ermahnte die Bauern, nicht von
ihren Klagepunkten abzugehen und erinnerte sie daran, wie man ihnen
im April in einer so billigen und gerechten Sache den Fussfall zugemutet
habe.» Darüber wusste Hans Bürki Bescheid; denn er war selber
bei den Emmentaler Ausschüssen gewesen, die unter Führung Leuenbergers
am 4. April auf diese Weise gedemütigt worden waren. Ausserdem
hatte ihn sein Vater, der habliche Bauer und rabiate Rebell
Daniel Bürki, bei seiner Heimkehr von Bern «grüslich usgeschlagen»
dafür, dass er den Kniefall geleistet hatte! (Wofür der Vater übrigens
später von der Regierung, die jede solche Gelegenheit zu Geld machte,
mit nicht weniger als 1500 Kronen gebüsst worden ist!)
Gerade das rapide Anwachsen der revolutionären Massenstimmung
von Stunde zu Stunde jedoch musste anderseits Leuenbergers so tief
im schlechten Gewissen des Untertanen wurzelnden Willen zum Frieden
mit den Herren zu einem förmlichen Wettlauf anstacheln, um dem von
ihm so gefürchteten Ausbruch mit einem Abschluss zuvorkommen.
In diesem Bestreben geriet er, der Zögerer, in eine Uebereile, in der er
dann wohl auch über das eigene Ziel hinausschoss. Vielleicht der
Hauptstachel für diese panische Flucht in einen falschen «Frieden« —
in die Arme der eigenen Landesherren — war die Anwesenheit einer
grossen Zahl «landesfremder» Bauernführer und Truppen auf bernischem
Boden; nebst vielen Solothurnern, die der Landsturm im Oberaargau
— trotz gleichzeitigen «Friedensverhandlungen» mit ihrer Regierung
— mitgerissen hatte, vor allem die Anwesenheit der Entlebucher
und Willisauer unter Schybi. Die Berner Ratsherren und Obergeistlichen
werden bestimmt nicht versäumt haben, dem «Untertan»
Leuenberger mit diesem «Hochverrat» die Hölle heiss zu machen!
«Die Entlebucher und Luzerner seien sehr hitzig und rasend gewesen
gegen die Stadt Bern», berichtet Liebenau nach dem «Vergicht»
Brönners.
Aber eben gegen diese «Gefahr» ist Leuenberger auf einmal energisch
geworden. So energisch wie nur noch gegen die «Gefahr», die dem
«Frieden» vom revolutionären Flügel seines eigenen Kriegsrats drohte.
Für diese Art Energie heimat Leuenberger denn auch das einmütige
Lob aller Herrenchronisten ein, auch der «besten Demokraten» unter
ihnen. So schreibt Bögli: «Diese Leute zu bemeistern, musste dem gewissenhaften
Leuenberger oft sehr schwer werden. Das geht schon daraus
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 464 - arpa Themen Projekte
Schybi auf der Folter vor dem Kriegsgericht in Sursee
am 5. Juli 1653
volkstümliche Darstellung aus dem Schweizerischen Bilderkalender
des Jahres 1840 von Martin Disteli.
Schybi wurde von den abergläubischen Herren hauptsächlich
deshalb endlos gefoltert, um hinter das "Geheimnis' seiner
angeblichen "Zauberkunst" ("nigromantia") zu kommen, kraft
deren er die Soldaten "hieb- und stichfest" gemacht habe
Darüber schrieb der Präsident der Henkerkommission, Ratsherr
Kaspar Pfyffer von Luzern, an den Schultheissen Fleckenstein
am 5. Juli 1653: "Diesen Morgen haben wir früh angefangen
und 12 Stunden examiniert. Der Schybi hält sich fest und ist
mächtig stark. Ihm sind kleine und grosse Steine, auch andere
Sachen aufgelegt (angehängt) worden; doch hat er wegen
nigromantiam nichts bekennen wollen, obwohl er heftig geschwitzt
und dazu geweint hat. Wir vermeinen also nicht und
können nicht finden und gespüren, dass etwas weiteres aus
diesem zu bringen sei."
Nach einem Einzelblatt in der Landesbibliothek in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 464 - arpa Themen Projekte
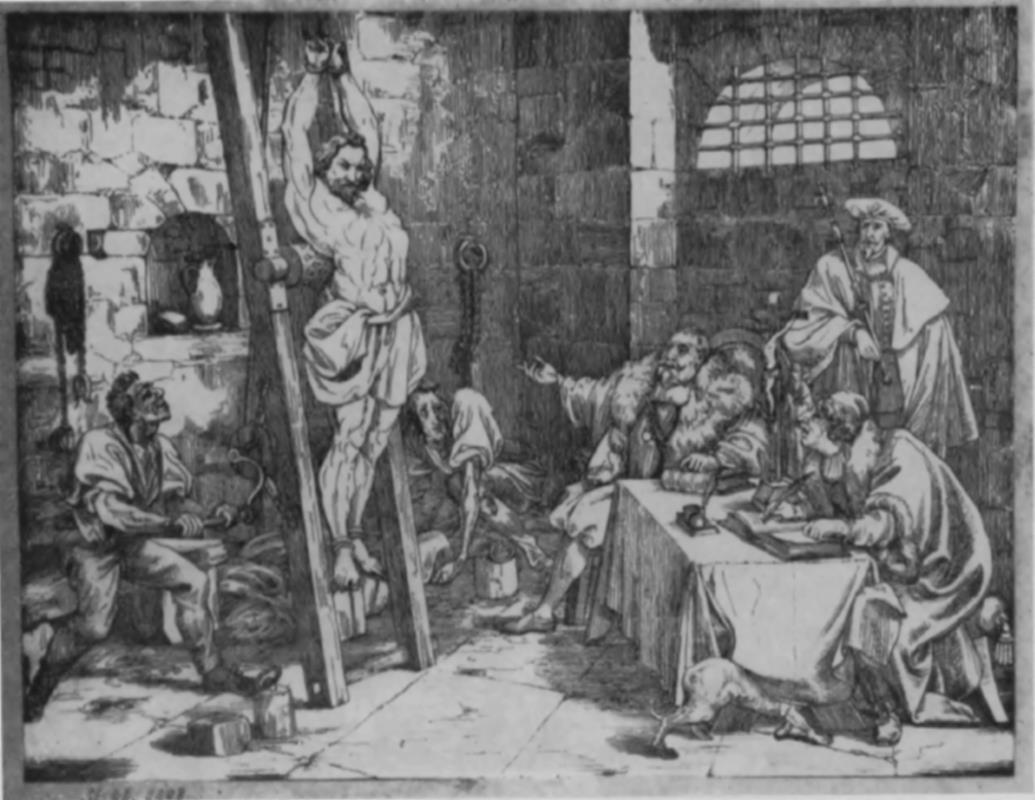
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 465 - arpa Themen Projekte
Gnadengesuch erklärte, er habe beim Aufbruch nach dem Murifeld
anfangs nicht gewusst (!), dass es auf die Belagerung der Stadt abgesehen
sei» (d. h.: er hat diese nie gewollt, auch dann nicht, als sie von
der Langenthaler Landsgemeinde beschlossen worden war und auch
nach der Verabredung mit Emmenegger am 19. nicht, die nur die
Belagerung Berns betroffen haben kann, für welche einzig und allein
die Entlebucher und Willisauer ihre beste Mannschaft zu einem solchen
Zeitpunkt zu opfern bereit sein konnten). «Es war offenbar seine
Absicht gewesen», fährt Bögli fort, «noch einmal einen friedlichen
Versuch zu machen und nichts zu übereilen. Wer ihm aber hieraus den
Vorwurf der Schwäche und Unentschlossenheit machen wollte, würde
sehr irren. Seinem kräftigen Einschreiten war es zu verdanken, dass
die Stadt verschont blieb von den» (eingebildeten!) «Gräueln der Verwüstung»
(die wie oben dargetan, allein in Frage gekommen wären,
falls die Herrentruppen die Bauern durch einen Ueberfall in deren
Rücken zur Raserei getrieben hätten!). «Er allein trat in Ostermundigen
dem Ungestüm der Kriegsräte und der Entlebucher Bauern energisch
entgegen.»
Das Resultat dieser Art Energie aber war — vom Standpunkt der
ganzen Bauernsache und von der Gesamtentwicklung der Schweiz aus
gesehen — ein wahrhaft katastrophales! Schon der «vorläufige» Frieden
vom 24., nicht erst der «endgültige» vom 28. Mai, leitete den Zusammenbruch
der ganzen Bewegung ein. Das geht auch aus der knappen
Zusammenfassung, die der Herrenchronist Peter von diesem Vorvertrag
gibt, eindeutig hervor. «Schon am 24. Mai», schreibt Peter,
«führten die Unterhandlungen zu einem vorläufigen Vergleich; ,seygend
25 Artikel» —(es waren zwar 38, aber das spielt keine Rolle mehr)
— und nit viii andere, Alsa vor sechs oder siben Wochen gklagt und
von den evangelischen Herren Ehrengesandten verglichen worden;
hätte man Inen damals Brieff und Sigel geben, wäre es nicht so weith
kommen; die Artikel werden vollkommen werden', berichtete Untervogt
von Teufental an Rudolf Waser in Baden. Sodann versprach die
Regierung 50000 Pfund Kriegsentschädigung zu bezahlen und sicherte
allgemeine Amnestie zu, wogegen sich die Bauern verpflichteten, allfällig
gestifteten Schaden zu ersetzen, die Waffen unverzüglich niederzulegen,
den Huttwiler Bund abzusagen, die Bundesbriefe auszuliefern
und von neuem zu huldigen»!
Was vermöchte es uns — neben solchen Hauptbestimmungen —
noch zu interessieren, welche Kleinigkeiten daneben sonst noch ausgemacht
worden sind! Dass etwa das Emmental «neben dem Landesvenner
auch einen Landeshauptmann», natürlich einen von der Regierung
zu genehmigenden, erhalten sollte. Oder: dass zwar die Landsgemeinden
selbstverständlich verboten bleiben, dafür «die Untertanen
ihre Anliegen zuerst direkt bei der Regierung (!) vorbringen sollten;
würde diese keine Abhilfe schaffen, so dürften alsdann Ausschüsse oder
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 466 - arpa Themen Projekte
schändliche Ersatz für den verratenen Bund, den wohl der Artikel 31
des Vertrags vom 24. Mai darstellen soll: «Die Entschuldigung der
Bauern, dass sie nicht wider die Entlebucher ziehen wollen, wird angenommen»!
Sie waren ja bei mehrfach heilig geschworenem Eid verpflichtet,
für die Entlebucher jetzt und immerdar gegen die Herren ins
Feld zu ziehen!... Warum hat der «treue» Leuenberger diesen, doch
bei demselben Gott geschworenen Eid nicht ebenso schwer zu überwinden
gehabt wie ehemals, als er nach Sumiswald gehen sollte, den
in Bern den Herren geschworenen? Weil jetzt der fromme «Untertan»
Leuenberger sein schlechtes Gewissen als Rebell loswerden und zu seinen
«von Gott gesetzten» Gnädigen Herren heimkehren konnte! Denn,
wie die hohen geistlichen Herren dem verwirrten Leuenberger gewiss
nur allzu leicht klar machen konnten: Gott konnte es schliesslich nur
einen geben, und der musste ein Gott der Herren sein -— wie hätte er
die sonst eingesetzt! Sein Gottesdienst hat den armen Sektierer Leuenberger
schliesslich wieder zum Herrendienst zurückgeführt...
In der Tat beginnt ein Schreiben, in dem Leuenberger noch am
24. Mai den Herren im Namen der Bauern die «Restituierung» aller
Schäden an «Personen, ... Ochsen und anderen Sachen» nochmals
extra «in guten, wahren Treuen» verspricht, mit der bezeichnenden
Wendung: «Wir, Euer Gnaden kleinfügige (!) Untertanen...»! Und
damit entfiele denn die Notwendigkeit, auch nur ein weiteres 'Wort über
den «Bauernkrieg» zu verlieren — wenn Leuenberger der Bauernkrieg,
wenn die Geschichte nur eine Geschichte der Individuen wäre.
Es ist jetzt ohne weiteres klar, dass die Entlebucher und Willisauer,
die diesem traurigen Schauspiel ohnmächtig hatten zusehen müssen,
unverzüglich heimkehren mussten, um wenigstens zuhause zu retten,
was noch zu retten war. Es hätte dazu nicht einmal der dringenden
Rückmahnung vom 23. durch die Revolutionäre in Malters bedurft.
Ausgerechnet vom hartgesottensten Herrenchronisten, dem Luzerner
Herrn von Liebenau, müssen wir uns daher mit nur schlecht verhehltem
Hohn erzählen lassen: «Während dieser Vorgänge» (wir kennen
sie vom vorigen Kapitel her) «schloss Leuenberger am 24. Mai mit der
Regierung von Bern Frieden, ohne in denselben seine Bundesgenossen
einzuschliessen, wie man dies nach seinem Schreiben vom 17. Mai
hätte erwarten sollen»! Ja, es sei nicht einmal klar, ob Leuenberger
diese davon «auch gehörig in Kenntnis setzte». «Jedenfalls war der
Friedensschluss den Luzernern, wie den Freien Aemtern im Aargau
überraschend gekommen. Vielleicht fühlte Leuenberger selbst, dass er
ganz gegen den Wortlaut des Huttwilerbundes gehandelt habe und
suchte deshalb auch Ausflüchte, um den übereilten Schritt rückgängig
zu machen... Es hiess, Leuenberger habe den Truppen von Luzern
und Solothurn die im Frieden mit der Stadt ausbedungene Summe von
50000 Pfund auszahlen wollen»!
Aber selbst wenn das wahr ist — welch ein jämmerlicher Preis
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 467 - arpa Themen Projekte
ohnmächtiger Preis! Mit ihm war der Sieg nicht mehr zurückzukaufen,
der nun unaufhaltsam an die Herren ging. Zwar sahen sie selbst in
ihrem unbegrenzten Stolz und beleidigten Hochmut das Produkt der
Verhandlungen auf dem Murifeld für einen «schimpflichen Frieden»
an, und sie waren «keineswegs gesonnen», ihn zu halten, wie Peter
schreibt. «Trotzdem in Anbetracht der militärischen Lage diese Bedingungen
für den Berner Rat entschieden günstig waren, hatte er
sich doch nur ungern zu diesem Vergleiche herbeigelassen und zögerte,
in der Hoffnung auf baldigen Entsatz, da das Morlotsche Regiment
den Pass bei Gümmenen bereits überschritten hatte, noch mit der Fertigung
des Vertrages.»
Zweifellos setzte die Regierung dabei ihre Hoffnung auch auf
die Zersetzungserscheinungen im Bauernlager, die sie bereits am 24.
hatte beobachten können und die nun am 25. rapid zunahmen. Das
konnte die begründete Hoffnung erwecken, dass es in kurzer Frist möglich
sein werde, die anrückende Besatzungsarmee in die Stadt zu nehmen,
ohne durch einen Angriff von aussen auf das Bauernlager die
explosiven Kräfte desselben in die Stadt entladen zu müssen.
Diese Zersetzungserscheinungen waren einerseits die natürliche
Folge der von Anfang an herrschenden Unklarheit über das Vorgehen
gegenüber der Stadt; eine Unklarheit, die durch Leuenbergers Verhalten
in den Verhandlungen vom 24. zum politischen Gegensatz zwischen
einer revolutionären Minderheit und der Leuenberger folgenden Mehrheit
wurde. Das war es, was in dem anarchischen Akt des Bergmichels,
den er am 25. früh mit der Erstürmung des Schänzli durch einen Handstreich
einiger Weniger begehen wollte, krass in Erscheinung trat —
wenn auch in einem, so wie er geplant war, sinnlosen Putsch, der kein
einziges Problem der Revolutionäre gelöst hätte. So etwas hätte nur
ganz zu Beginn der Belagerung einen revolutionären Sinn gehabt, wo es
galt, die vorhandene Kampfbereitschaft der Masse durch ein Beispiel
in Aktion zu setzen und dadurch die unentschlossene Führung auf die
revolutionäre Seite zu zwingen; jetzt aber, wo die Mehrheit mit Leuenbergers
«Frieden» ging, hätte man durch einen solchen Putsch nur
erreicht, diese Mehrheit samt ihrer Führung noch enger an die Seite
der Herren zu drängen.
Andererseits aber gab es im Bauernlager beträchtliche, von Tag
zu Tag steigende Verproviantierungssorgen. Zwar war das Proviantwesen
nicht ganz unorganisiert. Liebenau berichtet: «Zur Verpflegung
der Truppen musste ein Bauer 3 Brote liefern, ein halber Bauer 2, ein
Tanner (Taglöhner) eineinhalb Brot, wie Markus Huber unter dem
15./25. Mai vom ,Brod betlen' meldet.» Es wird nicht gesagt, ob diese
Lieferquoten täglich oder für den ganzen Feldzug gemeint waren. Wir
hören auch aus den verschiedensten Landesteilen, dass die Bauern
denen auf dem Murifeld fieberhaft «Spyss und Molchen nachferggen»
liessen. Jedenfalls aber genügte die tatsächliche Versorgung bei weitem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 468 - arpa Themen Projekte
der Bauern herrsche Mangel». Ueberall, besonders im Emmental — so
z. B. in Langnau, Schangnau, Trub etc. —, «erzwangen» die Bauern,
wie Rösli berichtet, gegen den Widerstand der «Schaffner», der Regierungsbeamten,
«die Oeffnung des Zehntenspeichers», nahmen das Getreide
heraus, liessen Brot daraus backen und transportierten es ins
Bauernlager vor Bern. Dieser Rückgriff auf die obrigkeitlichen Zehntspeicher
schuf sogar eine eigene Kategorie der von der Regierung später
bestraften Bauern.
Ferner gab es im Lager der Bauern auch ausgesprochene Verräter.
So einen gewissen Klaus Zimmermann aus dem Amte Trachselwald.
«Er scheint», schreibt Rösti, «Beziehungen sowohl mit den leitenden
Männern der Obrigkeit wie mit den Führern der Bauern gehabt
zu haben. Beide suchten von ihm Nachrichten über die Pläne des Gegners
zu erlangen. Ob er beide verriet, wie der Landvogt von Trachselwald
in seinem Schreiben vermutet, lässt sich nicht feststellen. Jedenfalls
wurde er» — trotzdem er von Samuel Tribolet am 8. Juli gefänglich
nach Bern spediert wurde — «am 21. Juli 1653 straflos wieder
freigelassen. Das Protokoll seines Verhörs blieb nicht erhalten» (!).
Aber auch auf der Seite der Herren gab es ganz gleichzeitig Zersetzungserscheinungen,
und zwar in der Bürgerschaft der Stadt Bern!
Das ist etwas in Bern völlig überraschendes — kein Herrenchronist
weiss davon auch nur ein Wörtchen zu melden, und wir wüssten überhaupt
nichts davon, wenn da nicht das im Berner Taschenbuch vom
Jahr 1904 veröffentlichte Tagebuch des bereits erwähnten damaligen
Griechischprofessors an der «Oberen Schule» in Bern, Berchtold Haller,
in die Lücke spränge. Dieses aber stellt es ausser jeden Zweifel, dass
die unterdrückte Bürgerschaft Berns den faulen Frieden Leuenbergers
mit den Herren als einen schweren Schlag gegen ihre eigensten Interessen
und gegen ihre geheimsten Hoffnungen empfand —als einen so
schweren Schlag, dass sie erst dadurch überhaupt aus ihrem lethargischen
Schlaf wie durch einen Kanonenschuss aufgeschreckt worden ist!
Zu spät allerdings, um noch eine Rolle spielen zu können. Und aus dem
Bauernlager, auf dessen Sieg diese Bürger ganz offensichtlich ihre
Hoffnung auf die eigene Befreiung ausschliesslich, ohne selber den
Kampf zu wagen, gesetzt hatten — von da kam ihnen keine kühne
Hilfe entgegen, wie sie die Stadtbürger von Luzern seitens der Entlebucher
erfuhren...
Am Sonntag, den 25. Mai nämlich, — so trägt der um das Wohl
«Miner Gnädigen Herren» zitternde Professor Haller in sein Tagebuch
ein — «ist der uf dem Feld von den Ussgeschossenen gemachte Friden
mit der mehreren Stirn confirmiert worden, von Räthen und Burgeren:
darüber eine gemeine Bürgerschaft heftig entrüstet, in der Statt zusamen
geloffen, darwider protestiert und vii Thröwwort (Drohworte)
wider die tyrannischen Landvogt und faltschen Münzer ergehen lassen»!
Plötzlich also brechen die ursprünglichen Losungen der Bauern,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 469 - arpa Themen Projekte
die tyrannischen Landvögte und gegen die Münzverschlechterung —
auch in der Berner Stadtbürgerschaft in öffentliche Drohungen aus:
ein klarer Beweis dafür, dass diese die Bauernbewegung von Beginn
an mit ihren Sympathien begleitet — aber auch dafür, dass diese Bürger
inzwischen keine Entwicklung ihres politischen Bewusstseins erfahren
hatten (wie sollten sie auch, ohne Fühlung mit einer wirklich
revolutionären Bauernschaft!). Dass dieser Ausbruch in «heftiger Entrüstung»
über den soeben abgeschlossenen ersten Kapitulationsfrieden
der Bauern mit den Herren erfolgte, beweist ebenso klar die Hoffnungen
auf den Sieg der Bauern.
Das ist nicht einmal der einzige Beweis für diese sehr wichtige
Tatsache. Der Herausgeber des Haller'schen Tagebuchs merkt vielmehr
an, dass ausserdem in den bernischen Staatsakten am 25. Mai
protokolliert wurde: «Zedel an Herrn Steiger und Herrn Lentulum:
der Bürgerschaft, weliche sich ab dem hüttigen Fridenschluss mit den
drussen campierten Bauten zimlich starck formalisierend (!), den Handel
mit allen erforderlichen Umstenden zeverstehen z'geben und sie
z'ruhen zeweisen.» Am 26. wird eine noch verstärkte Bemühung, die
rebellischen. Bürger «z'ruhen zeweisen», protokolliert: jetzt «haben
Ihr Gnaden gutfunden», eine Kommission von vier Ratsherren damit
zu betrauen, den Seckelmeister Willading, den Venner und Lentulus,
und zwar «uff beschechnen Anzug (Anzeige), dass etliche Burger sich
bi Schützen zusammen schlagend und vilfaltig wider die underhabende
Fridenshandlung mit den auf rürerischen Bauwren redind...» Am 27.
musste sich der Venner Stürler im Kleinen Rat speziell dagegen verwahren,
«dass ihme under der Bürgerschaft und durch gemeine Gassenreden
die schwere Unthat des falschen Müntzens ungut und feltschlich
zugelegt werde». Ja, am 28., am Tag des «endgültigen» Friedens
mit Leuenberger, musste der Rat mit einer sehr drakonischen Massregel
einschreiten, um der Bürgerrebellion den Kopf abzuschlagen. Er
befahl dem Herren-Kriegsrat: «Biss 200 (!) schwierige hitzige schlechte
Bürger in Usszug zethun, wann man dran zeüchen müsste»! Das war
also Zwangkriegsdienst als Strafe für Rebellion, wozu diese Bürger
gepresst wurden. Und wenn es auch noch genug herrenfromme Bürger
gegeben haben mag, so ist dies doch eine höchst wichtige Korrektur
zu der von den Herrenchronisten stets «willig» und uneingeschränkt
wiederholten Behauptung, dass die Stadt Bern im Bauernkrieg «eine
willige kriegstüchtige Bürgerschaft besass»! Noch vier Tage später
wurden zwei prominente Bürger ausdrücklich vom Hat gemassregelt
«wegen Drohungen, die Doktor Küng und Hr. Gross in einer Versammlung
gegen Seckelmeister Willading ausstiessen».
Es ist also wohl kaum daran zu zweifeln, dass selbst in Bern die
Bürgerrebellion von ausserordentlicher Bedeutung für den ganzen Verlauf
der Dinge hätte werden können, wenn in der Führung der Bauern
das Verständnis für die Lage der Bürger und der Wille zur Zusammenarbeit
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 470 - arpa Themen Projekte
davon auch nicht eine Spur zu finden — die Bürgerfrage konnte bei
ihm, wenn er ihrer überhaupt bewusst geworden ist, nur noch mehr
Grauen vor der Verantwortung und einen noch beschleunigteren Kapitulationswillen
hervorbringen.
Statt dessen feilschte Leuenberger vom 25. an mit der Regierung
um die Barauszahlung der 50000 Pfund Kriegsentschädigung. Vielleicht
zwang ihn die prekäre Verproviantierungslage dazu; vielleicht
geschah dies aber nur deshalb, weil er hoffte, die murrende Masse,
speziell die Luzerner und Solothurner — wie Liebenau in der angeführten
Stelle vermutet —, durch Barauszahlungen beruhigen zu können.
Doch von Entgegenkommen in bar war beim Berner Rat keine
Rede. «Für ihn waren», wie Rösti sagt, «die Verhandlungen lediglich
ein Kampf um Zeitgewinn». Er hoffte nun, durch den Anmarsch der
sehnsüchtig erwarteten Truppen, in Verbindung mit der fortschreitenden
Zersetzung im Bauernlager, nicht nur der Kriegsentschädigung,
sondern der Ausfertigung des Vertrags überhaupt enthoben zu werden.
«Am 25. Mai», berichtet Bögli, «verlangte nun Leuenberger die
Herausgabe des Friedensvertrages, da ohne dies sein Volk nicht vom
Patze weichen wolle.» Selbst dies also tat Leuenberger nur unter dem
Druck der Masse! Ferner begehrte er naiverweise zu wissen, «warum
die Stadt immer neue Truppen anrücken lasse». «Da die Antwort der
Regierung vom gleichen Tage», berichtet Vock, «ihn nicht befriedigte,
sandte er am 26. ein zweites Schreiben, worin er drohte und erklärte,
dass, wenn die Regierung nicht sogleich guten Bescheid gebe, die Bauern
für jeden Tag, den sie länger vor der Stadt bleiben müssten, 5000
Kronen Kostenersatz fordern werden.» Aber den Mut zu dieser verschärfenden
Bedingung hat Leuenberger ebenfalls nicht aus sich selbst
geschöpft; denn es wird, durch Rösli, ausdrücklich bekundet, dass es
Uli Galli war, der diese Bedingungen durchdrückte. Vielleicht hat der
revolutionäre Flügel des Kriegsrats gehofft, dadurch eine Situation zu
schaffen, die Leuenberger doch noch loszuschlagen zwang.
Aber noch gleichentags bekam Leuenberger Angst vor der eigenen
Courage. «Kaum war dieses Schreiben abgegangen», lesen wir bei
Vock, «schickte er am 26. Mai ein zweites, demütigeres, nach, worin er
gar dringend um urkundliche Ausfertigung der bewilligten Artikel bat
und den Artikel wegen der 50000 Pfund einstweilen unerörtert lassen
wollte (!) Zugleich ward, auf Leuenbergers Befehl, der abgeschlossene
Friede mit der Regierung im Lager der Bauern feierlich ausgerufen
und bekannt gemacht.» Spätestens jetzt müsste man erwarten,
dass sich im Bauernlager selbst eine Rebellion erhoben haben würde!
Doch nichts dergleichen geschah —trotzdem am gleichen Tag von Münchenbuchsee
die Nachricht kam, «dass die dortigen Leute sich dem
Aufstand anschlossen und ihr Reisgeld herausforderten». Auch die
Revolutionäre um Uli Galli scheinen also in keiner Weise auf der Höhe
der Lage gewesen zu sein...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 471 - arpa Themen Projekte
Am gleichen Tag, am 26., langte ausserdem —wie Bögli berichtet —
«von den Schwarzenburgern Beschwerde darüber an, dass ihre Mannschaft
in die Stadt gezogen werde, während sie zum Schutze des eigenen
Landes nötig wäre». Auch hinter dieser etwas rätselhaften Nachricht,
die von Bögli mit keinem Wort weiter erläutert wird, birgt sich ein für
die Bauernsache äusserst vorteilhafter Umschwung, den die Bauernführer
auf dem Murifeld, auch die revolutionären, ebensowenig wie
alle übrigen Fortschritte in der Massenstimmung zu nutzen verstanden.
Wir wissen durch unsere bisherige Erzählung von den Schwarzenburgern
nur, dass sie noch von der letzten Huttwiler Landsgemeinde
angeschrieben werden mussten, sie möchten sich endlich entscheiden,
auf welche Seite sie sich zu halten gedächten. Jetzt hatten sie sich —
nach den Berichten Röslis über die verschiedenen Beteiligten — entschieden:
der Landschreiber von Schwarzenburg Hans Bauen, der
Seckelmeister ebendort Uli Zand, Bendicht Jutzeler, Peter Werli, Bendicht
Zbinden u. a. in. «wirkten aufreizend unter den der Stadt zu Hilfe
gezogenen Schwarzenburger Auszügern», und zwar einzelne in der
Stadt Bern selbst! Sie «schrieben nach Schwarzenburg, sie sollten sich
mit Kugeln und Blei wohl versehen, um den Welschen begegnen zu
können». Jutzeler gab dabei den guten Rat, «die Fenster (Butzenscheiben!)
einzuschlagen und das Blei und Zinn in Kugeln umzugiessen»;
«auf eine alarmierende Nachricht von der Gümmenenbrücke wollte er
,stürmen'...» Delegierte des Berner Rats, die auch zu ihnen gekommen
waren, um sie vom Zuzug zur Bauernarmee abzuhalten, liessen sie
abblitzen oder setzten sie gefangen. «Als Ratsherr Huser ihnen die
Konzessionen der Obrigkeit mitteilte, zog er (Jutzeler) die Leuenbergischen
Briefe hervor» (wahrscheinlich Mahnbriefe aus Huttwil, und
sie mussten ja Leuenberger nach allem dort Geschehenen auch jetzt
noch, wie wohl fast alle Bauern, für den geweihten Führer der Bauernrevolution
halten!) «mit den Worten, man wisse nicht, was Herr Huser
angebe, man solle dem Leuenberger glauben, und zum Landvogt sagte
er, er habe ihnen viel verheissen und nichts gehalten.» Hans Bauen
seinerseits «half in Schwarzenburg den von den Bauern eingesperrten
Rittmeister Steiger bewachen, forderte vom Vogt von Schwarzenburg
die Oeffnung von Briefen aus Freiburg, oder die Mitteilung ihres Inhalts,
und sprach böse Worte gegen die Obrigkeit...» Ueberhaupt besorgten
die Schwarzenburger die Verbindung zwischen den Aufständischen
und den Bauern im Freiburgischen; Uli Zand z. B. trug «die
Kopie des Emmenthalischen Schreibens» (wohl eines Mahnbriefs aus
Huttwil) «nach Plaffeyen, wo er sie dem dortigen Ammann übergab».
Auch Christen Zimmermann, der Gastwirt von Guggisberg, war ein
solcher «Botschaftsträger»; er hatte z. B. das Aufgebot zur Huttwiler
Landsgemeinde «an die Freiburger weitergegeben». Einzelne von ihnen
hatten auch bereits an der letzten Huttwiler Landsgemeinde teilgenommen.
Im Schwarzenburgischen war also gerade um die Zeit, da Leuenberger
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 472 - arpa Themen Projekte
und Bundesbruch, feilschte, alles in hellster Revolution begriffen. Aber
nicht nur dort, sondern im ganzen Bernerland westlich der Aare! Bendicht
Brönnimann, «Wirt zu Kiesen und des Gerichts daselbst, wiegelte
auf der andern Seite der Aare das Volk auf und verhinderte es, der
Obrigkeit zu Hilfe zu ziehen. Besonders trachtete er darnach, die obrigkeitlichen
,Stuck (Kanonen), so von Bern nach Thun verschickt werden
sollen', wegzunehmen und stellte hauptsächlich zu diesem Zwecke
mit Waiblingen versehene Wachen an die Aare». Simon Däppen, von
Wichtrach, «des Gerichts daselbst, kontrollierte die Aareübergänge um
Wichtrach und Münsingen, kommandierte 8 Mann über die Aare zur
Aufwiegelung der Bevölkerung, so besonders nach Kehrsatz»; er war
auch im Kriegsrat der Bauern. Ein Trupp Bauern hielt sich «in einem
Hölzlin» bei Kirchdorf versteckt, «um Waffentransporte nach Thun
abzufangen». In Belp war Christen Rüfenacht «ein Aufwiegler und
Botschaftträger ger». Niklaus Rüfenacht, «der Jung», von Münsingen,
sagte —und das muss schon eine Reaktion auf Leuenbergers faulen
Frieden gewesen sein —, «die Herren von Bern hätten die Buwren
faltschlich überlistet, sie sollten nur Sorg haben, dass die Buwren sie
fit auch überlisten»! In der Wichtrachter Gegend suchte Jost Gfeller
von Niederwil «alle Waffen zusammen und trieb sogar Weiber an, zu
diesen zu greifen»!
Als die Herrenboten auch in Frutigen das Volk für den Zuzug zur
Herrenarmee aufbieten wollten, stellten sich dem die Brüder Hans und
Jakob Gämpeler entschlossen in den Weg. «Bei einer Gemeindeversammlung
im Landhause wurde bestimmt, dass, wer es mit der Obrigkeit
halten wolle, sich ins Haus des Hans Zahler begeben solle. Da hätten
er und sein Bruder (Hans und Jakob Gämpeler) sich unter die Türe
gestellt und gewehrt, es solle niemand in das Haus Zahlers gehen.»
Beide sollen gesagt haben: «sie hätten eine schöne Obrigkeit, es müsse
anders werden, oder sie würden ,ihr auf d'Ohren geben'; diese hätte
ihnen bald genug ,Lugenen ins Land geschickt'...»; dem Kastlan zu
Wimmis — dem Dübelbeiss, der die falschen «Oberländer» als Saboteure
nach Huttwil gesandt hatte — solle man «den Lohn geben».
Peter Zurbrügg von Aeschi bei Frutigen aber «drohte dem Prädikanten
zu Reichenbach mit der Faust und rief ihm zu: ,man wirt euch anderen
Fressern den Grind wol aufhaben und auf die Ohren geben». So
zogen denn die Frutiger nicht den Herren, sondern den zwischen Gwatt
und Allmendingen kampierenden Bauern zu. «Auf ihrem Vormarsch
nach Gwatt zogen die Frutiger durch das dem General von Erlach gehörende
Gut ,zu Lapigen'. Sie schädigten das Besitztum und schlugen
die Fenster ein. Doch konnten die Verhörrichter, trotz allen Anstrengungen,
die Schuldigen nicht herausfinden, da ,keiner den Thäter angeben
oder wüssen wöllen'...»
Mit einem Wort: die Revolution kam westlich der Aare und im
ganzen Berner Oberland —auch in Brienz, Grindelwald und andern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 473 - arpa Themen Projekte
Leuenbergers erst überhaupt in Gang. Auch im Seeland und
drüben im Freiburgischen breitete sie sich erst jetzt richtig aus. Im
Thiergarten bei Aarberg stand eine ganze Bauernarmee, der auch viele
hundert Solothurner zugezogen waren. Dort kommandierte Bendicht
Spring, der Meyer von Schöpfen, «ein rycher und ansehnlicher Landtmann»;
er «organisierte den Widerstand im Seeland und besonders
die Verlegung der Pässe...; er selbst übernahm die Sperrung des Passes
bei Aarberg. Auf die Nachricht vom Anmarsch der westschweizerischen
Hilfstruppen gegen die Gümmenenbrücke liess er Sturm läuten
und brach mit dem halben Teil der Mannschaft dorthin auf.» Dort
hatte inzwischen aber bereits Peter Freiburghaus, der Statthalter von
Neuenegg, «auf die Meldung, dass im Freiburgergebiet einige tausend
Reiter zum Einmarsch bereit seien, die bereits geöffnete Brücke zu
Gümmenen wieder gesperrt. . gesperrt...» und Hans Mäder, den Weibe! von
Neuenegg, zum Kommandanten eingesetzt, der schwere Eichbäume
über die Brücke legen liess. Darum führte Bendicht Spring seine Truppen
wieder in den Thiergarten zurück, übergab das Kommando seinem
Bruder Hans Spring, dem Weibel von Schöpfen, und eilte zu Leuenberger
aufs Murifeld, weil er von dem drohenden Friedensschluss gehört
hatte. Er hat noch nach der Niederlage den Berner Herren standhaft
und stolz getrotzt und ist dafür denn auch geköpft worden. Ebenso
Freiburghaus, der gesagt hat, «dass die faltschen Münzer und Batzenschlacher
fit all ussert Landts und in Frankreich, sondern auch
deren allhie in der Statt sigindt, die man wo! wüsse, doch aber nit abstraffe.
Man solle sie ihnen ausshergeben. Sie wöllind sie wo! abstraffen...»
Er hat auch die Freiburger Herren «hochfärtige und stolze
Herren geheissen, die sie nit wie Christen und Möntschen tractierind».
Wahrlich die Sache der Herren stand auch jetzt noch schlecht, ja,
in einem gewissen Sinne schlechter als je zuvor. Und auch jetzt noch
hätte ein kühnerer Führer als Leuenberger die ganze Bauernsache mit
einem Schlag zum Guten wenden können. Welche Ironie, dass die Herren
ihre beleidigte Majestät am wütendsten gerade an Leuenberger ausliessen!
Vorläufig zwar nur, indem sie mit ohnmächtigem Zähneknirschen
die Schreiben, die sie ihm aufs Murifeld schicken mussten, im
verschwiegenen Berner Ratsrnanual mit bitteren Randglossen adressierten.
So eines vom 23. Mai: «An den Landschelmen Löwenberger und
seine Diebsgespannen»; am 26. Mai: «An erwenten perduellionis reum
(des Hochverrats Schuldigen) Niggi Lewenberger mit seiner übelverfüchtenden
Rott über ihr abermals unersettliches Gsüech in der Vergleichshandlung
zu antworten.» Das «unersettliche Gsüech » betraf eben
die 50000 Pfund, um deren Zahlung Leuenberger mit ihnen feilschte...
Zwar willigten die Herren am 27. grundsätzlich ein —aber nur
theoretisch —, das Geld «gnädigen und gutwilligen Sinns... gefolgen
zu lassen»; jedoch ums Himmelswillen nicht als Kostenersatz, «wie Ihr
es in euerm Schreiben dafür anziehst», erst recht nicht «von Abrufs
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 474 - arpa Themen Projekte
Bedrängnisse und beiläufiger Landesarmuth» —
mithin als pures Almosen! Und so etwas liess sich der Feldherr von
20000 bewaffneten Bauern bieten, dem noch dazu der Rücken gestärkt
wurde durch ein ganzes, sich nun wirklich zum allgemeinsten Aufruhr
erhebendes Volk!
Ganz ohne Aufbegehren im Lager ist die Sache jedoch nicht abgelaufen.
An diesem Tage nämlich, oder vielmehr in der Nacht vom 27.
auf den 28., kam es vor Bern zu der einzigen Kampfhandlung während
der Belagerung Berns, bei welcher Blut floss. Die Truppe, die Leuenberger
durchbrannte, war gewiss nicht zufällig gerade die Kompanie
Lienhart Glanzmanns an der Neubrücke, bei der ja die Heissporne
Bergmichel und Bürki standen und gewiss noch viele andere, die vor
Zorn über Leuenbergers Verhalten aus der Haut fahren mochten. Bei
diesem Gefecht an der Neubrücke wurde Glanzmann verwundet und
im Kommando durch Daniel Küpfer ersetzt. Alle Namen, die bei dieser
einzigen kriegerischen Handlung vor Bern auftauchten, gehören dem
revolutionären Flügel an. Es wird der letzte, ohnmächtige Versuch desselben
gewesen sein, Leuenberger zum Handeln zu zwingen. Wie ohnmächtig
dieser Versuch war, geht aus dem einzigen zeitgenössischen
Originalbericht hervor, den wir über dieses Gefecht besitzen. Folgende
unfreiwillige Farce nämlich hat der brave Griechischprofessor Albrecht
Haller —einseitig über die «heldenhafte» Abwehr seiner Studenten —
dem Tagebuch anvertraut: «ist by der Nüwen Brugg von den Buwren
ein Angriff geschächen, welchem von den Studenten ein gewaltiger
Widerstand gethan worden; und hat man 4 Feldstuck us der Stadt in
Brüggrein gepflanzet, von deren einem Herren Hauptmann Andress
Herman der Kopf abgeschossen worden, wyl er us Unfürsichtigkeit
sich zu wyt under Stuck gelassen, und ist noch ein Husman von den
unseren selber zu todgeschossen worden, wyl er das Wort (das Passwort)
vergessen. Item ein Student umb etwas verletzt, von den rebellischen
Buwren aber sollen etlich geblieben syn...»
Unter diesem Heldenzeichen kam der 28. Mai, an dem unser Professor
eintragen kann: «ist wiederum von Räthen und Burgeren mit
den Rebellen Friden gemacht worden.... Eodem sind etliche Rüter ankommen
und etlich 1000 Mann in die nechst umb die Statt liegende
Dörfer verlegt worden»! Endlich also war wenigstens der Zweck
der Verzögerungstaktik der Herren erreicht: ein Teil der welschen
Truppen konnte durch die bereits weitgehend paralysierten Bauerntruppen
hindurch und in Stellung gebracht werden. Das soll vor allein
einer Kriegslist des Landvogts von Laupen, Johann Jakob Dürheim aus
Bern, zu verdanken sein: «Er ging ins Lager der Bauern bei der Brücke
in Gümmenen und rief überall voll Verzweiflung aus: ,Nun sei alles
verloren; Leuenberger habe sich mit seinem Heere, welches vor Bern
liege, dem Papste unterworfen (!) und sich mit seinen Mithaften für
den Rücktritt zum katholischen Glauben (!) erklärt, sodass man jetzt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 475 - arpa Themen Projekte
habe'. Diese Kriegslist gelang vollständig. Die reformierten Landleute
bekamen einen solchen ungeheuren Schrecken, als ob der Papst sie
beim Halse gepackt hätte. Sie liefen schnell auseinander und nach
Hause. Oberst Morlot führte ganz ungehindert seine Truppen über die
Brücke zu Gümmenen und im Eilmärsche nach Bern.» So erzählt der
katholische Herrenchronist Vock nach der «Histoire des Helvétiens»
des Barons von Alt, eines späteren Schultheissen von Freiburg, sowie
nach einer Reihe ungedruckter Handschriften.
Diese Geschichte ist zwar eine typische Herrenlegende, typisch vor
allem durch den Abgrund von Dummheit, der hier den Bauern untergeschoben
wird. Etwas Panikartiges aber muss bei der so stark und
leidenschaftlich bewachten Gümmenenbrücke — und auch bei dem
grossen Armeehaufen im Thiergarten bei Aarberg —passiert sein; sonst
wären die welschen Truppen nicht ohne ein einziges Gefecht in die
Stadt Bern gelangt. Es ist auch nicht schwer, auf den wahren Grund
dieser Panik, die die ganze Bauernmacht wie eine galoppierende
Schwindsucht ergriff und lahmlegte, zu schliessen: sollte diese Panik
nicht ganz einfach die direkte Wirkung der Tatsache sein, dass am
27. Mai «auf Leuenbergers Befehl der abgeschlossene Friede mit der
Regierung im Lager der Bauern ausgerufen und bekannt gemacht»
wurde? Und sollte das nicht der von Leuenberger mit dieser Proklamation
ganz bewusst erstrebte Zweck gewesen sein? Die Herrenlegende
hat dann Leuenbergers Abfall vom Glauben nur erfunden, um seinen
politischen Abfall von der Sache der Bauern und dessen Wirkung auf
die Masse der Bauern zu verwedeln! Denn es lag eminent im Interesse
auch des späteren Fortbestandes des Herrenregimes, wenigstens den
Versuch zu machen, den Bauern auszureden, ihre Niederlage sei allein
dem politischen Versagen oder gar Verrat ihrer Führung zuzuschreiben.
Sonst hätten sie leicht der Idee verfallen können, man brauche
nur eine andere Führung einzusetzen, um die Bauernsache durch einen
neuen Aufstand doch noch zum Sieg führen zu können...
Der nun, am 28. früh, zwischen Leuenberger und der Berner Regierung
vereinbarte «definitive Murifeld-Vertrag» nämlich hat folgenden
Hauptinhalt. Wir geben hier nur den geschichtlich aufschlussreichen
Eingang, die drei politisch grundlegenden Artikel, sowie den
Schlussartikel 36 (es sind jetzt zwei weniger als im «vorläufigen» Vertrag
vom 24.) im Wortlaut wieder. Zur Charakterisierung des Inhalts
der übrigen Artikel des weitschweifigen Vertragsinstruments fügen wir
noch die knappe Zusammenfassung derselben, wie sie Bögli gibt, hinzu.
«Wir, Schultheiss, Rath und Burger der Stadt Bern, thun kund
hiemit: Als dann Unsere Unterthanen der Landschaft Emmenthal
sammt der Amtei Signau, mit dem Landgericht Konolfingen und freien
Gericht Steffisburg, wie auch denen in Unsern Amteien Wangen, Aarwangen,
Bipp, Aarburg und Grafschaft Lenzburg, item: die Landleute
der Grafschaft Burgdorf, die Landleute der Grafschaft Büren, die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 476 - arpa Themen Projekte
der Vogtei Fraubrunnen, Landshut, wie auch Brienz Und Castlanei
Frutigen, vielerlei gemeine und besondere Beschwerden, Klagen und
Anforderungen, ihre gemeinen Landsbräuche, Freiheiten und Gewohnheiten,
wie auch ihre unterthänige Schuldigkeit gegen Uns, ihre Oberkeit,
betreffend, zusammenfassen und Uns vortragen lassen, und aber
sich Unserer geneigtwillig darüber gegebenen, möglichst willfährigen,
gnädigen Erklärungen und Erläuterungen anders nicht ersättigt, denn
dass sie endlich mit bewehrter Hand vor Unsere Hauptstadt gekommen,
durch Mittel solcher Gewalt ihr völliges Anbegehren und Forderung
zu erlangen, gestalten auf ihr vielfältiges Veranlassen, Anhalten
und Begehren Wir durch einen Ausschuss aus Unserer Mitte mit ihnen
niedersitzen, alle ihre Uns übergebenen Beschwerdeartikel nochmals
erdauern und erwägen lassen, und, nach solcher mit ihnen freundlich
gepflogenen, Uns niedergebrachten (zurückberichteten) Verhandlung,
damit die Unsererseits vom Anfang durchaus vielfältig angewandte
Gütigkeit und Sanftmuth der Gewalt der Waffen nochmals vorgezogen,
und alles, aus dem Unfrieden erwachsene Unheil und Verderben verhütet
werde, Wir Uns endlich gegen vorgedachte Unsere Unterthanen
über alle ihre eingebrachten Artikel erläutert, und hinwiederum Uns
gegen sie anbedungen und vorbehalten, so dieselben auch, in Treu zu
erstatten und dess alles sich dankbarlich zu ersättigen, zugesagt und
versprochen, wie folgt:
1. Erstlich sollen und wollen sie, Unsere Unterthanen der genannten
Aemter und Orte, alsbald nach ihrem Wiederab- und Heimzug, so
stracks auf diesen Vergleich mit billiggemässem Abtrag alles zugefügten
Schadens geschehen soll, und auf Unser erstes Erfordern die
frische, unterthänige Eideshuldigung leisten und erstatten, wie ihre
Altväter gethan, ohne einigen Anhang noch Vorbehalt.
2. Diesem Huldigungseid ist ganz widrig vermeint die Zusammenverbündniss,
als um deren Nichtigkeit und Ungültigkeit unsere heitere
Protestation gegen sie in kräftigster Form zugebracht und durch dieselben
angenommen worden, der Meinung, dass sie derselben eidlichen
unguten Verbindung durch Unsere hochoberkeitliche Aufhebung gänzlich
absagen,. und ein und andern Orts die desswegen bei Handen habenden
Bundsbriefe, kanzellirt, als nichtig und kraftlos herausgegeben
werden, und hiemit alle und jede Unsere wohlhergebrachte, oberkeitliche
Hoheit, Regalien, Landesherrlichkeit, Freiheiten und Gerechtigkeiten,
Herrschaft, Gewalt und Ansehen, wie die genannt werden mögen,
Unsern oberkeitlichen Stand und Einkommen betreffend, wie bisher
Uns gänzlich und ungeschwächt verbleiben sollen, wie Wir hinwiederum
auch Unsere Unterthanen bei allen ihren alten Rechten, Gerechtigkeiten,
guten Gebräuchen und Gewohnheiten, nach Besag Briefs
und Siegels und alter Urbanen, verbleiben lassen, schirmen und handhaben
wollen.
7. Die Landsgemeinden betreffend welche begehrt werden wie von
Alter her, ist Unsere Meinung, wenn den gesammten Angehörigen eines
Amts etwas Beschwerliches verfällt, darum sie sich zu versammeln
und zu berathen begehren, sollen dieselben sogleich ihr Anliegen bevorderst
unterthänig an Uns gelangen lassen, die gebührende Abhelfung
von Uns darüber zu erwarten. Kann in dermalen ihnen nach Billigkeit
begegnet, und der Sach abgeholfen werden, so ist's mit Heil, und es
soll dabei sein Verbleiben haben; wo nicht, so mögen alsdann von ,jedem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 477 - arpa Themen Projekte
wenn man lieber will, alle Hausväter versammelt werden, und, wenn
die Sach es erforderte, und so weit auf andere, nächstgelegene Aemter
sich erstreckte, soll alsdann, eines, zwei oder drei derselben auch dazu
zu berufen, zugelassen sein, als dass dasjenige, was dermalen berathen
und verhandelt worden, Uns ebenmässig wieder vorgebracht werde.
36. Hiemit ist Unsere schliessliche, gnädige Meinung und Zusage,
dass Wir Unsere lieben Unterthanen. obgemeldet, bei allen vorbeschriebenen,
vielfältigen Erörterungen, Nachlass und Bewilligungen, deren
sie sich dann zu erfreuen haben, und Uns darum billig immerwährenden
Dank sagen, und mit schuldigem Gehorsam und Treue zu beschulden
sich befleissen sollen, für diesshin zu allen Zeiten. als lang ihre
unterthänige Treue und Gehorsam gegen Uns, ihre vorgesetzte Oberkeit,
währen wird, schützen, schirmen und handhaben wollen. Und
solle mit dieser des ganzen Geschäfts Erörterung auch alles das, was
sich in währender Sache mit Worten und Werken verlaufen, in einen
allgemeinen Vergoss gestellt und dergestalt aufgehoben sein, dass Niemand
dess an Leib, Ehre noch Gut zu entgelten habe. Alles ehrbarlich
und ungefährlich, in Kraft dieses Briefs. so Wir den Unsrigen, obgedacht,
hierum verfertigen lassen, mit Unserer Stadt Sekretinsiegel verwahrt.
Geben den 18. (28.) Mai 1653. (L. S.)»
Die Zusammenfassung der übrigen Artikel durch Bögli lautet:
«In dem Murifeldvertrage sind die nämlichen Bestimmungen enthalten
wie in den emmenthalischen Konzessionen vom 4. April 1653,
hinsichtlich des freien, feilen Verkaufs von Ross, Vieh und andern
Sachen, des Trattengeldes, der Landsgemeinden, der Zerteilung von
Lehensgütern im Emmenthal, der Kirchenrechnungen, der Schaffnereien
zu Langnau, Trub und Lauperswyl, der eigenhändig geschriebenen
Obligationen, des Pulverkaufs, der Ehrschätze von aufgeteilten
Schachen und Reisgrundgütern und von Mühlen, der Aufrichtung von
Gültbriefen, der Beistände in Trölhändeln, des Bezugs der Amtsgefälle
durch die Amtleute, der Aufhebung der Handwerkerzünfte auf dem
Lande, der Anwerbung von Soldaten. Was den Salzhandel betrifft, so
wurde das Monopol aufgehoben und der Kauf und Verkauf des Salzes
Jedermann freigestellt. Die Landschaft Emmenthal erhielt neben dem
Landesvenner auch einen Landeshauptmann. Die Beerdigung Beider
behielt sich die Obrigkeit vor. Im Uebrigen war Folgendes bestimmt:
Art. 10. Der Brüggsommer (eine Summe als Ersatz des Brückenzolls),
der Vogt- und Weibelhaber und andere gemeine Herrschaftsrechte
sollen von einem Gut und Lehen, wenn auch mehrere Häuser
darauf stehen, nur einfach bezogen und bezahlt und für die Herrschaftshühner
soll von den Armen nur ein Batzen (für eines) gefordert
werden.
Art. 11. Für die Truberdingkäse sollen jährlich zu Handen der
Obrigkeit acht Kronen bezahlt werden.
Art. 12. Die gemeinen Gerichtsgeschworenen und Weibel sollen
vom Amtmann und den Hausvätern desselben Gerichts gewählt und
von der Regierung bestätigt werden.
Art. 13. Das grosse Mass soll nicht mehr als zwei kleine oder einfache
enthalten.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 478 - arpa Themen Projekte
Art. 14. Die Gerichte sollen Sommerszeit im ganzen deutschen Gebietsteil
gleich eingestellt und gleich getrieben werden.
Art. 17. Zu Mühle zu fahren und zu reiten ist Jedermann freigestellt.
Art. 20. Unbillige durch die Amtleute bezogene Bussen sind von
diesen gebührend zu ersetzen.
Art. 21. Das Geleit im Kaufhaus und den Zoll betreffend, soll es
beim Alten verbleiben.
Art. 25. Gültverschreibungen dürfen wieder an ewigen Zins gestellt
werden.
Art. 28. Geringe Händel, so den Augenschein erfordern, dürfen
durch die Geschworenen am Ort in Minne ausgemacht werden.
Art. 30. Hinsichtlich des Fischens in den Bächen soll es bei den
alten Rechten bleiben.
Art. 32. Zwischen Parteien sollen gemeine Pfennigsachen sprüchlich
beigelegt werden dürfen, doch in Anwesenheit eines Geschworenen.
Art. 33. Die Einmessung des Bodenzinses mit dem kleinen Mass
betreffend, soll es beim alten Herkommen gemäss den Urbanen verbleiben.
Art. 34. In Betreff der Appellationskosten bleibt es bei der Ordnung
von 1648.
Art. 35. Das Degenmandat ist eingestellt.»
Die Berner Herren aber fanden auf diesen «Frieden» hin noch am
selben Tag, in der offiziellen «Annahmserklärung» vom 28. Mai, sehr
begreiflicherweise den echten Herrenton wieder. Waren doch ausserdem
an diesem Tage die ersten welschen Truppen in Bern einmarschiert!
Zwar geben sie in dieser Erklärung den Bauern — aber nur
«in Ansehung ihrer dankbaren, demüthigen und gehorsamen Annehmung
des einen und andern» — die feierliche Versicherung ab, dass
sie, die Herrn, «ihnen hiemit oberkeitlich zugesagt und in guten Treuen
versprochen haben wollen, alles das, was solche schriftlich gefasste
Abhandlung begreift, und wie dieselbe durch Unsere nächstvorgehenden
Schreiben vom 15. (25.) und 17. (27.) dress Monats May erläutert,
zu erstatten, zu vollbringen» —mithin auch, unter den dort gemachten,
schlauen Kautelen, die 50000 Pfund Kriegsentschädigung (als
Almosen für die «Landesarmuth»!), welch letztere aber im «definitiven»
Vertragswerk selbst nicht einmal erwähnt wird! Desgleichen wird den
Bauern «oberkeitlich zugesagt», über all dies «authentische Brief und
Siegel verfertigten und zustellen zu lassen». Dagegen wird bereits in
der Annahmserklärung selbst den Bauern aufs schärfste eingeheizt
«mit dem unverzüglichen Ab- und Wiederheimzug und gänzlicher Ablegung
aller Feindthätlichkeiten, an was Orten es sei... mit Oeffnung
der Pässe und Abschaffung der Wachten..., dannethin mit der anbedingten
unterthänigen Eideshuldigung, in völliger Aufhebung und Hintansetzung
alles dessen, was dem zuwider sein mag, hiemit auch, laut
Unserer Protestation, desjenigen bewussten Bundes...»
Und darauf die Antwort der Bauern, d. h. Leuenbergers, vom
29. Mai: «Wir, die vorgenannten und mit Namen verzeichneten» (leider
finden wir die auf diesem Dokument der Schmach stehenden Namen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 479 - arpa Themen Projekte
und gehorsame Unterthanen bekennen öffentlich hiemit, dass wir der
obigen, Unserer gnädigen Herren Erklärung gar wohl zufrieden sind,
und versprechen hinwiederum für Uns und die Unsern in guten Treuen,
allem demjenigen, so hievor geschrieben ist, durchaus nachzukommen
und alsobald wirklich zu verschaffen, getreulich, ehrbarlich und ohne
Gefährde.»
Kaum hatte Leuenberger diese letzte und endgültige Kapitulation
unterschrieben, so schickte er nach allen Seiten Boten aus mit Befehlen
zur Oeffnung der Pässe und Entlassung der Truppen, hob das Lager
auf dem Murifeld auf und gab Befehl zum Abmarsch von Bern. Einige
Kontingente waren schon am Tag zuvor nachhause aufgebrochen. Leuenberger
selbst scheint bereits am 29. abends wieder nach Schönholz
heimgekehrt zu sein, sicherlich in dem einfältigen Glauben, dass der
Krieg jetzt aus sei und beide Teile den «Frieden» treulich, Punkt für
Punkt, einhalten werden...
Wie jedoch die Berner Herren gesonnen waren, diesen «Frieden»
zu halten, das zeigt deutlich die Nachricht, die Bögli gibt: «Schon am
28. Mai» — mithin am Tag der Unterschrift unter den «allgemeinen
Vergoss» und noch bevor die Hauptmacht der Bauern von Bern abgezogen
war — «beklagten sich die Bauern aus dem Landgericht Sternenberg
(Neuenegg), dass man nach geschlossenem Frieden Aufständische
gefänglich einziehe»! Schon am 30. Mai musste Leuenberger selber sich
bei den Berner Herren darüber beklagen, dass zwei weitere aufständische
Bauern, einer aus Lauperswil, der andere aus Saanen, vertragsbrüchigerweise
verhaftet worden waren. Und das ging nun Tag für
Tag im ganzen Lande so weiter.
Noch eindeutiger trat der Wille des Berner Rates, diesen «schimpflichen
Frieden» nicht zu halten, in seinen ausserordentlich energisch
weiterbetriebenen Kriegsrüstungen zutage. Weil es sein Wille war, sich
durch kriegerische Gewalt von dem Murifeldvertrag zu befreien, weil
es für den Herrenhochmut unerträglich war, dass er sich mit solchem
Pack wie den Bauern auch nur hatte vergleichen müssen, mochte dieser
Vergleich noch so vorteilhaft für die Herrenprivilegien sein, deshalb
gab der Berner Rat, wie Peter erzählt, «Zürich keinen offiziellen
Bericht vom Friedensschluss, sandte vielmehr nur die Botschaft, er sei
von den Bauern zu sehr ,disreputierlichen Konditionen' gezwungen
worden»! «Um so energischer trieb der Rat von Bern den von Zürich
zum Ausmarsch an und betrieb fieberhaft die Mobilisation der eigenen
verfügbaren Truppen, die, verstärkt durch Kontingente von Genf, Biel,
Neuenburg und Neuenstadt, bis am 3. Juni 7000 Mann stark marschbereit
in der Hauptstadt standen.»
Dies also war der Zweck des «unverzüglichen Ab- und Wiederheimzugs»
und der «gänzlichen Ablegung aller Feindthätlichkeiten»,
der «Oeffnung der Pässe und Abschaffung der Wachten», die den Bauern
am 28. Mai zugemutet und von Leuenberger treugläubig, unverzüglich
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 480 - arpa Themen Projekte
Hinrichtung der sieben Bauernführer
der Basler Landschaft
|
am 24. Juli 1663 vor dem Steinentor in Basel |
|
Vii Schad aus Oberdorf durch den Strang, rechts oben; die |
|
Nach einem zeitgenössischen, handkolorierten Originalstich in |
|
Aus: Sigismondi Latomi Relationis Historiae Semestrialis Continuato |
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 480 - arpa Themen Projekte
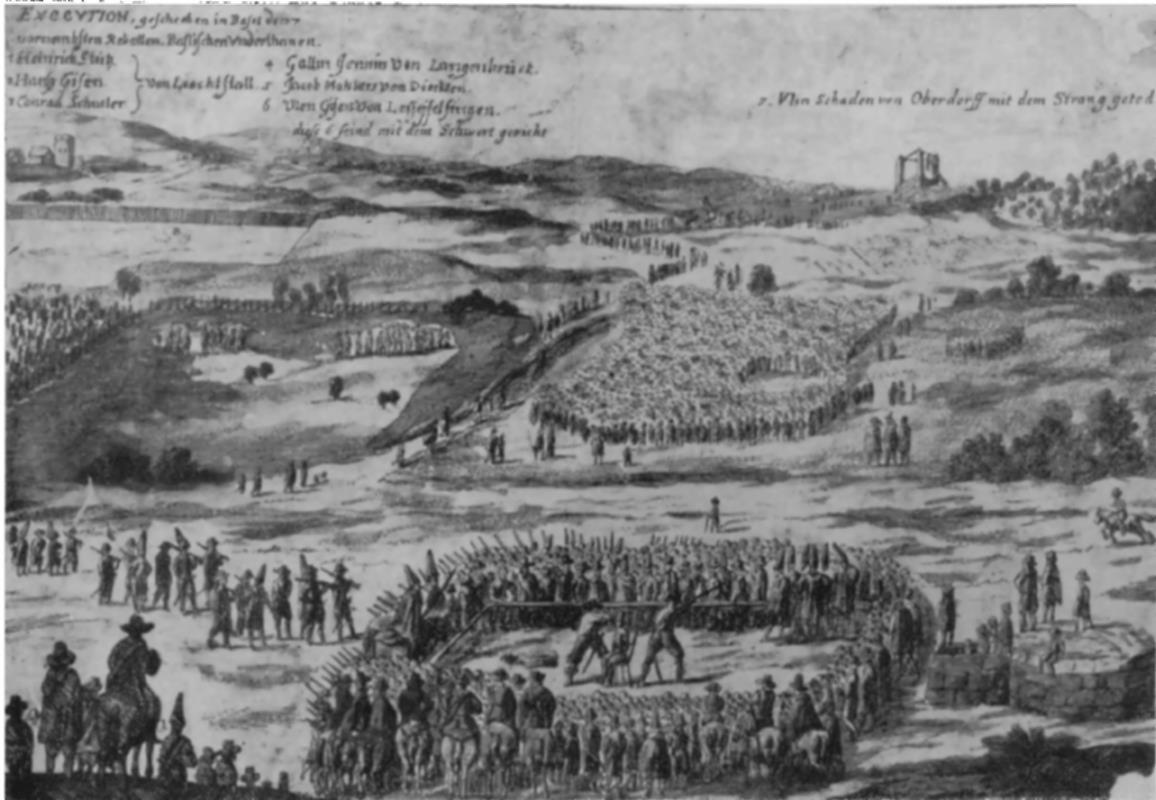
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 481 - arpa Themen Projekte
Aargauer allerdings hatten allen Grund, dem Befehl Leuenbergers zu
trotzen, weil man dort, wie Peter sagt, «in Furcht lebte, die Zürcher
werden nun doch noch ausrücken. Wie sehr die Unteraargauer recht
hatten, erfuhren sie, als in der Morgenfrühe des 30. Mai von der Höhe
des Heiterberges herab Kanonenschüsse das Heranrücken der zürcherisch-ostschweizerischen
Armee verkündeten»! Aber selbst die Oberaargauer,
so die Leute von Langenthal, Bannwil, Aarwangen, Wynau,
Roggwil und Melchnau, aber auch viele Emmentaler, trotzten jetzt den
Befehlen Leuenbergers und zogen am 30. Mai scharenweise, erbittert
und ergrimmt, den Luzerner Bauern zu, deren Hauptmacht immer
noch, den Ablauf des Waffenstillstands am 3. Juni abwartend, vor ihrer
Hauptstadt lag.
In der Tat hat der Herrenchronist Peter leider nur zu recht, wenn
er zusammenfassend sagt: «Mit dem Murifelder Vertrag hatte der Berner
Rat seine Hauptabsicht, Sprengung des Huttwiler Bundes, bereits erreicht.
Dass Leuenberger undiplomatisch genug war, eine solche Bedingung»
—und, fügen wir hinzu, vor allem auch die Bedingung der
sofortigen Waffenniederlegung ohne Gegenrecht —«einzugehen, rächte
sich an ihm in entsetzlicher Weise und nahm dem grossen Bauernbunde
schon jetzt die Hauptwiderstandskraft»!
So also hat Niklaus Leuenberger, der Mann, in dem sich die ganze
Hoffnung des Volks für einige Wochen so erschütternd vertrauensvoll
und einmütig verkörpert hatte, das Erstgeburtsrecht der schweizerischen
Bauernklasse auf die «Eidgenossenschaft» für ein Linsengericht
dahingegeben — ein armer, bedauernswerter und wahrhaft «kleinfügiger»
Untertan!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 482 - arpa Themen Projekte
XVIII.
Die «nöthige Abtreibung unbilliger Gewalt»
Oder: Des eidgenössischen Zwischenspiels dritter Teil,
welcher zeigt, wie «Volk» sich gegen Volk missbrauchen
lassen kann
Die am 29. Mai von den Berner Herren in solch volksbetrügerischer
Weise erreichte Entwaffnung und Zerstreuung der Leuenbergerschen
Armee war für die Herrenklasse der ganzen Schweiz das Signal
zum entscheidenden Angriff auf die Bauernklasse und zu deren endgültiger
Niederwerfung. Die Vernichtung jeder Möglichkeit der Wiedererhebung
alter Bauerndemokratie mittels militärischer Gewalt —das
war es, was die Herren Aristokraten die «nöthige Abtreibung unbilliger
Gewalt» nannten!
Jetzt fiel die grosse Rolle an Zürich, den Vorort der Herren-' «Eidgenossenschaft».
Dieser hatte, wie wir sahen, von Anfang an alle demagogischen
Künste spielen lassen —betrügerische Versprechungen in
Reden und Mandaten, leutselige Visitationen durch herumreisende Ratsherren,
mit anschliessenden Gastereien für die Landesausschüsse auf
Kosten des Staatsseckels und dergleichen mehr —, um nur ja als Vorort
im geeigneten Augenblick in der Lage zu sein, ohne Gefahr des
Aufstands im eigenen Rücken gegen die Aufständischen der anderen
Kantone losschlagen zu können. Trotz diesen Anstrengungen aber und
trotzdem der Zürcher Bauernschaft sieben Jahre zuvor, bei der blutigen
Niederwerfung des Wädenswiler und Knonauer Aufstandes, das
Rückgrat bereits weitgehend gebrochen worden war, schien selbst die
Zürcher Landschaft zuletzt noch in den kritischen Zustand einer heranreifenden
Rebellion hineinzuwachsen.
Das geht zum Beispiel aus einem Brief des damaligen Bürgermeisters
von Schaffhausen, Hans Heinrich Ziegler, hervor, den dieser
am 17. Mai an den von der Tagsatzung her in Baden zur Kur verbliebenen
Zürcher Bürgermeister Waser schrieb, dem er doch gewiss
nichts offensichtlich Unrichtiges über die Gesinnung der Zürcher Untertanen
vormachen konnte. Ziegler, dessen leider nur allzu begründete
Kritik an der militärischen Ohnmacht der Bauern, wie wir sie früher
kennen lernten, in demselben Brief als Ansporn zu raschen kriegerischen
Taten der Herren steht, schreibt darin weiter: jetzt sei es an der
Zeit, «dass man sich mit erforderlicher Anzahl gegen die Rebellen verfasse
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 483 - arpa Themen Projekte
Macht ausziehe...» Und zur Begründung sagt er nicht nur, dass auf
die Stadt Zürich «alle Welt sehen und nach derselben Thun und Lassen
ein jedes Ort der Eidgenossenschaft das Mass nehmen» werde.
Vielmehr wagt er, um den Vorort anzuspornen, der aus Furcht vor
dem Aufstand der eigenen Untertanen den eidgenössischen Auszug verzögerte,
eben diese Furcht zum Stachel rascher Entschlüsse zu machen,
indem er Waser schreibt: «Es ist heut an bewussten IV Städten
(Luzern, Bern, Solothurn und Basel); morgens kommt die Kehrordnung
an andere Orte, namentlich an die Stadt Zürich, dero Undertanen
zum Theil in Schulden tief versteckt, dass von denselben sich zu entledigen
sich keine andern Mittel werden finden, als zu rebellieren und
novas tabulas, das ist Erlassung aller Schulden zu begehren...»
Eine solche Sprache wäre Waser gegenüber sinnlos gewesen, wenn
sie nicht sehr wirkliche Verhältnisse betroffen hätte, mit denen man
ihm die Hölle heiss zu machen vermochte! Ebenso, wenn Ziegler fortfährt:
«Dieser Tage ist mir fürkommen, das ich zu erwysen dem Ueberbringer
überlasse (der also gewisse Leute bei Waser denunzieren
musste), dass gwüsse Lüt im Zürichbiet gredt,. sy die Festung Zürich
wider brechen müessend; denn so sy sollte aufgebaut werden, möchte
man sie (die Untertanen) zu allem, was es wäre, zwingen sollen...»
(An dieser Festung baute einer vom kriegerischen Werdmüller-Clan,
der Zürcher Feldzeugmeister Johann Georg Werdmüller, schon seit
dem Jahr 1642 und vollendete sie erst im Jahr 1677. Sie hat alsdann
ja wirklich die Zürcher Untertanen bis ins Jahr 1798 «zu allem, was
es wäre», gezwungen!) Aus diesen Gründen, und vor allem auch, weil
das Beispiel der Unabhängigmachung der Entlebucher das Exempel
gegeben, «dergleichen an andern Orten auch einzuführen», «darum
meine ich» — schreibt Ziegler — «seie in der vor Augen schwebenden
Gefahr mit gebührender Macht und Ansehn entgegenzugehen, nit ze
hasardieren, die Rebellen aber ohne Unterlass aufzuhalten».
Hier noch ein weiterer Beweis für die Ernsthaftigkeit der auch
für die Zürcher Herren, trotz ihren Bemühungen, heranreifenden Gefahr,
— die von allen Herrenchronisten stets schönfärberisch hinweggeleugnet
wird; was zugleich die Aermlichkeit des hierüber publizierten
Quellenmaterials erklärt. Als alles längst vorüber war, am 5. .Juli,
schrieb ein anderer auswärtiger Standesherr, der bündnerische Oberstlieutenant
Ambrosius Planta von Wildenberg, einer der drei Regenten
Graubündens, aus Malans an einen andern Zürcher Magistraten, den
Standesunterschreiber J. H. Holzhalb, ein Entschuldigungsschreiben
über die Gründe des Ausbleibens des Bündner Truppenzuzugs bei der
militärischen Abrechnung mit den Bauern. Da war nämlich während
des Aufgebots und den Werbungen des Vororts in der ganzen Ostschweiz
für die Herrenarmee der Tagsatzung, in der zweiten Hälfte
des Mai, auch «unter dem Bündner Volke eifrig Stimmung für die Bauern
gemacht worden». Und zwar hätten da, wie Planta berichtet, nicht
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 484 - arpa Themen Projekte
jemand heimlicherweise im Lande gehabt, der das Volk
sehr eingenommen»; vielmehr «hat ess auch von den Eurigen (Zürchern!),
die zu den unsrigen nit wenig ins Land kommen, ulf wenig
gegeben, die fit allein die Landvogt der rebellischen Orten, sondern
auch die Oberkeiten, dass sie die Freiheiten geschwächt, uffs Höchst
anklagt: viii der Unsrigen haben solche schändliche Verläumdung begierig
angehört». Damit wird also von kompetentester Seite ein Teil der
«Schuld» an der Verhinderung des bündnerischen Aufgebots für die
Tagsatzungsarmee direkt auf die aktiv aufwieglerische Tätigkeit von
Zürcher Untertanen im Interesse der allgemein schweizerischen Bauernrevolution
zurückgeführt. Das aber setzt eine viel weitere Verbreitung
der revolutionären Stimmung auch auf der Zürcher Landschaft
voraus, als sie von irgendeinem unserer Geschichtschreiber zugegeben
wird!
Es war also keineswegs nur die von den Herrenchronisten so beflissen
herausgestellte «Friedensliebe», «Weisheit» oder «Güte» der
Zürcher Regierung, wenn diese bei der Durchführung des Aufgebots
und gar des Auszugs selber trotz der unausgesetzten flehentlichen
Mahnungen der Luzerner, Berner und Basler Herren anfänglich überaus
zögernd vorging. Es war vielmehr in erster Linie die nackte Angst
um die eigene Existenz, was den Zürcher Rat dazu zwang, die eigenen
Bauern mit Samthandschuhen anzufassen und die andern Schweizer
Herrenregierungen inzwischen zu «gütlichen» Vergleichen, d. h. zum
Hinhalten der Bauern, zu veranlassen. Darum war der Zürcher Rat,
nach Peter, so «ängstlich bemüht, seinen Untertanen ja klar zu machen,
dass die Schuld am bevorstehenden Kriege durchaus bei den
Bauern liege»; zu dem Zweck nämlich, «,umb das Volk desto williger
ze machen', dem Truppenaufgebot Folge zu leisten». Das war mithin
dringend nötig, und das kostete Mühe und Zeit, Visitationen und Gastereien.
Diese Methode, meint Peter, «nahm den Unzufriedenen unter
der zürcherischen Landbevölkerung zum voraus jede Veranlassung,
allenfalls zu revoltieren».
Aber es gab dafür noch eine andere Methode: wie ein im ganzen
Schweizerland weit verbreitetes Gerücht —das z. B. die Baselbieter
Bauern fuchsteufelswild gegen die «vermitteln» wollenden Zürcher
Ratsherren machte —wahr haben wollte, wurden alle Zürcher Landleute,
die bei den «freundlichen» Anfragen den Vorbehalt machten,
«dass man sie nit wider die Eidgenossen ze ziehen gringstens gebruche»,
in aller Stille gefänglich eingezogen und «allersyths in Thurn gesteckt».
Sicher ist, dass zur «Beruhigung» der Zürcher Landschaft auch ein
ausgedehntes System polizeilicher Ueberwachung nötig war. So wurde
beispielsweise sämtlichen Vögten und Untervögten «die allersorgfältigste
Ueberwachung aller Verdächtigen, durch das Land reisenden
Personen anbefohlen», «vor allein sollten die Bettler überall verhört
und je nach dem Befund ausgewiesen oder nach Zürich eingeliefert
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 485 - arpa Themen Projekte
wie im Kanton Bern, die Prädikanten zuverlässige Dienste; so meldet
beispielsweise am 22. Mai der Pfarrer Bassler von Uster der Regierung,
«es hätten sich in seinem Dorfe Bettler aus den aufständischen Gebieten
herumgetrieben» — was man so «Bettler» nannte!...
Der Bürgermeister Waser selbst, der noch bis zum 25. Mai zu Baden
die Kur genoss, verschmähte nicht, von dort aus persönlich den
Polizeikommissar zu spielen: er liess in Baden eine ganze Gruppe von
fünf Lenzburger Bauern verhaften und ins Zürcher Gefängnis abführen,
um sie dort «im Wollenberg examinieren» zu lassen. Waser ging
dabei offenbar so zornig ins Zeug, dass er Freund und Feind nicht
mehr zu unterscheiden vermochte: er gab dem Gefangenentransport
gleich auch den Pfarrer Niklaus Hürner aus Gränichen samt dem dortigen
Schulmeister mit, die beide doch eifrig nur zu dem Zweck im
Lande herumreisten, um —ganz im Interesse der Herren —die Bauern
zu versöhnen und abzumahnen.
In den fünf Bauern allerdings machte Waser einen guten Fang:
es waren Ausgeschossene einer grossen Versammlung von Lenzburger
Bauern in Suhr, und zwar der bei den Regierungen als «Erzrebell» berüchtigte
Seckelmeister von Suhr Uli Suter, der, samt dem Suhrer
Tagelöhner und Viehtreiber Uli Schnyder und den Untervögten Lüscher
von Schöftland und Kuli von Niederlenz, sowie Felix Hilfiker von Oberlenz,
in den Thurgau delegiert war, in der Hoffnung, «durch Sendboten
Bundesgenossen in der Ostschweiz werben zu können, um den gefürchteten
Auszug der Zürcher zu hintertreiben»! Da war nämlich zu diesem
Zweck auf den 28. Mai, hauptsächlich durch Metzger und Viehhändler
aus der ganzen Ostschweiz, besonders auch aus dem Kanton Schaffhausen,
aber auch «auf Zusprechen einiger Zürcher Metzger», eine
grosse Landsgemeinde nach Weinfelden einberufen worden, und auf
dieser sollten die fünf Bauerndeputierten aus der Grafschaft Lenzburg
das Wort ergreifen. Sie waren dazu von den Hauptorganisatoren der
Landsgemeinde, vom Viehhändler Hans Hanhart aus Diessenhofen und
dem Metzger Hans Kern von Berlingen, ausdrücklich durch ein Schreiben
eingeladen worden, das diese bei einem Treffen in Rafz am 19. Mai
aufgesetzt und durch den eifrigen Boten Uli Schnyder in den Aargau
gesandt hatten.
Nun sassen also die fünf Sendboten der Aargauer an die Thurgauer
Rebellen im Zürcher Wellenberg und wurden, wie der Rat von
Zürich am 29. an den von Bern schrieb, bereits «ernstlich examiniert».
d. h. gefoltert; «bisher aber haben wir von ihm (d. h. speziell von Uli
Suter) nichts erfahren, als dass sie ausgeben, der Friede sei gemacht
und hat er behouptet, ihr habet den Untertanen 50000 Pfund Kosten
bezahlen und sie in unserem Land und im Thurgau und etlichen gemeinen
Herrschaften den Auszug hindern wollen...» Was alles, wie
wir wissen, die pure Wahrheit war.
Aus alledem geht hervor, wie nahe kurz vor der Katastrophe der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 486 - arpa Themen Projekte
und dass ein einziger Sieg der Bauern die Lage in der ganzen deutschen
Schweiz völlig zu deren Gunsten umgestürzt hätte: in Graubünden wie
in den Kantonen Zürich und Schaffhausen —denn auch «die Stimmung
in Schaffhausen war den Bauern grösstenteils günstig», wie Liebenau
feststellt —, und erst recht in den «gemeinen Herrschaften», im Thurgau
und im Rheintal; aber, wie wir schon früher sahen, auch in den
innerschweizerischen Kantonen. Wieder einmal hatte also, rein militärisch
gesehen, Zwyer recht, wenn er noch vor seiner Abreise zum Kaiser
warnend an Waser geschrieben hatte: «Die Rebellischen sind sicher
zahlreicher und gefährlicher als man sich einbilden kann. Wir müssen
auch, meines Ermessens, eine grössere Macht gegen dieselben aufstellen,
als wir früher vereinbarten, wenn anders man nicht Spott und
Schaden gewärtigen und den obrigkeitlichen Kredit in Gefahr setzen
will.»
Tatsächlich machte der Zürcher Rat seit dem Ratschlag des «Geheimen
Rates» vom 17. Mai —neben den Vorbereitungen zum normalen
Aufgebot — ganz aussergewöhnliche Anstrengungen zur Werbung
von sogenannten «Freiwilligen», d. Im. von gedienten Kriegsleuten,
Landsknechten, Söldnern, deren es ja, seit ihrer massenweisen Entlassung
aus fremden Kriegsdiensten am Ende des dreissigjährigen Kriegs,
im ganzen Schweizerland so überschüssig viele gab. Zu diesem Zweck
wurden jedem Hauptmann im Dienste des Vororts 300 Gulden zur Verfügung
gestellt. Nicht zu Unrecht hoffte man, aus dieser für Geld zu
allem bereiten Söldnerschar des entwurzelten, arbeitslosen und in Hunger
vorkommenden schweizerischen Lumpenproletariats die bedenkenlos
ergebene Kerntruppe der Bürgerkriegsarmee zu machen.
Um solche «Freiwillige» handelt es sich, wenn Peter in durchaus
irreführender Weise berichtet: «in Zürich stellten sich seit dem 20. Mai
täglich Freiwillige». Diese Richtigstellung ist umso wichtiger, als Peter
weiter feststellt «vorläufig wurden nur Freiwillige angeworben». Das
nämlich heisst: es wurde mit dem Aufgebot des normalerweise dienstpflichtigen
Volksteils zugewartet, bis die Herren im Besitz einer «zuverlässigen»
Bürgerkriegstruppe waren; «zuverlässig» als gekaufte
Söldner, und dies zwar nicht nur gegenüber den Aufständischen, zu
deren Niederwerfung sie angeworben wurden, sondern auch gegenüber
dem eigenen Zürcher Volk. Dies geht indirekt sogar aus einem Zitat
bei Peter selbst hervor. Dieser nämlich zitiert über die hier zur Rede
stehende Werbung das Urteil des aufrechten Demokraten David Nuscheler
aus dem Jahr 1853, dem das Gebaren der Herren von 1653 immerhin
Gewissensbisse verursacht und der es sich daher folgendermassen
zurechtzulegen sucht: «Obschon diese angeworbenen Kriegsleute
mit unsern heutigen Begriffen von Bürgersoldaten im grellen
Widerspruche stehen, so lässt es sich dennoch erklären, warum in einer
Zeit, in welcher disponible gediente Soldaten wohl in Ueberfluss vorhanden
waren, man daran dachte, neben den aufgebotenen Miliztruppen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 487 - arpa Themen Projekte
zu verschaffen, um für jene im Notfall als Stützpunkt dienen zu können;
abgesehen davon, dass Freiwillige in der Regel zuverlässiger sind
als Unfreiwillige.»
Diese immerhin auffällige und am Ende vielleicht das Volk aufreizende
Verwendung von «Volk» gegen Volk musste natürlich durch
die in diesen Künsten schon von jeher glänzende Zürcher Regierung
moralisch getarnt werden. So berichtet denn Peter: «Das Mandat an
die Landbevölkerung, das am 25. Mai von den Kanzeln verlesen wurde,
verkündigte: damit diejenigen, die mit notwendiger Feldarbeit beschäftigt
seien, mit einem Aufgebot verschont werden möchten, habe der
Rat ,aus vätterlicher Wohlmeinenheit und Sorgfalt angeordnet, dass
usa den ordenlichen Quartieren nit abermalen ganze Compagnien ussgezogen
werden, sondern insgemein freiwillige Werbung under gwüssen
bestellten Houptlüten beschechen so!'. Gleichwohl werde jedermann
ernstlich gemahnt, sich für den Notfall wohlgerüstet zu halten.»
So «schonend» ging der Rat zu dem ausdrücklichen Zweck vor, «damit
man auch die biderben Landlüth ze völligem Willen habe».
Ausserdem scheint der Zürcher Rat in seiner Angst vor heimischem
Aufruhr heimlich gerade das getan zu haben, wovon er gleichzeitig
die Basler Regierung durch seine «Ehrengesandten» so flehentlich
Abstand zu nehmen hat: er scheint in der Tat für den Notfall —
und als solcher galt ihm zweifellos ein eventueller Aufstand auf der
Zürcher Landschaft —im Ausland vorsorglich Truppen geworben zu
haben! Jedenfalls berichtet der venezianische Gesandte am 24. Mai aus
Zürich an seine Regierung: «Der Herzog von Würtemberg biete auch
eine bedeutende Truppe zu Fuss und zu Pferd auf.» Ausserdem wurde
auch nach Peter im «geheimen Rat vom 20. Mai» die Frage aufgeworfen,
«ob man nicht den Fürst von Fürstenberg in Würtemberg eine
Anzahl Reiter anwerben lassen wolle».
Wie geheim der Zürcher Rat dabei zu Werke gegangen sein mag —
Tatsache ist, dass davon bereits in den Zwanziger Tagen des Mai etwas
ins Zürcher Volk durchgesickert sein muss. Denn selbst nach dem
Zürcher Herrenchronisten Peter wurde in diesen Tagen <im Wehntal
geredet, die zürcherische Regierung lasse in Würtemberg und anderwärts
(Konstanz) Truppen anwerben; ein Zürcher, Heinrich Heer, der
in Würtemberg diente, bringe die Truppen ins Land, bereits seien 1400
Reiter vom Hohentwil her im Anzug». Ja, die Wehntaler rebellierten
deshalb, aber auch aus direkter Solidarität mit den Berner Bauern,
gegen die Aushebung der Tagsatzungstruppen in ihrem Gebiet: «viele
äusserten sich nach der Kirche im Privatgespräch» (am Sonntag, dem
25. Mai), sie «wellind nit ins Bernpiet, die Puren tot ze schlagen».
Kein Wunder, dass im Wehntal deshalb geheime Landsgemeinden
stattfanden, als Hochverrat geltende «Gmeinden hinder dem Rücken
der Fürgesetzten», die der Obrigkeit zu deren Schrecken den Auszug
gegen die aufständischen Bauern der andern Kantone verweigerten.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 488 - arpa Themen Projekte
am 27. in Schöfflisdorf; wobei der Zimmermeister Joggli Schybli von
Niederweningen und Hans Bucher, der «Sohn des alt Untervogts», sowie
der Schmiedemeister Heini Müller von Schöfflisdorf, die führenden
Personen waren. Obwohl nun Joggli Schybli einem jeden, «der
über die Versammlung vorzeitig etwas ausplaudere», androhte, ihn,
«der Tüffel solle inn hohen, zu erschiessen» — waren doch der Prädikant
Stalder zu Niederweningen und der Untervogt Bucher daselbst
in der Lage, «schleunigst Bericht ins Schloss Regensberg und nach
Zürich» zu schicken, sodass schon am selben Abend sowohl Joggli
Schybli wie Hans Bucher (mithin von seinem eigenen Vater ausgeliefert)
gefänglich nach Regensberg eingeliefert werden konnten. So
glänzend funktionierte sowohl die weltliche wie die geistliche Polizei
des Systems Waser im Kanton Zürich.
Abgesehen von diesem «Weninger Handel» also vollzog sich —
wenn man unsern Herrenchronisten Glauben schenken will —sowohl
die Aushebung der Dienstpflichtigen wie auch die Anwerbung von
«Freiwilligen» (d. h. vor allem bezahlter Söldner) seitens des Vororts
anscheinend ziemlich reibungslos. «Es ist nit zu sagen, mit wass guetem
willen sich das Volckh der Obrigkeit überal zur Verfügung stellte»
— so äussert sich ein serviler Zeitgenosse über die Mobilmachung der
Tagsatzungsarmee in Zürich. Aber solche servilen Zeitgenossen gibt es
bekanntlich zu jeder Zeit, und ihre Aeusserungen werden von den
servilen Zeitgenossen späterer Zeiten, besonders unter den Geschichtschreibern,
mit Vorliebe weitergereicht. So auch diese Aeusserung, und
zwar durch Peter, der nicht verfehlt, sie zu unterstreichen, indem er
deren Urheber noch besonders «freudig über den vollkommenen Gehorsam
der Untertanen» sein lässt.
Was die Aushebung der Dienstpflichtigen betrifft, so wurde diese
absichtlich sehr zögernd in Gang gesetzt; dies durchaus nicht aus Versöhnlichkeit
oder allzu gutmütiger Sorglosigkeit, wie dies unsere Herrenchronisten
durchweg behaupten; vielmehr, wie wir sahen, aus
schlecht verhehlter Ueberangst vor dem Aufstand auf der eigenen
Landschaft. Während die Werbung bezahlter Söldner bereits seit dem
17. fieberhaft in Gang war, um diese «sichere» Truppe zunächst in die
Hand zu bekommen, erging erst am 22. der Befehl an die Quartierleute
der vier Militärbezirks, in die der Kanton eingeteilt war (das Wädenswiler-,
das Grüninger-, das Eglisauer- und das Trülliker-«Quartier»):
«Da in unserem Land grosse Unruhen zu besorgen, so so! gegen
die Friedensstörer der erforderliche Gwalt errichtet werden; desswegen
solen sie befürderlichst in iren Quartieren den obrigkeitlichen Bricht
eröffnen lassen und dass Volk ze Ross und Fuess auffmahnen und in
Bereitschaft halten., Doch bedeutete auch dies noch nicht unmittelbar
die Mobilisation. Vielmehr «erst als am 24. Mai Bericht einlief, die
Freiämter Bauern hätten sich erhoben, das Fahr zu Windisch sei unterbrochen,
Brugg und Aarau würden belagert und dass Bern seit dem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 489 - arpa Themen Projekte
,alles Volk aufzumahnen', und wenn nichts anderes vorfälle, solle
Werdmüller am 27. mit den beiden andern Kommandanten in Basel
weitere Verabredung treffen». Ebenfalls erst «unterm 24. erliess der
Vorort auch eine neue Mahnung zu allereilfertigstem Aufbruch an
Schaffhausen, St. Gallen und Appenzell» — «nahm indessen gleichzeitig
die nochmalige Absendung einer Vermittlungsgesandtschaft aller evangelischen
Orte nach Bern (wie an der Monatswende März/April) in
Aussicht, sobald die Truppen ins Feld gerückt wären».
Jedoch in der eigentlichen Ostschweiz, in St. Gallen, in Appenzell,
im Thurgau und besonders auch in Graubünden erhoben sich grosse
Schwierigkeiten gegen die Truppenaushebung für die Tagsatzungsarmee.
Der generelle Grund war, wie selbst Peter zugeben muss, «dass
bei den Landleuten von Appenzell und den Bürgern von St. Gallen, sowie
den Untertanen des Abtes keine grosse Neigung vorhanden war,
gegen die Bauern auszurücken». Dies gilt natürlich erst recht von den
Thurgauer Bauern — von denselben Herrenregierungen schwer unterdrückte
und bis zum Weissbluten ausgebeutete Untertanen, denen sie
zu Hilfe ziehen sollten. Noch am 30. muss der Landvogt Egloff zu Romanshorn
berichten: «Grosse Schwierigkeiten bei den Gosswylern und
Romanshornern, das Geld für die Ausziehenden aufzubringen.., ist
halt eine grosse Armut in dem Volckh.»
Kein Wunder, dass eine vom Rat und vom Abt von St. Gallen mit
den beiden Appenzell am 24. gepflogene Konferenz in St. Gallen «beschloss,
mit dem Truppenaufgebot zum Auszug gegen die Bauern vorläufig
noch zuzuwarten». Kein Wunder auch, dass man bei dieser allgemeinen
Volksstimmung in der Ostschweiz gar nicht gewagt hatte,
das Schimpfmanifest der Tagsatzung, das am 20. überall anderswo
verkündet worden war, zu veröffentlichen. Auch auf der St. Galler Konferenz
wagte man nicht, es wörtlich bekanntzugeben, sondern beschloss
nur, «dass man Essenciam daraus nemmen und dem Volckh nit mit
so scharpfen Worten (da durch solche das Volckh mehr erbittert wurde)
wie im Manifest, vorhalten solle»! Erst als die flehentliche Mahnung
Zürichs «um lenden würcklichen Bysprung» anderntags eingetroffen
und nachdem abermals, am 27., eine Konferenz nach St. Gallen einberufen
worden war, zu welcher ein neues «scharpfes Zürcherisches Anmahnungsschreiben»
einlangte, erliessen Rat und Abt von St. Gallen
sowie Appenzell-Innerrhoden das Truppenaufgebot. In Appenzell-Ausserrhoden
dagegen war man noch am 28. Mai «nicht definitiv zum
Ausrücken entschlossen». Erst am 29. Mai «rückten die (katholischen)
äbtlichen Truppen über den Hummelwald Luzern (direkt) zu Hilfe; an
demselben Tage zogen die (protestantischen) Stadt St. Galler aus und
am 30. die Appenzeller, um zur zürcherischen Armee zu stossen».
In Graubünden aber kam es gar nicht erst zum Aufgebot, weil
dort, wie wir sahen, die Sympathien für die aufständischen Bauern —
besonders diejenigen der katholischen Bündner Oberländer für die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 490 - arpa Themen Projekte
einen so wichtigen Entscheid nicht diktatorisch durch die Häupter der
drei Bünde treffen lassen konnte, sondern ihn zur Abstimmung an
sämtliche souveränen Gemeinden des Landes weiterleiten musste. Als
beispielsweise die «Haupt und Rät» am 25. in Chur zusammentraten,
«verweigerten die Disentiser und Lugnezer den Auszug rundweg» —
ohne dass hier irgend jemand gewagt hätte, Strafexpeditionen gegen
diese auszusenden wie der Zürcher Polizeistaat gegen die Wehntaler.
Noch am 31. Mai schrieb der venezianische Gesandte an seine Regierung:
«Die Bündner erwiesen sich in der Zusendung von Hilfe nicht
gerade bereitwillig; bis jetzt haben sie unter verschiedenen Vorwänden
gar nichts vorgenommen; das Bündnis sei nämlich nicht so weitgehend,
dass sie alle unterstützen müssten (!), dann könnten sie die Beweggründe
der beiden Parteien (der Herren und der Bauern) noch erfahren
(!)...» In all diesen Argumenten drückt sich die grössere Freiheit
aus, in der sich die drei Bünde —im Vergleich nicht nur mit den
ausgesprochen aristokratischen, sondern auch mit den sogenannten
Landsgemeinde-Kantonen — zu erhalten vermocht hatten. In der Tat
hat sich die Stufe der ursprünglichen Demokratie — wenn auch von
manchen Aristokratenfamilien ständig auch hier bedrängt, verfälscht
und erpresst —doch im Prinzip nirgends in der Schweiz so zäh zu erhalten
vermocht wie in den Bündner Bergen.
Trotz all diesen Schwierigkeiten gelang es den Zürcher Herren,
eine immerhin sehr ansehnliche Tagsatzungsarmee aufzubringen, insgesamt,
mit allen späteren Zuzügen, 9-10000 Mann. «Bereits am 26.
Mai», berichtet Peter, «inspizierte man auf dem Paradeplatz 1500
Mann ,gewordenen Volks', die vier Freikompagnien (ca. 900 Mann),
450 Reiter und die Artillerie samt reichlicher Zubehör, die Genietruppen
und den zahlreichen Train mit zirka 450 Mann, und ,ward alles
wo! gerüst und marschbereit befunden'...» Dazu stiessen nun Tag und
Nacht von allen Seiten immer neue Kontingente aus den umliegenden
Kantonen, sodass die Stadt Zürich, trotz ihrer zahlreichen Zunfthäuser,
die Masse der Soldaten nicht mehr zu fassen vermochte und auch die
nächstgelegenen Vororte, besonders an den unteren Seeufern, überfüllt
waren. Da nun —wie Peter berichtet — «der Landvogt im Thurgau
Bericht schickte, am 30. werde das Hauptkontingent der Thurgauer,
900 Mann stark,... in Zürich eintreffen, so erteilte General Werdmüller
Befehl, dass sich alle in und um Zürich liegenden Truppen auf
der Schlierener Allmend versammeln sollten. Am 30. Mai marschierten
um sieben morgens sämtliche Truppen auf den bestimmten Sammelplatz».
Hier fand noch am selben Tag die erste Generalmusterung statt,
die in der feierlichen Vereidigung der Armee gipfelte und durch einen
Feldgottesdienst abgeschlossen wurde. «Nachmittags um 2 Uhr», erzählt
Vock, «erschienen mit der Standesfarbe Bürgermeister Heinrich
Waser und Generallieutenant Joh. Jakob Leu und nahmen auf offenem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 491 - arpa Themen Projekte
Soldaten, in Eid und Pflicht. Hierauf ermahnte der erste Pfarrer am
Grossen Münster in Zürich, Joh. Jakob Ulrich, die versammelten Truppen
zur Gottesfurcht während des nun zu eröffnenden Feldzugs, und
er stellte ihnen vor, welche Pflichten sie gegen Gott, gegen den Nächsten
und gegen sich selbst zu erfüllen haben, wenn sie wünschen, dass
Gott ihren Ausgang und Eingang segne.» «Eine schöne Ermahnung»,
merkt der Landschreiber Hans Kaspar Scheuchzer, der den Feldzug
als Regimentsschreiber mitmachte, in seinem Tagebuch an; aber selbst
dieser treu ergebene Herrendiener muss nach erlebtem Feldzug an dieser
Stelle hinzufügen: «es haben leider! die Reuter derselbigen keinen
Platz gegeben, sondern hin und wieder die Dörfer ganz usgeplündert
und die schönen Früchte verderbt».
Doch bevor wir uns nun mit der Zürcher Soldateska in den «Feldzug»
stürzen, der dazu bestimmt war, der schweizerischen Bauernklasse
das Rückgrat für immer zu brechen, wollen wir uns die militärischen
Führer der Zürcher Tagsatzungsarmee etwas genauer ansehen —
wir werden dann Vieles besser begreifen.
Am 21. Mai hatte der Zürcher Rat die militärische Führerschaft
formell endgültig bezeichnet, über die zwar seit langem niemand im
Zweifel war. Sie fiel als ganz selbstverständlich der Familie Werdmüller
zu, die mit einem gewissen Recht als die militärische Geniefamilie
Pat excellence unter den Patrizierfamilien Zürichs, ja selbst
der ganzen Schweiz, galt. Nicht weniger als vier Werdmüller, aus drei
verschiedenen Zweigen dieser Familie, sassen in der Leitung der Herrenarmee
zur Niederschlagung des Bauernaufstands. Zwei von ihnen
waren zu diesem Zeitpunkt Mitglieder der Zürcher Regierung; die andern
beiden wurden es ein wenig später. Kurz, es handelt sich bei den
Werdmüller um einen zu dieser Zeit in seiner Vollkraft stehenden
typischen Schweizer Herren-Clan im Vollbesitz der Privilegien, die sich
diese Klasse in der ersten Blütezeit des Absolutismus angeeignet hatte.
Wirtschaftlich beruhte ihre Macht ursprünglich auf Handwerks-, dann
Handelskapital; der Zweig des Seckelmeisters, die sogenannte «Linie
Christoph», war noch auf der alten Familiengründung, der Werdmühle,
sesshaft geblieben. Dann wurden die Geschäfte der Familie zu europäischen
Grosshandelsgeschäften, die nichts mehr mit dem Müllerhandwerk
zu tun hatten. Schliesslich kam das Söldnergeschäft hinzu, das
diese Familie im Dienste fremder Fürsten in ganz grossem Stil ausübte.
Zum Generalissimus der Tagsatzungsarmee — jedoch ohne Befehlsgewalt
über die Berner und Luzerner Truppen — wurde Johann
Konrad Werdmüller (1606-1674) ernannt, Zürichs erster Seckelmeister,
der schon seit seinem 29. Jahr Mitglied der Regierung war und
es bis zu seinem Tode blieb. Zwei Dinge schienen ihn militärisch zu
diesem Posten prädestiniert zu haben. Erstens war er, der während
des dreissigjährigen Kriegs in französischen und holländischen Diensten
gestanden hatte, der «Schöpfer der zürcherischen Kavallerie» und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 492 - arpa Themen Projekte
das Niveau der Zeit gebracht. Zweitens —und das war noch der bedeutend
wichtigere Grund — war er es gewesen, der im Jahr 1646, mit
dem «Generallieutenant» Johann Jakob Leu zusammen, als Oberkommandanten
der militärischen Exekutive, den Aufstand der Wädenswiler
und Knonauer Bauern so blutig niedergeschlagen hatte! Das hatte
ihn 1648 zum Seckelmeister, und damit zum zweitmächtigsten Mann
neben dem Bürgermeister, gemacht. Aber mehr als das: das umgab ihn
in den Augen der gesamten schweizerischen Herrenklasse mit dem
Nimbus des vor nichts zurückschreckenden Retters ihrer Klassenherrschaft,
des erfahrenen und erfolgreichen militärischen Führers der
Konterrevolution.
Zum Generalstabschef — bezw. «Generalmajor» — im Feldzug gegen
die Bauern aber wurde Johann Rudolf Werdmüller (1614-1677)
ernannt, ein um acht Jahre jüngerer Halbneffe Konrada aus der «Linie
David» der Familie. Dieser war —wie auch der Berner General von
Erlach —ein fast genauer Altersgenosse der beiden grossen Bauernführer
Emmenegger und Leuenberger. Aber ein krasserer Gegensatz
zwischen Eidgenossen jener Zeit liesse sich schlechtwegs nicht erfinden,
als wie er zwischen diesen beiden Bauernführern einerseits und
jenen beiden Junkern «Bauerntötern» andererseits besteht. Hasserfüllter
als durch die führende Beteiligung dieser beiden Junker am Bauernkrieg
hätte sich darum die blutige Abrechnung zwischen den zwei Polen
der damaligen Generation gar nicht abwickeln können. Denn in
den beiden Junkern treten krass und nackt die Triebe zutage, die die
ganze damalige Herrenklasse beseelten, die aber für gewöhnlich in den
Mantel der Bürgertugend und religiöser Heuchelei gesteckt wurden:
hemmungslose Raffgier und masslose Herrschsucht; bedenkenloser Verrat
um des Vorteils willen und brutale Rachsucht bis zum Sadismus...
Johann Rudolf Werdmüller war von jugendauf ein ständiger Ausbrecher
aus dem heimischen Pfahlbürgerdienst in den Dienst der Fürsten,
gleich welcher Partei, wenn sie ihm nur Geld, Glanz und Ruhm
versprachen. Ihn verzehrte sein Leben lang der brennende Ehrgeiz, ein
grosser Feldherr zu werden —aber es kam nur ein Leben zustande, als
hätte er sich vorgenommen, der Geschichte eine hoffnungslos verspätete
Karikatur Karls des Kühnen zu liefern. Schon mit 17 oder 18
Jahren brannte er durch, um in Südfrankreich den Aufstand der verzweifelten
Bauern des Languedoc im Blut ersticken zu helfen. Neunzehnjährig
bricht er als Freiwilliger im Dienst des schwedischen Feldmarschalls
Horn bei der Belagerung von Konstanz bedenkenlos die
schweizerische Neutralität. Als Dreissigjähriger, und schon Generaladjudant
der schwedischen Artillerie, durchstreift er mit Torstenson
erobernd, raubend, plündernd Dänemark, Holstein, Deutschland und
Böhmen, zahlreiche Städte in Asche legend...
Von solchem Kaliber also war der Mann, der für die militärische
Durchführung der Befehle in der Herrenarmee gegen die Bauern in
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 493 - arpa Themen Projekte
musste es eine lächerliche Kleinigkeit bedeuten, seiner Soldateska ein
paar Aargauer und Solothurner Dörfer zur Plünderung und Brandschatzung
auszuliefern. Aber wir wollen doch hier noch ein Moment
aus seiner Vergangenheit anführen, das ihn ganz besonders dazu qualifizierte,
gerade an der Spitze des gewordenen Teils der Herrenarmee,
der sich aus dem söldnerischen Lumpenproletariat der Schweiz rekrutierte,
solche Heldentaten zu verrichten. Johann Rudolf Werdmüller
nämlich stand noch kurz vor dem Bauernkrieg, in den Jahren 1648 bis
1651, an der Spitze eines wirklichen schweizerischen Landstreicher-Regiments,
das sich aus derselben lumpenproletarischen Schicht zusammensetzte,
in venezianischen Diensten in Dalmatien und soll sich
dort im Kampf gegen die Türken militärisch hervorragend bewährt
haben. Wie dieses Regiment zustandekam, ist so ausserordentlich aufschlussreich
für die ganze Politik und Moral der damaligen Herrenklasse
der Schweiz, und insbesondere für die Art der Behandlung, die
sie der Bauernklasse dann in deren Niederlage zuteil werden liess, dass
wir auch dies hier noch kurz erzählen wollen.
Während und unmittelbar nach dem dreissigjährigen Krieg hatte
das Massenelend auch in der als «Friedensinsel» gepriesenen Schweiz
derart überhand genommen, dass ihre Landstrassen wimmelten von
heim-, boden- und besitzlos gewordenen «Landstreichern» und «Missetätern»
— Missetäter aus Hunger natürlich. Sie wurden während langer
Zeit massenweise eingefangen und hingerichtet. (Wie Vulliemin
berichtet, wurden beispielsweise allein in dem Städtchen Bremgarten
im Lauf eines einzigen Jahres, 1639, sage und schreibe 236 solche
«Missetäter» hingerichtet — was also dort ein beinah tägliches Schauspiel
war!) Das war die eine Methode der «Lösung» dieser sozialen
Frage, zu der die damaligen «christlichen» Herren fähig waren. Der
Fehler dieser Methode war nur, dass sie zu kostspielig war: sie kostete
einen immensen Henkerlohn! Da erfanden die klugen protestantischen
Herren von Bern und Zürich eine andere Methode: die eingefangenen
Landstreicher mussten an die Werber abgeliefert werden, und aus ihnen
errichteten die beiden Stände gemeinsam ein stehendes Regiment im
Ausland, das nach derselben Methode laufend aufgefüllt wurde. Dieses
Regiment «bewilligten» sie gnädigst der Serenissima Venedig und machten
damit nun — statt Henkerlöhne zahlen zu müssen — ein fettes Geschäft,
das sich in neuen, laufenden Jahrespensionen der venezianischen
Regierung an die Berner und Zürcher Herren auswirkte.
An die Spitze dieses Regiments also stellten diese letzteren anno
1648 den Johann Rudolf Werdmüller —und zwar, um den unbequemen
Herrn wieder einmal loszuwerden. Denn er war dem Zürcher Rat immer
wieder durchgebrannt und von diesem stets vergeblich gemassregelt
worden. 1651 von seinem Kommando über das Landstreicher-Regiment,
d. h. aus dem ständigen Krieg gegen die Türken auf dem
Balkan, beutebeladen heimgekehrt, tat er Dienst zuhause, wurde jedoch
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 494 - arpa Themen Projekte
worauf er beleidigt den Dienst quittierte. Das gab dann das
richtige Sprungbrett dafür ab, seinen Zorn über die Mitherren auf die
Bauern loszulassen...
Wohl als Lohn für seine «Verdienste» im Bauernkrieg, erhielt
dann später dieser militärische Abenteurer 1655 sogar einen Sitz in der
Zürcher Regierung. Dadurch wurde er für Ludwig XIV. so wertvoll,
dass dieser ihn zum Generallieutenant und Ritter des Michaelordens
ernannte und damit zum Haupt der königlich-französischen Partei im
Zürcher Rat, d. h. zum Empfänger und Verteiler der französischen
Dublonen, machte. In dieser Zeit baute dieser Werdmüller den fürstlichen
Herrensitz auf der Halbinsel Au im Zürichsee. Sein jämmerliches
militärisches Versagen im Villmerger Krieg 1656 «infolge der Zuchtlosigkeit
seiner ungeübten Milizen» — d. h. seiner abermals gewordenen
Landstreicher-Söldner —gab seiner Pracht den ersten Stoss. Dazu
aber kam, dass er seine Mitherren mit zynischen, ja offen atheistischen
Redensarten bis aufs Blut zu ärgern liebte und an diesen zu Hause
verspiessten Sesselklebern auf solche Weise gern für so viele von ihnen
erfahrene Demütigung Rache nahm. Er huldigte, wie sein Biograph
das ausdrückt, «freien philosophischen Anschauungen und war seinen
Zeitgenossen, die ihn als mit dem Bösen im Bunde stehend (!) betrachteten,
ein Rätsel». Dies nahmen seine Rivalen von der kaiserlich-spanischen
Partei im Zürcher Rat zum Vorwand, um ihm den Prozess zu
machen: er wurde «in seiner Ratswürde eingestellt und 1659 zu Busse
und Widerruf seiner heterodoxen Ansichten verurteilt»!
Wütend kehrte er der Heimat für immer den Rücken, trat ganz
in französische Dienste und focht an der Seite des berühmten Feldherrn
Turenne in Flandern, «verfeindete sich aber durch herrisches
Benehmen mit diesem Feldherrn». Als zuhause gestürzte Grösse hatte
Rudolf Werdmüller seinen Hauptwert für Frankreich, als Agent für
dessen Soldinteressen in der Schweiz, verloren — er wurde darin durch
den ehrenwerten Bürgermeister Waser mehr als ersetzt —, und also
wurde er von Ludwig XIV. auf die Seite geschoben. Tief gekränkt
kehrte er auch Frankreich den Rücken, diente ab 1663 wieder Venedig,
machte sich durch tapfere Verteidigung der Festung Candia auf Kreta
einen gewissen Ruhm, überwarf sich aber auch hier mit seinem Vorgesetzten.
Seinem masslosen Ehrgeiz war eben jeder Vorgesetzte im
Wege. So kehrte er 1670 auch Venedig den Rücken. «Um sich an
Frankreich, namentlich seinem Feinde Turenne, zu rächen, suchte
Werdmüller nunmehr eine Anstellung in kaiserlichem Dienste. Er trat
deshalb insgeheim zum Katholizismus über» — woran ihn also sein
«Atheismus» durchaus nicht hinderte. Inzwischen zum österreichischen
Feldmarschallieutenant ernannt, kämpfte er noch auf verschiedenen
Schlachtfeldern — u. a. auch «unter den Augen des ihm sehr gewogenen
Grossen Kurfürsten» —, und in der Kanonade bei Sasbach im
Jahr 1675, «bei welcher W. das Geschütz befehligte, ward ihm die Genugtuung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 495 - arpa Themen Projekte
militärisch hochstellte, durch eine Kanonenkugel getötet wurde. . wurde...'
Der alte Kampfhahn wurde 1676 vom Reichsmarschall Markgrafen
Friedrich von Baden-Durlach noch zum Gouverneur der Festung Philippsburg
hei Mannheim gemacht, die er belagert und erobert hatte,
nahm im Jahr darauf Saarbrücken ein, um noch im selben Jahr als
Befehlshaber des Schwarzwalds zu sterben...
In solch sinn- und zwecklosen Ehrgeiz-, Hass- und Rache-Komplexen
vergeudete ein nicht unbeträchtlicher Teil des schweizerischen
Herrentums, ja, in einem gewissen Sinn die «Blüte» dieses Herrentums,
all seine Kräfte im Dienste fremder Fürsten. Was aber noch viel
schlimmer ist: um eine einzige solche «Karriere» zu ermöglichen, mussten
Tausende, ja Zehntausende gutschweizerischer Bauern, nur weil sie
sonst dank der Misswirtschaft der Herren zuhause im Hungerelend
umgekommen wären, als Söldner ans Messer geliefert zu werden, um
fremden Fürsten die Schlachtfelder mit ihrem Blut zu düngen und damit
den eigenen Herren den Sockel zu füllen. Und jetzt, wo die Zehntausende
sich einmal in dumpfer Verzweiflung erhoben hatten, um
diese Plage, samt dem Elend, dem sie entsprang, und samt den Herren,
ihren Nutzniessern, vom Halse zu schütteln —jetzt wurden solche, im
Dienste fremder Fürsten rudelweise gross gezüchtete Herrenoffiziere
wie die Werdmüller gegen sie losgelassen, die die modernste Militärwissenschaft
und Militärtechnik der Zeit beherrschten und vor allem
auch in der Niederwerfung von Volksaufständen in fremden Ländern
Meister waren!
Johann Konrad und Johann Rudolf waren nicht die einzigen
Werdmüller im Generalstab der Herrenarmee — es war da noch ein
Dritter, Johann Georg Werdmüller (1616—1678), der «Generalfeldmeister»
der zürcherischen Tagsatzungsarmee, ein um zwei Jahre jüngerer
Bruder des Rudolf, der vielleicht wissenschaftlich geschulteste von
allen, der Erbauer der Festung Zürich. Sein Ruf als solcher war auch
jenseits der Schweizer Grenze so fest begründet, dass ihn der Herrscher
der Pfalz später drei Jahre lang in Dienst nahm, um die Festung Heidelberg
nach demselben Muster auszubauen. Sonst aber war er der
Typus des sesshaften junkerlichen Pfahlbürgers der Zürcher Herrenklasse
und dafür auch bereits durch einen Sitz in der Regierung belohnt
worden. Und schliesslich war noch ein Vierter da, aus der «Linie
Thomas» der Werdmüller, mit dem Vornamen Thomas, der als Oberst
und Adjutant im Generalstab Dienst tat gegen die Bauern —und der
mit dem «grossen Eidgenossen» Bürgermeister Waser und dem Seckelmeister
und Generalissimus Konrad Werdmüller zusammen zehn Jahre
später an der Spitze der grossen Gesandtschaft der Schande stehen
wird, die 1663 nach Paris reist um dort das neue Soldbündnis, d. h.
die endgültige Unterwerfung der Herren-Eidgenossenschaft unter den
Willen Ludwigs XIV., in endlosen Gastereien zu feiern und reichen
Goldlohn dafür in Empfang zu nehmen...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 496 - arpa Themen Projekte
Die letzten Entlebucher "Tellen"
werden im Oktober 1653 von Regierungstruppen vom
Dach einer Alphütte abgeschossen "wie Vögel von
den Bäumen"
Volkstümliche Darstellung aus dem Schweiz. Bilderkalender des
Jahres 1840 von Martin Disteli.
Die Entlebucher verweigerten auch nach der Niederlage standhaft
jeden neuen Huldigungseid. Sie schützten und ernährten
monatelang ihre "Rädelsführer", die sie hätten ausliefern sollen,
darunter Käspi Unternährer, den "Tell", und Hinteruli, den
"Stauffacher". Diese hatten, zusammen mit Hans Krummenacher,
dem "stärksten Eidgenossen", Ende September in einer
"hohlen Gasse" zwischen Schüpfheim und Hasle , ,Tellenschüsse"
auf eine luzernische Ratsdelegation abgegeben, die gekommen
war, den Huldigungseid abzunehmen, wobei ein Ratsherr getötet,
Schultheiss Dulliker schwer verwundet wurde. Ein Knabe
verriet Käspis und Hinterulis Versteck in einer Alphütte; Regierungstruppen
umzingelten diese. Die beiden Tellen flohen aufs
Dach, "beide mit grossen Schlachtschwertern bewaffnet und
entschlossen, eher zu sterben als lebendig in die Hände der
Feinde zu kommen. Der eine warf unaufhörlich grosse Steine,
mit denen die Schindeldächer im Entlebuch belegt sind...,
während der andere mit seinem gewaltigen Schlachtschwerte
jene Soldaten, die das Dach zu besteigen und die Rebellen zu
ergreifen versuchten, hinabtrieb. Als sie, der wiederholten Aufforderungen
ungeachtet, sich nicht ergeben wollten (sie sollten
lebendig gefangen werden, um im Prozess Aussagen zu machen),
wurden sie von den Soldaten durch zahlreiche Flintenschüsse
vom Dache heruntergeschossen. Die Leichname der beiden
Rebellen, deren Tapferkeit in andern Verhältnissen den Ruhm
der alten Schweizerhelden erreicht hätte, wurden nach Luzern
geführt und dort zur Schau ausgestellt. Es ward ihnen, als ob
sie noch lebten, den Prozess gemacht... Kasper Unternährer,
der Tell, ward enthauptet, sein Kopf auf den Haberturm gesteckt
und sein Leib auf das Rad geflochten. Hinteruli, der Stauffacher,
ward ebenfalls enthauptet, hierauf sein Leib gevierteilt und das
eine Stück samt dem Kopfe zu Schüpfheim, das andere zu
Willisau, das dritte zu Rothenburg und das vierte zu Russwil
an den Galgen gehängt." (Vock.) Das erst war das wirkliche
Ende des Bauernkriegs.
Nach einem Einzelblatt in der Landesbibliothek in Bern.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 496 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 497 - arpa Themen Projekte
Ein einziger im Generalstab der zürcherischen Tagsatzungsarmee
war kein Werdmüller; es war der einzige «Generalmajor» neben Joh.
Rudolf Werdmüller, namens Hans Ulrich Ulrich. Dazu kam ein ganzes
Rudel von Hauptleuten als Adjutanten, lauter Patrizier, die fast alle
ihre Sporen in fremden Kriegsdiensten im 30 jährigen Krieg verdient
hatten, aus den Geschlechtern: Grebel, Holzhalb, Zehnder, Bürki, Lavater,
Breitinger, Edlibach, Waser, Hirzel, Hofmeister, Burkhardt,
Meyer von Knonau etc. Sowie endlich die Obersten und Hauptleute von
Schaffhausen, Glarus, St. Gallen etc.
Diese «wohlgerüstete» Armee bot nach Peter «einen imposanten
Anblick» dar. Wie ein junger Zürcher Teilnehmer an seinen Vater
schrieb: «Alles so zierlich montiert und schön Volk, dass sich zum
höchsten zu verwundern.» «Eine zahlreiche Zuschauermenge hatte sich
zur Generalmusterung der marschbereiten Armee auf der Schlierener
Allmend eingefunden; auch Ausspäher der über den Auszug der eidgenössischen
Armee mit Sorgen erfüllten Bauern waren herbeigekommen,
um die Stärke des Gegners auszukundschaften. Diese einzufangen oder
zu vertreiben, wurden einige kleinere Truppenabteilungen ausgeschickt.»
Ein Freiämter Bauernführer, Georg Lüthi von Jonen, wurde
dabei gefangen; «er wurde der Armee gefesselt nachgeführt und später
in Mellingen vor ein Kriegsgericht gestellt».
Denn noch am Abend des 30. Mai setzte sich diese Armee quer
über den Heitersberg in Richtung auf Mellingen, in den unteren Freien
Aemtern, in Marsch. Es galt dort den Reuss-Uebergang zu sichern und
dann womöglich gleich auf das rebellische Lenzburg loszuziehen, wo
nur der bernische Schlosskommandant, der uns vom Aarauer Zug von
Ende März her bekannte rabiate Junker May von Rued, als Insel mitten
im Aufruhr noch standhielt. Die nächsten Ziele sollten die beiden,
von den Bauern ständig hart bedrängten Städte Brugg, in der rechten
Flanke, und Aarau, gradaus in der Marschrichtung, sein. Beide waren
wichtig als strategisch beherrschende Aare-Uebergänge, sei es, um
Flanke und Rücken gegen einen eventuellen Vorstoss der Basellandschäftler
Bauern zu sichern, sei es, um einen eigenen Vorstoss ins Baselbiet,
zur «Entschüttung» der Basler Herren, zu unternehmen. Das
weitere Ziel der Zürcher Herrenarmee war der Vormarsch über Olten,
Aarburg und Zofingen in den Oberaargau, wo sie sich mit der Berner
Herrenarmee unter Sigmund von Erlach zu vereinigen gedachte. Während
es der Luzerner Herrenarmee unter Sebastian Bilgerim Zwyer —
der von Tag zu Tag von seiner Reise zum Kaiser zurückerwartet wurde
— überlassen blieb, sich wenn möglich durch ihre eigenen Bauern
durchzuschlagen und sich über Sursee oder Willisau mit den beiden
anderen Armeen ebenfalls etwa bei Zofingen zu vereinigen.
Doch von diesem umfassenden strategischen Plan zur Niederringung
der Bauern, zu dessen Durchführung man mindestens einen,
möglicherweise jedoch zwei bis drei Monate zu bedürfen glaubte, war
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 498 - arpa Themen Projekte
die militärische Entscheidung des ganzen Krieges herbeizuführen. Was
vom Gesamtplan nachher noch ausgeführt wurde, war eine reine Polizeiaktion:
das Ausspannen des militärischen Netzes, in dessen Schutz
die Kriegsgerichte zum Rasen gegen die Bauern eingesetzt werden
konnten. Die gesamte kriegerische Aktion umfasst also nur wenige
Tage: die Woche von der Besetzung des Reuss-Städtchens Mellingen
durch die Armee Werdmüllers am 31. Mai, dem Pfingstsamstag der
Katholiken, bis zu der an sich unentschiedenen «Schlacht» bei Wohlenschwil
am Mittwoch, den 3. Juni, die jedoch durch die Kapitulation
der Bauern vom 4. beendet wurde, und bis zur Ausmordung und Niederbrennung
Herzogenbuchsees am 8. Juni, dem Pfingstsonntag der
Protestanten, der niederträchtigen Leichenfledderer-Tat Sigmund von
Erlachs, vier Tage nach. dem in Mellingen vollzogenen «eidgenössischen
Frieden». Diese acht Tage sind für jeden echten Eidgenossen Tage der
Scham und Schmach, wie sie kaum eine andere Epoche der Schweizergeschichte
aufzuweisen hat: nach allen Regeln der Kunst überlistet und
überfällt die im Dienst fremder Fürsten korrumpierte Herrenklasse
des Landes mit militärisch-technisch weit überlegenen Mitteln das
eigene Volk, um in diesem den letzten Rest der Manneswürde und des
Freiheitsstolzes auszurotten, denen die Eidgenossenschaft ihren Ursprung,
ihren Aufstieg und ihren Ruhm für alle Zeiten verdankt!...
Als die Armee am 30. nachts gegen 10 Uhr von der Schlierener
Allmend aufbrach, sah man, «von halber Höhe des Heitersberges eine
Reihe von Wachtfeuern» herunter leuchten. «Deshalb sandte General
Werdmüller zunächst den Generalmajor Rudolf Werdmüller mit einer
bedeutenden Rekognoszierungstruppe, die den Berg in einzelnen Abteilungen
erstieg, voraus.» Aber es waren verlassene Wachtfeuer. Dennoch
ging der Vormarsch nur mit grosser Vorsicht weiter. «Um ja
sicher zu gehen, machte man einen Umweg über den Adlisberg.» Da
man ausserdem das ganze schwere Geschütz über den Berg zu ferggen
hatte, dauerte es volle fünf Stunden, ehe das ganze Heer im Morgengrauen
des 31. Mai auf dem Heitersberg oberhalb Rohrdorf anlangte.
Dort löste man aus zwei Kartaunen eine Reihe von «Losschüssen», «um
den Kommandanten auf Schloss Lenzburg und Aarau und Brugg vom
Heranrücken der eidgenössischen Armee zu verständigen».
Zugleich aber «bestätigten diese Alarmschüsse den Lenzburger
Bauern die Schreckensnachricht vom ,Würklichen Aufbruch der Zürcher',
die bereits durch Eilboten im untern Aargau verbreitet worden
war». Darum begegnen uns schon auf der Höhe des Heitersberges am
31. Mai morgens um drei Uhr, von der allgemeinen Landespanik hergetrieben
die ersten Unglücksraben des kommenden Bauernverhängnisses:
noch bevor der Hahn auch nur einmal gekräht hatte, verrieten
dort oben drei Kapitulanten-Gesandtschaften die Sache der Bauern und
gingen vor dem Generalissimus der Herrenarmee in die Knie! Vock
erzählt: «Dort wartete bereits, zum Empfang und zu Begrüssung des
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 499 - arpa Themen Projekte
mit brennenden Fackeln und Windlichtern: die eine von Schultheiss
und Rath der Stadt Mellingen, welcher sich und seine Mitbürger
zu Gnaden empfehlen, und über die Besetzung der Stadt durch die
freien Aemter sich mit dem Mangel an Verteidigungsmitteln und mit
der Besorgnis eines gewaltsamen Ueberfalls, wenn man die Tore nicht
gutwillig den Bauern geöffnet hätte, entschuldigen liess, — eine zweite
vom Amte Rohrdorf, aus dessen Auftrag die Abgeordneten dem Feldherrn
Werdmüller die Versicherung des treuen Gehorsams gegen die
Gnädigen Herren und Obern der VIII alten Orte darbrachten, sich zu
allen guten Diensten erboten, und um Verschonung ihrer Wohnungen
und Güter baten, —und endlich die dritte Gesandtschaft von den Bauern
aus den freien Aemtern, welche Mellingen besetzt hielten und versichern
liessen, dass sie diesen Pass, dessen sonst die Berner Bauern
sich bemächtigt haben würden, bloss zu Handen der VIII alten Orte
bewachen, um ihnen Pass und Repass offen zu behalten, und dass sie
zu Vollziehung der ihnen zukommenden Befehle bereit seien. General
Werdmüller gab allen diesen drei Gesandtschaften freundliche Antwort,
und verhiess den Gehorsamen Schutz und Sicherheit.»
Die Ueberwältigung des Städtchens Mellin gen war also für die
Werdmüller-Armee eine Kleinigkeit. Nicht nur das Verhalten der Kapitulanten-
Gesandtschaft, auch dasjenige der Bauernbesatzung des
Städtchens war für die Herrenarmee äusserst ermutigend: auf die
blosse Kunde vom Anmarsch derselben verliessen — wie Peter berichtet
— «400 Freiämter Bauern das Städtchen, um sich mit den Berner Bauern
zu vereinigen, die in den Wäldern hinter Wohlenschwil zusammenströmten.
Ihrer 200 lagen noch in Mellingen, als der Vortrab des
zürcherischen Heeres, dreissig Dragoner unter Major Bürkli, am östlichen
Tore erschien und Einlass begehrte.» Die naive Ratlosigkeit
dieser Freiämter «Verteidiger» geht aus nichts deutlicher hervor, als
daraus, dass sie ausgerechnet ihren Landschreiber, den uns als serviler
Herrendiener längst bestbekannten Zuger Ratsherrn Beat Jakob Zurlauben,
aufragten, «ob sie Mellingen aufgeben sollten». Dieser gab
ihnen die ironische Antwort: «der sie habe heissen hineinziehen, soll
sie daraus wieder befehlen». In derselben zwiespältigen Ratlosigkeit
liessen die Bauern die weit schwächere Mannschaft Bürklis über die
Reussbrücke und durch das östliche Tor in die Stadt, verhinderten
sie jedoch «unter Todesdrohungen», vom westlichen Tor, dem Lenzburger
Tor, Besitz zu ergreifen. Sie überliessen also den äusserst wichtigen
Reussübergang, Brücke und Tor im Osten, kampflos dem Feind
—trotz ihrer vielfachen Uebermacht an Ort und Stelle und trotz den
«bereits herwärts von Wohlenschwil heranrückenden Bauernrotten».
In diese unerwartet leicht geschlagene Bresche rückte unverzüglich
der Haudegen Generalmajor Rudolf Werdmüller mit der «gesamten
Kavallerie» nach und machte den Grossteil der Besatzung zu Gefangenen.
Bei der Verfolgung der fliehenden Bauern fielen die ersten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 500 - arpa Themen Projekte
Toten und zwei Verwundeten. Darauf beschloss der Generalstab der
Herrenarmee, die günstige Lage sofort auszunutzen und «gstracks den
Marsch uff Lentzburg zu nemmen».
Doch da meldeten Kavalleriepatrouillen, «der Wald hinter Wohlenschwil,
Oderberg und Büblikon sei von feindlichen Scharen besetzt»,
die ganze Gegend von Othmarsingen sei ein einziges Bauernlager.
Das machte grossen Eindruck auf General Konrad Werdmüller,
und so liess er «das ganze Heer zwar ,in vollem Marsche' durch Mellingen
ziehen, daselbst eine Besatzung von vier Kompagnien zurücklassend,
dann aber auf dem jenseitigen Reussufer um die Mittagszeit
anhalten, um daselbst ein festes Lager aufzuschlagen und darin zunächst
weitere Verstärkungen abzuwarten». Das legte die Grundbedingungen
fest, unter denen die militärische Entscheidung fallen sollte.
Sie beruhten auf dem Besitz dieses, während mehreren Tagen unter
der Leitung des Obersten Georg Werdmüller, des Zürcher Festungsbaumeisters,
immer besser ausgebauten befestigten Feldlagers mit weit
überlegener Artillerie, das die Bauern zu stürmen suchen mussten,
ohne dieser Artillerie etwas auch nur entfernt Gleichwertiges entgegensetzen
zu können.
Bei der gegebenen Lage geschah es eigentlich erstaunlich rasch,
dass die Bauern aus den verschiedenen Richtungen und teils aus grossen
Entfernungen rings um Mellingen zusammenströmten; und dies
zwar in so starken Massen, dass bereits am 31. Mai ihre grosse Anzahl
den Generalissimus der Herrenarmee dazu zu bestimmen vermochte,
den Vormarsch einzustellen und ein festes Lager zu beziehen. Dies
war nicht etwa auf Grund eines neuen allgemeinen Berner Landsturms
geschehen. Ganz im Gegenteil: noch am Tag vor dem Aufbruch
der Zürcher Armee, am 29., als sich aber, nach Peter, «im untern
Aargau die Kunde vom Heranrücken der Zürcher und ihrer Hilfsvölker
» bereits panikartig ausbreitete, «langten daselbst Eilboten von
Bern her an, mit einem eigenhändig besiegelten Schreiben Leuenberger»,
welches folgenden strengen, auf der Illusion des Murifeld-«Friedens»
beruhenden Demobilisierungsbefehl enthielt:
«Unssere liebe gute Fründen und Nachbarn; Ir sollet wyssen, dass
unss der Friden, Gott sei gedankt, ist gemacht, zwischen unssern gnedigen
hohen weisen Oberen und unss Landtleüthen im Emmenthal und
unssern Mithafften. Dess (wegen) thun wir Euch kund in allem und
jedem Ort. ... wo dieses Schreiben ankommt durch das Niderland
und Aargau, dass ihr sollet die Pass öffnen und alles Volckh (Truppen)
abschaffen, umgehnds und unfehlbar, sonst würden ir ess von der
gnedigen Obrigkeit und unss übel entgelten und dass darauss folgende
Uebel an euch selbst haben müessen. Gegeben, den 19. Mai 1653 (a. St.),
Niklaus Leuenberger, Obmann, samt den gemeinen Kriegsräten.»
Es konnte gar nichts Verwirrenderes, für die Bauernsache Verhängnisvolleres
geben, als diese Leuenbergerschen Befehle, die er noch
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 501 - arpa Themen Projekte
Landesteile des Bauernlandes schickte. Wenn trotzdem eine Masse
Bauern, besonders natürlich Lenzburger und Oberaargauer, in hellem
Aufruhr auf Mellingen zu «rochleten», so geschah dies völlig spontan,
und das heisst unter diesen Umständen leider auch völlig führungslos.
Denn es geschah in ausdrücklicher Zuwiderhandlung gegen die strikten
Befehle des Obmanns Leuenberger. Die so zwiespältige und schwankende
Haltung aber, die die Bauern gegenüber der Zürcher Herrenarmee
von allem Anfang an einnahmen, hing, selbst nach Peter,
«hauptsächlich mit den Befehlen zusammen, die von Leuenberger ausgegangen
waren». Und deren Wirkung beschränkte sich natürlich
nicht nur auf den Beginn, sondern machte sich geltend bis mitten in
die militärische Entscheidung hinein. Denn «durch das Verhalten Leuenbergers
wurden diejenigen Heerhaufen der Bauern, die den Zürchern
bis in die Gegend von Othmarsingen entgegenzogen und dort...
ein Lager aufschlugen, zur Defensive verurteilt». Da dieser ungewisse,
oberbefehlslose Zustand im Bauernlager von Othmarsingen mehrere
Tage lang anhielt, konnte sich in diesem Lager überhaupt kein militärischer
Wille bilden. Das aber musste, angesichts des von Tag zu Tag
stärker ausgebauten Herrenlagers vor Mellingen, das Selbstvertrauen
auch der mutigen Bauern auf eine harte Probe stellen. Dies umsomehr,
als die Verpflegung des Bauernlagers von Othmarsingen kaum
besser organisiert gewesen sein wird als sein militärisches Zustandekommen.
Nun eilten zwar noch am 31. Mai drei Langenthaler Boten —
Baschi Herzig, sowie Jakob und Jori Mumenthaler — ins Emmental
hinauf, um Leuenberger und den Emmentalern die Kunde von dem
Einfall der Zürcher Armee in die Freien Aemter und den Unteraargau
zu bringen. Aber noch jetzt vergeudete Leuenberger die kostbare Zeit
mit der treuherzigen — besser gesagt: einfältigen und sektiererisch
verstockten —Illusion, den Murifeld-Frieden mit moralisch-religiösen
Appellen und Protesten bei den Berner Herren retten zu können.
Noch am 1. Juni las er dem Berner Rat in einem Schreiben aus Ranflüh
in sittlicher Entrüstung die Leviten darüber, dass «die Berner
Bauern stets noch Rebellen und Ketzer gescholten» würden, sowie darüber,
«dass Ir nit begehrind Friden halten und Eure Völckher ab- und
fortzuschaffen, noch unssere Gfangenen lossgeben, sonder villmehr in
Raub zu gahn, und wollen hiemit gegen Euch für das jüngst Gricht
protestiert haben, dann wir erklären unss, dass wir den gemachten
Friden begehren zu halten».
Trotzdem es also Leuenberger klar bewusst war, dass die Berner
Herren den Frieden nicht einhalten, die Truppen und Rüstungen nicht
«abschaffen», die nach Friedensschluss meineidig im ganzen Land
herum eingezogenen Gefangenen nicht freigeben, vielmehr «in Raub
gahn» wollten, —trotzdem er also selber feststellte, dass die Berner
Herren den Murifeld-Frieden bereits gebrochen hatten, —trotzdem er
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 502 - arpa Themen Projekte
der Tagsatzung, Friede hin Friede her, mit grosser Heeresmacht die
Bauern überzogen, —trotz alledem hielt Leuenberger den selbstmörderischen
Wahn immer noch aufrecht, dass der Friede weiterbestehe,
für den er ja allerdings seine Seele geopfert, den Bund gebrochen hatte
und an seinen Klassengenossen meineidig geworden war!
Darum ja wohl, um seines «Seelenheiles» willen, musste er jetzt,
wie Vock berichtet, die Regierung um Gottes, Jesu Christi und des
jüngsten Gerichtes willen» förmlich anflehen, den von ihm so teuer
erkauften Frieden zu halten, den sie nach seinem besseren Wissen
bereits gebrochen hatte. Darum wohl flüchtete er sich in einem weiteren
Schreiben an seine Gnädigen Herren und Oberen in Bern noch am
2. Juni in die, angesichts der gegebenen Wirklichkeiten, schier unfassliche
«religiöse» Wahnwelt seines Sektierertums, als er dieses Schreiben
mit den Sätzen beschloss: »Wir wollen die allerheiligste Dreifaltigkeit
von Grund unseres Herzens anrufen, dass sie uns Gnade und Kraft
verleihen wolle, damit wir die Gerechtigkeit können handhaben,
schützen und schirmen, und die feindliche Gewalt, die sich wider uns
auflässt, abschaffen, und in die Tiefe des Meeres versenken, wie den
gottlosen König Pharao und seinen Anhang. Der Herr wolle uns, sein
Volk, das er mit seinem rosenfarbenen Blut erlöst, durch dieser Trübsal
rothes und wüthendes Meer führen nach seiner Gnade, damit wir
bei der Gerechtigkeit verbleiben können, dazu wir dann Ehre, Gut und
Blut setzen wollen.»
Dies wurde geschrieben am selben Tag, für den die Berner Regierung
eine Ratsdeputation nach Langnau und Signau abgeordnet
hatte, «um dort im Namen der Regierung das Volk neuerdings zur
Huldigung anzuhalten und den laut Friedensvertrag auszuliefernden
Bundesbrief in Empfang zu nehmen», wozu Leuenberger persönlich
aufgeboten war. Vor der Ausführung dieses auf dem Murifeld um des
lieben Friedens willen besiegelten Verrats am Huttwiler Bund und Eid
jedoch schreckte Leuenberger jetzt zurück —aber jetzt erst, angesichts
des offenen Friedensbruchs der Herren und weil diese in einem Schreiben
vom 1. Juni in der unverfrorensten Weise ihm selbst die Schuld
in die Schuhe schieben wollten; unter dem Vorwand nämlich, dass
Berner Bauern Lenzburg, Zofingen und Aarau belagert hätten und den
Luzernern zugezogen seien, welches beides schon viele Tage vor dem
Friedensschluss in Gang gekommen und, sofern auch nachher noch
fortgesetzt, durchaus gegen den Willen Leuenbergers ins Werk gesetzt
worden war. Darum liess Leuenberger nun, gleichzeitig mit dem eben
angeführten Schreiben vom 2. Juni, dem Berner Rat in einem zweiten
Schreiben namens der Bauern erklären, «dass sie von der Belagerung
der Aargauischen Städte und vom Kriegszüge der Berner Landleute
nach Luzern keine Kenntnis haben (d. h. dass dies beides ohne ihre
Kenntnis ins Werk gesetzt worden sei) und also auch nicht dafür verantwortlich
sein können», vor allem aber, «dass es ihnen hart falle, den
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 503 - arpa Themen Projekte
demselben abzuschwören, und dass sie, bevor die fremden Hilfstruppen
aus dem Lande wegziehen, keine Huldigung leisten werden». Das
hätte sich Leuenberger wahrlich früher überlegen müssen!
Deutlich tritt in diesem Schreiben das Wiedererstarken des revolutionären
Flügels der Berner Bauern in Erscheinung. In ihm atmet
Uli Gallis Geist. Diesmal aber rüttelte der Berner Bauernzorn den Leuenberger
gründlich aus seinen sektiererischen Angstträumen empor und
riss ihn abermals —und diesmal endgültig, wenn auch abermals zu
spät — an die Spitze der Volksbewegung! Denn — wie Vock berichtet
— «die Nachricht von der Ankunft des eidgenössischen Heeres bei
Mellingen machte die Emmentaler nicht mutlos, sondern wütend. ,Und
wären' sagten sie, ,die Zürcher 30000 Mann stark, werden wir ihnen
dennoch an Zahl und Macht weit überlegen sein'...» Peter fügt hinzu:
«Da gleichzeitig Hilfsgesuch auf Hilfsgesuch von den Bauern im untern
Aargau ankam, so liess er (Leuenberger) am gleichen Tage (am
2. Juni) von Ranflüh den Landsturm ergehen.» Immer noch hatte er
dabei, nach Peter, nur «die Absicht, ,das fremde Volk' zurückzuwerfen,
um dann den Rat von Bern zu zwingen, den Murifelder Frieden
zu halten» —also nicht etwa den Bauernbund und seine Bundesziele
durchzusetzen, vielmehr: dann doch zu huldigen und doch den Huttwiler
Bundesbrief abzuschwören und auszuliefern!...
Immerhin, der Landsturm war endlich ergangen. «Ueberall wurden
die Bauern nach Mellingen aufgemahnt, die für den Feldzug in
Bereitschaft liegenden Gelder ausgeteilt, Brot und andere Lebensmittel
von Haus zu Haus gesammelt und den Bauern im Lager bei Othmarsingen
zugeführt.» Leuenberger selber ritt noch am selben Tag, am
2. Juni, mit seinen Kriegsräten über Langenthal, wo er die eben Markt
haltenden Bauern persönlich gegen Mellingen aufgeboten haben soll,
«an der Spitze von 700 Mann», wie Vock erzählt, «nach der Stadt Zofingen,
welche seit 8 Tagen von den umliegenden Bauern belagert
wurde, nun aber, der Uebermacht weichend, dem Leuenberger die Tore
öffnete. Stolz ritt der Obmann» — so erzählt Vock nach der Zofinger
Chronik weiter — «durch die vom obern bis zum untern Tore aufgestellten
Spaliere der in Waffen stehenden Bürgerschaft, stieg nicht
vom Pferde, sondern liess sich schnell von einem Pintenschenkwirt
ein Glas Wein geben, sprach einige freundliche Worte mit dem ihm
durch den Viehhandel wohlbekannten Metzger und Ratsherrn Heinrich
Hugi und eilte mit seinem Heerhaufen weiter, nach Aarau.» Auch
Aarau war bereits seit dem 24. Mai von den Bauern belagert, denen
sich seit dem 25. auch die bewaffneten Bürger des besonders eifrig
rebellischen Städtchens Aarburg, unter ihrem Hauptmann Ulrich Bohnenblust,
angeschlossen hatten. Leuenberger, am 2. Juni abends vor
Aarau angelangt, hielt sich auch hier nicht lange auf, sondern «zog die
sämtliche Mannschaft, welche die Stadt belagerte, an sich und führte
sie zum grossen Heere bei Othmarsingen, wo er tief in der Nacht, fast
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 504 - arpa Themen Projekte
bewaffnete Bauern versammelt waren.» So erzählt Vock.
Nach Peter war Leuenbergers Heerhaufen, mit dem er «spät in der
Nacht des 2./3. Juni» im Lager von Othmarsingen eintraf, im Lauf
dieses einen Tags von 700 auf 7000 Mann angeschwollen. Und dies
zwar hauptsächlich deshalb, weil unterwegs nicht nur die Belagerer
Zofingens und Aaraus, sondern, wie Peter behauptet, auch Verstärkungen
aus den Kantonen Solothurn und Basel zu Leuenberger gestossen
sein sollen. Nun ist zwar aus keiner Quelle zu erweisen, dass die
Hülfstruppen aus diesen Kantonen gerade zu Leuenbergers Heerhaufen
gestossen seien, als dieser noch unterwegs war. Wohl aber stimmen
alle Quellen darin überein, dass diese Truppen sämtlich ungefähr
gleichzeitig, d. h. «spät in der Nacht» vom 2. auf den 3. Juni, im Lager
von Othmarsingen eintrafen, ebenso wie es feststeht, dass auch die
Luzerner Hülfstruppen unter Schybi in derselben Nacht, wahrscheinlich
kurz vor Leuenberger, dort ankamen. Die Berichte darüber, wie
diese verschiedenen Zuzüge der Bundesgenossen von zuhause aufbrachen,
um hier ihrem Bundesschwur treu nachzuleben, fasst immer
noch, wie so oft, der alte Vock am besten zusammen. Sie mögen hier
in kurzem Auszug folgen und dabei nach Bedarf aus andern Quellen
ergänzt werden.
Der stärkste Zuzug, der am frühsten aufgebrochene und wohl auch
am frühsten eingetroffene war der der Luzerner unter Christen Schybi.
«Als nämlich in der Nacht vom 31. Mai die Nachricht vom Einmarsche
des eidgenössischen Heers in Mellingen und zugleich ein dringendes Ansuchen
der Berner Bauern um Hilfe den Bauern vor der Stadt Luzern
zukam, brach Schybi sogleich am 1. Juni abends mit 2000 Mann auf und
eilte nach Mellingen. Ihm folgten die vor Luzern gelegenen 400 Solothurner
unter dem Befehl des zum Oberstlieutenant erhobenen Hans Urs
Lack und, von Friedrich Hans Rast geführt, eine bedeutende Anzahl
Rothenburger. Diese Verminderung ihrer Macht vor Luzern suchten
die Bauern durch neue Truppenaushebungen wieder zu ergänzen.»
Dabei kam ihnen, wie wir uns erinnern wollen, der Umstand zu statten,
dass wegen den Verhandlungen in Stans immer noch ein Waffenstillstand
in Kraft stand, der allerdings ausgerechnet mit dem 3. Juni,
an dem bei Mellingen die militärische Entscheidung fiel, ablief. Kurz,
der Eilmarsch Schybis und seiner Truppen quer durchs Luzernbiet
in den Aargau wühlte das ganze Land auf. Liebenau berichtet dazu
noch: «Am 1. Juni begannen die Truppen der Bauern aus dem Gebiete
von Luzern ihren Marsch gegen Mellingen anzutreten. Am 2. Juni riefen
Sturmglocken auf dem Lande das Volk zu Hilfe. Die Leute von
Dagmersellen marschierten gegen Wykon, nahmen den Schlossvogt
(auf 8 Tage) gefangen und schlugen ihn in Eisen.»
«Ein gleicher Landlärm über die Ankunft des eidgenössischen
Heers in Mellingen entstand im Kanton Basel.» So berichtet wieder
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 505 - arpa Themen Projekte
Rundschreiben in die nächstgelegenen Dörfer ergehen: ,Zu wissen,
dass ihr in Eil von Dorf zu Dorf in eurem Amte zu entbieten habet,
dass der erste Auszug alsbald fortziehe, auf Olten zu, und sich auf den
heutigen Tag einstelle, nach Laut des Bundes; denn es sind fremde
Völker mit achtzehn Stücken von Zürich und Schaffhausen angekommen.
Bitte, säumet euch nicht! denn es tut not...' Alsogleich brachen
100 Mann auf und zogen mit fliegender Fahne nach Olten, von wo sie
am 2. Juni nach Othmarsingen marschierten und abends dort anlangten.»
Als ihr Hauptmann stand —nach Heusler — an ihrer Spitze der
Amtspfleger Uli Schwitzer von Titterten; als Fähnrich Werli Bowe,
der Bruder Isaaks und Schlüsselwirt von Waldenburg, mit der Fahne
des Amtes Waldenburg; sowie jener Hans Bernhard Roth von Reigoldswil
mit dem grossen roten Bart, der beim ersten Landsturm gegen
Liestal den mächtigen Zweihänder schwang und der in Mellingen zu
einem der beiden Wortführer der Basler bei den Friedensverhandlungen
mit General Werdmüller wurde (mithin zum Kapitulanten).
Nun würde es uns zwar mit Recht wundern, wenn von den immer
besonders tatbereiten Landschäftler Rebellen nur ihrer hundert, selbst
als blosser «erster Auszug», bereit gewesen wären, sich für den grossen
Bauernbund zu schlagen. In der Tat schätzt Heusler die Zahl dieses
allerersten, stehenden Fusses fortgeeilten Auszugs auf «wohl über
200»; General Konrad Werdmüller selbst schätzte die im Bauernlager
erschienenen Basler auf 250. Aber auch diese Zahl kann unserer Erwartung
nicht entsprechen. Darum lesen wir mit Genugtuung bei Vock
weiter: «Mehrere tausend bewaffnete Basler Bauern hatten sich am
2. Juni, auf die erhaltene Mahnung, zu Liestal versammelt, und sie
wären vermutlich ebenfalls ausgezogen, wenn nicht die bald darauf
eingetroffene Nachricht von den Ereignissen bei Wohlenschwil am
3. Juni sie zur Besinnung gebracht hätte.» Diese «mehrere tausend»
Landschäftler Bauern sind also nach Vock nur nicht rechtzeitig zum
Abmarsch gelangt, um in die «Schlacht» selbst einzugreifen. Ein Rätsel
bleibt es trotzdem, warum diese «mehreren tausend» Bauern vom
2. Juni an die Nachricht von dem entscheidenden Treffen, die sie
frühestens am 4. früh erreichen konnte, ruhig in Liestal abgewartet
haben soll, statt schon am 2., ja noch am 3. Juni dorthin zu stürmen,
wo ihr Schicksal entschieden wurde.
An der Entschlossenheit der Basellandschäftler kann es kaum gefehlt
haben. Denn seit der zweiten Huttwiler Landsgemeinde hatten
sie manchen Beweis für ihre Entschlossenheit, ja auch für wachsende
politische Einsicht —schlechter Führung zum Trotz —, abgelegt. Zwar
war der Bürgermeister Wettstein mit seinen Herren XIII aufs äusserste
bemüht, «Versöhnung, d. h. Spaltung und Zersetzung, in die geschlossene
Phalanx des Baselbiets zu tragen. Eins übers anderemal sandte
er Ratsdeputierte zu den Bauern, ihnen zuzusprechen, «sich von anderen
(!) Lumpen nicht verfuhren zu lassen», sondern ihre «Ausschüsse»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 506 - arpa Themen Projekte
senden. Allwo Wettstein die Bauern ebenso leicht über den Löffel
halbieren zu können hoffte wie in den ersten Apriltagen. «Aber dieselben»,
berichtet Heusler, «begehrten nun in Liestal zu unterhandeln,
weil man das Geschäft nicht mehr einzelnen Ausschüssen übergeben
könne. Auch die Einladung nach Pratteln oder Augst» (wo sie nämlich
von herrenfreundlichem Gebiet eingeschlossen gewesen wären) «wurde
abgelehnt, ebenso die Mitwirkung der Gesandten von Zürich und
Schaffhausen, gegen welche das Volk wegen des badischen Mandats
erbittert sei und welche daher zu Vermeidung etwa erwachsenden Unheils
und Despects ersucht wurden, nicht in Person zu erscheinen»!
Die vier Herren «Ehrengesandten» — darunter übrigens der Bürgermeister
Ziegler von Schaffhausen, der noch vor wenigen Tagen den
so kriegstreiberischen Brief an Waser geschrieben hatte und darum
gewiss der richtige «Friedensstifter» (für die Herren!) war — haben
sich darüber dann im Wildenmann zu Basel durch den Extra-Verzehr
von «zwei indianischen Hahnen und zwei grossen Salmenpasteten» getröstet,
ein Verzehr, der gewiss nicht trocken geleistet wurde und für
sich allein 25 Pfund 10 Batzen kostete, ein Betrag. der zu der übrigen
Hotelrechnung im Wildenmann in der Höhe von 222 Pfund und etlichen
Batzen hinzukam.
So brachten es die Basellandschäftler Bauern durch einen Landsturm
auf Liestal am 21. Mai zustande, dem gewiss nicht willensschwachen
Bürgermeister Wettstein ihren Willen aufzuzwingen: dieser
musste am 22. Mai in eigener Person mit sechs Ratsherren nach Liestal
vor eine Bauernlandsgemeinde in der Kirche kommen. «Die Bauern
begehrten hier mit grossem Ungestüm Freigebung des Salzverkaufs.
Erlass der Stocklöse und der 2 Gulden bei Hochzeiten, und Verschonung
mit dem Umgeld; hier war es vor allem, wo sie in Gegenwart der
Landvögte letztere beschuldigten. weit mehr als die verrechneten Salzbussen
erhoben zu haben. Besonders zahlreich seien die Waldenburger
und Homburger erschienen, ,um den lieben Frieden zu übermehren'
auf dem Kirchhof, ,der doch eine Freiheit sein soll', auf Gassen und in
Häusern nahmen sie 22 ihnen missfällige Untervögte und Geschworene
gefangen... Nach langen Verhandlungen erklärten die Bauern ausdrücklich,
dass sie von dem Huttwiler Bunde keineswegs weichen
wollen»!
Uebrigens wäre hierbei Wettstein beinahe dem Leuenberger als
Wortführer begegnet! Denn Werli Bowe hatte ihnen, offenbar in Erkenntnis
ihrer eigenen mangelhaften Führung, «den Vorschlag gemacht,
den Leuenberger als Wortführer kommen zu lassen». Aber,
abgesehen davon, dass Leuenberger eben zur selben Zeit mit seiner
Armee vor Bern ziehen musste, hatte es Werli Bowe mit der verletzten
Eitelkeit Uli Schads zu tun, der fand, «dass es eine Schande für sie
wäre», Leuenberger kommen lassen zu müssen...
Aber auch der andere Wortführer der Basler Bauern, Isaak Bowe,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 507 - arpa Themen Projekte
des Basler Volkes weit über den Kopf gewachsen war. Am
26. Mai wurden die Ausschüsse der oberen Aemter zu einer Versammlung
nach Sissach einberufen, um den Bescheid des Basler Rats auf die
Forderungen der Liestaler Versammlung vom 22. entgegenzunehmen.
Auf dieser Sissacher Versammlung nun, die sich durch die spontane
Beteiligung des gesamten Volkes zu einer echt revolutionären Landsgemeinde
verwandelte — wie schon die Liestaler Versammlung —,
trat Isaak Bowe direkt als Saboteur der Volks forderungen auf, wobei
er sich, nicht ohne eine gewisse innere Logik, in offensichtlich umgekehrten
Sinne wie sein Bruder Werli, ebenfalls auf Leuenberger berief.
Doch hören wir, wie Heusler diese Versammlung und die Rolle
Isaak Bowes beschreibt, welch letzterer durch dieses Auftreten naturgemäss
den uneingeschränkten Beifall des konservativen Basler Herrenchronisten
erntet. «Aber mit den Ausschüssen», schreibt Heusler,
«erschien hier eine bewaffnete Volksmenge. und wildes zügelloses
Treiben gab sich kund. Auch hier sind es wieder die Waldenburger,
welche dessen beschuldigt werden. Ihnen trat Isaak Bowe entschlossen»
(als «entschlossener» Kapitulant!) «entgegen, er warf ihnen vor, sie
suchten der Obrigkeit ihre alte Gerechtigkeit des Salzkaufes, Umgelds
und anderer Sachen zu entziehen» (ja. wofür hatten sie denn überhaupt
Revolution gemacht?), «sie handelten darin wider Bund und
Eid» (der Huttwiler Bund war also ein Schutzbund für die Herrenprivilegien!)
«und Leuenberger selbst, wäre er anwesend, würde solches
sagen»! Nur mit dem Unterschied, fügen wir hinzu, dass Leuenberger
zwar wohl zu ebensolchem kapitulantenhaftem Verhalten fähig war,
stets aber zuletzt sich dem höheren Gesamtinteresse beugte und —
wenn auch immer zu spät — doch noch, unter Einsatz des eigenen
Kopfes, zur Durchführung ihrer Beschlüsse schritt.
Nichts davon bei Isaak Bowe. Dieser noch weit «kleinfügigere Unterthan»
war jetzt offensichtlich nicht nur dem Kleimut oder dem Irrtum,
sondern dem direkten Verrat in die Arme gelaufen. Das empfanden
die senkrechten Baselbieter Bauern schon auf dieser Versammlung.
und darum muss Heusler über deren Ausgang berichten: «Die Waldenburger
wurden dadurch aufs äusserste erbittert, drohten ihn zu zerhacken
wie einen Krautskopf, und Bowe sah sich genötigt, sich in aller
Stille zu entfernen»!
Das ist das klägliche Ende dieses «Bauernführers», der von da ab
völlig aus den Akten des eigentlichen Bauernkriegs verschwindet. Bezeichnenderweise
hören wir von ihm nur noch, dass er ganz am Ende,
am 8. Juni, einen um Gnade wimmernden Brief im Namen seiner Heimatgemeinde
Bretzwil, an den Rat zu Basel schreibt, «der väterlichen
Obrigkeit das Gleichnis vom verlorenen Sohn zu Gemüte führend».
Sofort darauf aber flüchtet er und schreibt am 10. Juni «unter einer
dicken Tannen» abermals, jetzt im eigenen Namen, «eine Zuschrift an
den Rat, in welcher er unter Berufung auf mehrere Bibelstellen um Verzeihung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 508 - arpa Themen Projekte
ausser Landes ziehen lasse, denn er wolle nicht mehr in Bretzwil leben».
Den Brief unterzeichnet er romantisch-sentimental: «Ik. Bowe von
Bretzwil, jetzt aber im finsteren Wald sich aufhaltend.» Dann geistert
er noch in vielen Nachkriegsmonaten als heimwehgeplagtes Flüchtlingsgespenst
«in schwarzen Spitzhosen und geschorenem Barte» in der
Fremde jenseits der Grenze umher —bis er sich im Februar 1654 den
Basler Herren freiwillig stellt und von ihnen «zu lebenslänglicher Ehr-
und Wehrlosigkeit mit Tragung des Lastersteckens und Eingrenzung
in den Bann von Bretzwil» begnadigt wird... Denn das war eine Begnadigung,
wenn man an das Wüten des Strangs und des Richtschwerts,
der Folter und der Erpressung der Herren gegen die andern
Bauernführer denkt.
Deshalb finden wir nicht Isaak Bowe —aber auch Uli Schad nicht
-— an der Spitze des Auszugs der Basellandschäftler Bauern, der am
1./2. Juni mit fliegender Fahne über Olten nach Othmarsingen eilte,
um wirklich «Bund und Eid» zu halten und zu schützen. Und der die
Fahne trug, war nicht Isaak, sondern Werli Bowe, sein tapferer Bruder,
der in die durch Isaaks Versagen gerissene Lücke sprang und damit
die Ehre des Namens Bowe rettete.
Dieses jämmerliche Versagen der Führung gerade in der letzten
Phase vor der Entscheidung macht es auch allein verständlich, warum
die grosse Masse der so besonders tapfer revolutionär empfindenden
Baselbieter Bauern nicht rechtzeitig bereit war, in die Entscheidungsschlacht
um das Los der schweizerischen Bauernsame einzugreifen.
Wenn irgend jemand, so hätten sie es sonst —richtig eingesetzt —vielleicht
wirklich fertig gebracht, das für einen kurzen Augenblick zwischen
beiden Parteien flatternde Blatt der Geschichte doch noch zugunsten
der Bauernklasse und des Schweizervolkes überhaupt zu wenden.
Den Beweis für ihre Entschlossenheit dazu lieferten sie noch nach
gefallener Entscheidung...
Merkwürdigerweise waren es nicht Berner, sondern Basler Boten,
die den Landsturm zum Aufgebot nach Mellingen unter die Solothurner
Bauern trugen. Das war eben bereits am 1. Juni, also noch vor dem Ergehen
des Leuenbergerschen Landsturms. Es liegt nahe, anzunehmen,
dass es jener vom Sonnenwirt zu Bukten aufgebotene «erste Auszug»
der Baselbieter war, der auf seinem Eilmarsch nach Olten, wo er noch
am 1. Juni anlangte, das Solothurner Land alarmierte. In diesen Zusammenhang
gehört ja wohl, was Vock davon berichtet: «Am 1. Juni
lief ein Basler Bauer, mit einer Hellebarde in der Hand, durch Egerkingen
und Oberbuchsiten und schrie, dass fremde Völker bei Mellingen
eingebrochen seien und es an vielen Orten brenne; man solle zu
Hilfe eilen. Das Gleiche geschah in der Vogtei Falkenstein. Fast in allen
Amteien des Kantons Solothurn wurden am 1. und 2. Juni die Auszüger
nach Mellingen durch das Los bezeichnet, und mehr als 2000 Mann,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 509 - arpa Themen Projekte
Artikel für die zweite Huttwiler Landsgemeinde verfasst hatte), «Urs
Hofstetter von Bolken» (der sie nach Huttwil getragen hatte), «Benedikt
Widmer von der Burg bei Aeschi, der Weibel Hans Jakob Rauber
von Egerkingen und Georg Baumgartner, der alte Wirt von Oensingen,
zogen am 2. Juni im Eilmärsche über Olten nach Othmarsingen,
wo sie spät in der Nacht eintrafen.»
Der so ausserordentlich prompte und so zahlreiche Auszug der
Solothurner Bauern zur Verteidigung des Huttwiler Bundes ist umso
erstaunlicher, als wir über sie seit der zweiten Huttwiler Landsgemeinde
sogut wie nichts anderes denn lauter Kapitulationen berichtet
bekommen. Gerade der gute alte Domdekan Alois Vock kann sich
nicht genug tun in dem Bestreben, das Verhältnis zwischen Regierung
und Volk im Solothurner Land während dieses Zeitraums in den rosigsten
Farben zu schildern.
Richtig ist, dass der Kapitulant Adam Zeltner — der, wie wir
sahen, nichts als ein von der Regierung gehätschelter Agent derselben
war —sofort nach der zweiten Huttwiler Landsgemeinde mit andern
Kapitulanten zusammen zum Solothurner Schultheissen Johann Ulrich
Sury gerannt war, um diesem erstens alle Huttwiler Beschlüsse
unverzüglich zu hinterbringen, zweitens eine grosse, das ganze Solothurner
Land umfassende «Pacifikations»-Aktion, d. h. eine Diversion
im Rücken des Volkes, dringend anzuraten. Eine solche Diversion
hatte aber die Kapitulantenpartei Adam Zeltners gerade deshalb umso
bitterer nötig, weil diese in Huttwil von einer viel zahlreicheren
revolutionären Abordnung der Solothurner Bauern bekämpft und
desavouiert worden war.
So kam vom 17. bis 19. Mai eine grosse Kapitulanten-Landsgemeinde
zu Oberbuchsiten zustande, «damit der völlige Abschluss gemacht
und der liebe Frieden im Vaterlande wieder gepflanzt werden
könne». Es war ein bewusster Sabotageversuch am ganzen Werk und
Plan des Huttwiler Bundes, woran darum fast die ganze Regierung,
unter Führung des Schultheissen Sury selber und des Gemeinmanns
Urs Gugger und des Staatsschreibers Franz Hafner, teilnahm. Nach
bekanntem Muster wurden dabei eine Reihe von schönen Versprechungen
als Köder für das Wohlverhalten ausgelegt «und von den
oberkeitlichen Deputierten befriedigende Entscheidungen, unter Vorbehalt
der höchsten Genehmigung (!), darüber erteilt». Von welcher
Güte diese ganze Veranstaltung war, enthüllt Vock naiverweise selbst,
indem er folgenden Bericht über den Abschluss derselben gibt: «Nachdem
auf solche Weise die ganze Verhandlung am 19. Mai beendigt
war, begehrten die Bauern noch Ersatz der im Verlaufe dieses Handels
gehabten Kosten.» Uebrigens: dieses Begehren lässt nicht auf eine sehr
unterwürfige Gesinnung selbst der hier anwesenden Bauern schliessen;
es schob vielmehr der Regierung die Verantwortung für den ganzen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 510 - arpa Themen Projekte
Begehren! Vock muss darum auch weiterfahren: «Die Deputierten der
Regierung fanden diese Forderung unzulässig und erklärten, dass sie
dieselbe nicht vor die Obrigkeit bringen dürfen.» Und jetzt kommt die
ganze niedrige Gesinnung des damaligen Herrenstandpunktes sowohl
wie aller seitherigen Herrengeschichtschreibung zum Vorschein, die
der Solothurner Regierung solche Mätzchen wie das folgende als Beweis
ihrer besonderen Volksfreundlichkeit anrechnet: «Um jedoch die
Bauern zufriedenzustellen, gab ihnen Schultheiss Sury 30 Solothurner
Pfund und Gemeinmann Gugger 2 Pistolen (28 Schweizerfranken) aus
eigenem Sacke, mit der freundlichen Einladung, dieses Geld in Frieden
zu vertrinken»! Mit einem Trinkgeld dem Volke seine Rechte abzukaufen
—das war das Rezept, schon damals!
Aber die Antwort des Volkes auf diesen faulen Kapitulanten-«Frieden»
von Oberbuchsiten war bereits der Auszug von 500 Solothurner
Bauern als Zuzug zu Leuenbergers Landsturm vom 21. Mai:
«Dessen — nämlich aller Ratsbotschaften — ungeachtet und ohne
Rücksicht auf die freundlichen Abmahnungen der Regierung wurden
in allen Dörfern die, welche den Berner Bauern zu Hilfe ziehen sollen,
durch das Los bezeichnet, und in kurzer Zeit waren 500 Solothurner
vor Arberg angekommen.» Und diese Antwort des wirklichen Solothurner
Volkes — nicht der von Vock und andern allein dafür gehaltenen
Kapitulanten Adam Zeltners — war nicht eine bloss momentane
für diesen vereinzelten Fall, sondern blieb während des ganzen Rests
des Bauernkriegs dieselbe.
So gleich zwei Tage später wieder, als beim Luzerner Landsturm
die Willisauer durch eine Zuschrift an die Oltener vom 23. Mai «die
Bauern des Kantons Solothurn um Zuzug ermahnt und sie zugleich
ersucht, Stuck und Munition mitzubringen. Obschon der Rat von Solothurn
die Untertanen durch die in alle Vogteien abgeordneten ausserordentlichen
Kommandanten dringend von diesem neuen Auszuge abmahnen
liess, versammelten sich dennoch in den Amteien Olten, Gösgen
und Bechburg die Gemeinden, bezeichneten durch das Los die
Auszüger, wählten die Offiziere und so trafen 400 Mann in Olten zusammen,
wo sie den Hans Urs Lack zu ihrem Obersten und den Kaspar
Klein von Olten zum Venner erwählten und dann mit fliegender Fahne
nach Luzern marschierten.» Es waren dieselben 400 Mann, die nun
mit Schybis Heerhaufen von Luzern zurückkehrten und am Abend des
2. Juni im Bauernlager von Othmarsingen einzogen.
Die prompteste und revolutionärste Antwort des Solothurner Volkes
an seine Regierung aber war der Auszug der «mehr als 2000 Mann»
(aus diesem kleinen Ländchen!) am 2. Juni, der auf dieselbe Weise,
aller Gegenwirkung der Regierung zum Trotz, ausgelost und dem
kämpfenden Huttwiler Bund insgesamt zu Hilfe geschickt wurde. Dabei
organisierten die tapferen Solothurner Bauern, von deren eigentlicher
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 511 - arpa Themen Projekte
gegen die Versuche der Regierung, in Abwesenheit der kriegstüchtigsten
Mannschaft der Bauern die allerdings jämmerlich schwache
Militärmacht der Regierung zu verstärken. Die Bauern errichteten
im Jura eine Sperre gegen den Zuzug von Truppen, die von der Regierung
in zwei regierungstreuen Vogteien jenseits des Jura ausgehoben
worden waren: «die von Mümliswil und Balsthal wollten 200
Mann aus den Vogteien Dorneck und Thierstein, welche die Regierung
zur Verstärkung der Besatzung in die Stadt einberief, nicht durchpassieren
lassen, sondern haben sie am 3. Juni zurückgewiesen.»
Die Summe all dieser revolutionären Aktionen des Solothurner
Volkes war immerhin so bedeutend, dass dieses die Funktion der Regierung
als Bundesgenosse der andern Herrenregierungen vollkommen
zu lähmen vermochte, sodass sie — wie übrigens auch die Basler Regierung
—ihre Pflicht als Mitglied der Tagsatzung in der Ausführung
der unter deren Autorität gefassten Beschlüsse nicht erfüllen konnte.
Das hat die Solothurner Regierung auf einer Kriegskonferenz vom
2. Juni ausdrücklich eingestehen müssen, die die Berner Regierung mit
Abgesandten der Solothurner und der Freiburger Regierung in Bern
veranstaltete. «Die Gesandten von Solothurn» — so berichtet immerhin
Vock darüber — «erklärten, dass ihre Regierung zwar nach Empfang
des Schreibens von Bern beschlossen habe, dem Stande Bern die verlangten
Hilfstruppen im Notfalle zuzuschicken, dass nun aber durch
die im eigenen Kanton seither entstandenen neuen Bewegungen und
durch den Auszug ihres Landvolks nach Mellin gen ihr unmöglich geworden
sei, jenen Beschluss zu vollziehen, indem sie genug im eigenen
Lande zu bewachen und zu sorgen habe.»
Ganz ähnlich, wenn auch nicht in solchem Ausmass, erging es
übrigens auch der Freiburger Regierung, in deren Herrschaftsbereich
es offiziell überhaupt keinen Bauernkrieg gegeben hat. Die Freiburger
Regierung hat sich zwar auf der Konferenz vom 2. Juni in Bern erboten,
«auf erstes Ansuchen die im Felde liegenden 1000 Mann in den
Kanton Bern einrücken zu lassen», musste dabei jedoch den Vorbehalt
machen: «insofern nicht im eigenen Lande die gleich im ersten Keime
glücklich besiegte Gärung neuerdings aufleben würde». Zu diesem Vorbehalt
war, wie wir von früher her wissen, Grund genug vorhanden.
«Es hatte nämlich», so erinnert Vock daran, «in der Stadt Greyerz eine
nicht unbedeutende Volksbewegung stattgefunden, die sich bereits auf
einige Dörfer zu verbreiten anfing, aber durch schnelles Einschreiten
der Obrigkeit glücklich, obschon nicht ohne Mühe und viel Sorgfalt,
wieder gehemmt und unterdrückt wurde. Dennoch» — so muss nun
Vock weiterberichten — «lebte der Geist des Aufruhrs im Stillen fort
und ergriff auch die im Felde stehenden Truppen», was sich schon ein
paar Tage später, am 5. Juni, zeigte, «als dieselben, von ihrem Lager
auf den Höhen der Sensebrücke nach Bern vorzurücken, befehligt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 512 - arpa Themen Projekte
|
Leuenberger-Denkmal in Rüderswil |
Errichtet von der "Oekonomischen und Gemeinnützigen Gesellschaft
des Kantons Bern' zur 250-Jahrgedenkfeier des Bauernkriegs
im Jahre 1903.
Inschrift
"Klaus Leuenberger. Obmann im Bauernkrieg. Geboren in Rüderswil.
Hingerichtet in Bern 1653.
Er starb für des Landes Freiheit und Wohlfahrt."
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 513 - arpa Themen Projekte

Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 514 - arpa Themen Projekte
bernischer Belange willen soeben preisgegeben hatte! Trotzdem und
nicht minder stillschweigend scheinen die Massen der Bauern den
Leuenberger in seiner Rolle als Oberfeldherr des Bundes — wie als
selbstverständlichen Ausfluss seiner Obmanns-Würde — akzeptiert zu
haben.
Leuenberger ist nicht viel länger als 24 Stunden der Oberbefehlshaber
der grössten Armee geblieben, die jemals in der Schweizergeschichte
für revolutionäre Ziele im Felde lag. Aber diese 24 Stunden
genügen, um die Tragik dieses Bauernführers ebenso wie die Tragödie
der ganzen von ihm geführten Sache erschütternd und erschöpfend zu
offenbaren. Dies wäre naturgemäss gar nicht möglich, wenn Leuenberger
nur der Kapitulant und «kleinfügige Untertan» gewesen wäre, der er
angesichts der ihm vermeintlich «von Gott gesetzten» Gnädigen Herren
und Oberen von Bern tatsächlich war. Vielmehr zeigte sich jetzt noch
einmal, und jetzt in der grossartigsten Weise, dass in diesem seltsamen
Widerspruch von einem Mann eben doch auch das Material zu einem
grossen Massenführer steckte, der nicht davor zurückschreckte, Alles
auf eine Karte zu setzen, sobald er die Notwendigkeit dazu einsah. Nur
geschah dies —und das ist die spezifisch Leuenberger'sche Tragik —
wieder einmal zu spät, hoffnungslos zu spät: als nämlich die Bedingungen
für den Erfolg durch sein vorhergegangenes Zögern bereits unwiederbringlich
verspielt waren —durch ein Zögern des Sektierers aus
frommen, an sich durchaus achtbaren Gewissensgründen, die jedoch
dem Führer den Blick für die Realitäten stets in verhängnisvollem
Masse trübten!
Die militärische Lage zwar war — wenn man Qualitatives gegen
Quantitatives allseitig abwägt — durchaus nicht derart zuungunsten
der Bauern, wie dies zumeist angenommen wird. Denn wenn auch die
Bewaffnung und die Führung der Herrenarmee diejenige der Bauernarmee
qualitativ bei weitem übertraf und letztere der ersteren insbesondere
in der Artillerie nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatte,
so war doch die Bauernarmee der Herrenarmee an Zahl gut doppelt,
wenn nicht gar dreifach überlegen. (Nach Peter rückten von der Herrenseite
am 31. Mai 7670 Mann, «ohne Kavallerie und Artillerie», ins
Feld; rechnet man die Kavallerie, 515 Mann, sowie für die Artillerie,
die 327 Pferde zählte, nur ungefähr ebensoviel Mann hinzu, so kommt
man auf etwa 8500, einschliesslich einiger Nachzügler-Kompagnien am
1. Juni auf «nahezu 9000 Mann». Die Mindestschätzung für die Bauerntruppen
beträgt 20000, nach Vock und anderen kommt man auf ca.
27000 Mann.)
Diese quantitative Ueberlegenheit der Bauern hatte ja den Generalissimus
Konrad Werdmüller bereits am ersten Tag des Feldzugs veranlasst,
den Vormarsch auf Lenzburg abzubrechen und ein befestigtes
Lager zu beziehen; «hat man angefangen, die Zelten aufschlagen, Hütten
bauen, hatte ein Ansehen, als wollte man ein ganzes Jahr alida verbleiben»,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 515 - arpa Themen Projekte
vom Regiment Ulrich in sein Tagebuch eintrug. Ja, dem Generalissimus
machte die quantitative Ueberlegenheit der Bauern einen derartigen Eindruck,
dass er bereits am 1. Juni «den Zürcher Rat durch einen Eilboten
um möglichst schnelle Absendung des ,Dritten Ausschusses'»,
d. h. des noch nicht eingezogenen dritten Aufgebots der zürcherisch-ostschweizerischen
Tagsatzungstruppen, ersuchte.
Die «gewaltsamen Rekognoszierungen», die der Generalissimus
hauptsächlich durch seine rechte Hand, den draufgängerischen Generalmajor
Rudolf Werdmüller, vom Samstag dem 31. Mai bis Montag dem
2. Juni machen liess, bestätigten ihm den ersten Eindruck der zahlenmässigen
Ueberlegenheit der Bauern immer aufs neue und in immer
wachsendem Masse. Noch am 2. Juni sandte der Generalissimus einen
sehr bedeutenden Teil seines Heeres —Peter sagt: «zweitausend Mann
zu Fuss, sämtliche übrige Kavallerie und einen Teil der Artillerie» —
unter Rudolf Werdmüller aus, «um, wenn möglich, den Weg nach
Lenzburg frei zu bekommen... Er erhielt alsbald Kunde, dass die
Bauern etwa eine halbe Stunde westlicher als am vorhergehenden Tage
Stellung genommen und in weit grösserer Zahl die ganze Ebene zwischen
Othmarsingen und Bruneck in starken Verschanzungen besetzt
hatten». Nach zeitgenössischen Offiziersberichten aus 'der Herrenarmee
stiess Rudolf Werdmüller allein an diesem Punkt des Bauernlagers —
und zwar noch vor dem Eintreffen Leuenbergers und anderer Zuzüge
— auf eine vielfache Uebermacht: der st. gallische Hauptmann Studer
berichtet von 7000, ein zürcherischer Offizier, der sich ständig im Stab
Rudolf Werdmüllers befand, spricht gar von 15000 Mann und fügt
hinzu: «sie hatten bei sich gute Offiziere und ihre Position war mit
Einsicht und Klugheit gewählt.» Auch ein anderer solcher, von Peter
zitierter Bericht im Zürcher Staatsarchiv spricht von «15000 wohlbewaffneten
Rebellen», auf die der Generalmajor mit seinen «zweitausend
Mann zu Ross und Fuss nebend acht Feldstucken... bei dem Schloss
Bruneck und dem Dorf Megenwil» gestossen sei und «die alle rote
wollhemmet anhatten»!
Rudolf Werdmüller musste also, nach Peter, «vom Lager her» sofort
weitere «1500 Mann auch artilleristische Verstärkung» anfordern.
Auf diese verstärkte Truppenmacht des Generalmajors wird es sich beziehen,
wenn der St. Galler Hauptmann Studer berichtet: «Alsso hat
man am Berg gegen Bruneggen Rendez-vous gehalten, in dreitausend
zu Fuess und fünfhundert Pferdt, die zwölf gewordenen Zürcher Kompanien»
(d. h. Rudolf Werdmüllers ureigene «Freiwilligen»-Truppe aus
Söldnerproletariat) «haben fast gantz marschieren müessen.» Bramarbasierend
erzählt denselben Vorgang der Regimentsschreiber Scheuchzer:
«den 23. Mai (2. Juni) ist Herr Werdmüller (Rudolf) mit allem
synem Volckh und Herr Oberst Ulrich mit zweitausend Mann zu Fuss
und allen Rütteren und vier Stücken uffgebrochen und zu Mittag den
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 516 - arpa Themen Projekte
Angriff wider die rebellischen Versammelnden zu thun...»
Obgleich nun bei diesem Ausfall Rudolf Werdmüllers gegen das
Bauernlager zur Oeffnung der Strasse nach Lenzburg ganz zu Beginn
einige Posten oder Kundschafter der Bauern niedergemacht worden
sind, so kann doch keinesfalls von einem «Angriff» der Herrentruppen
gegen die Rebellen gesprochen werden, wie Vock das, mit dem eben
zitierten Scheuchzer, tut. Vielmehr verhält sich die Sachlage etwa so,
wie sie aus dem Bericht eines andern Offiziers, des appenzellischen
Hauptmanns Johannes Wetter, an seinen Landammann Suter hervorgeht:
«Wir am Montag, 2. Juni, mit kommandiertem Volckh ungefähr
in sechstausend Mann» (das ist nun entschieden zu viel, auch wenn es
sich auf das bereits verstärkte Kontingent bezieht) «den Marsch von
Mellingen nach Lenzburg nemmen wollen. Auf halbem Weg bei einem
Dorf (bei Mägenwil?) habend sich viii tausend Puren wider uns zur
Wehr gestellt; nachdem wir aber unser Volckh in gute Ordnung gestellt,
auch unsere Stuck an zwei Orten gegen inen aufgeführt, hat
man den Pauren anbiethen lassen, durch einen Trommelschlacher,
wenn sie sich in einer Stund erklären und der Gnad begehren, soll
ihnen Gnad erteilt werden, sonst das Feuer aus grossen Stücken angedroht...»
Mit andern Worten: die Bauern waren zu stark, sodass Rudolf
Werdmüller auf seinen Plan, nach Lenzburg durchzubrechen, verzichten
und sich auf Verhandlungen verlegen musste.
Dass dem so war, bezeugt niemand anderes als Rudolf Werdmüller
selber, wenn auch indirekt. Einer seiner Lobredner nämlich, der entweder
den Feldzug in dessen Stab selbst mitgemacht oder aber vom
Generalmajor das Material zu dessen Rechtfertigung persönlich geliefert
bekommen hat, hat ein «Schreiben an einen guten Freund»
über den Verlauf des ganzen Feldzugs geschrieben, dessen «Extrakt»
in der Berner Stadtbibliothek liegt, den Hans Nabholz in seiner Schrift
über den Kampf bei Wohlenschwil publiziert hat. Darin heisst es:
«Wie nun der General Werdmüller (gemeint ist der Generalmajor Rudolf
Werdmüller) ausgieng als gemeldt der Meinung, die Puren in gleicher
Zahl und an dem Orth, da er sie vorigen Tags angetroffen, zu finden,
fand er, dass die Partey allzu ungleich, die Bauern in ihrem Vorteil,
er aber in der Zug-Ordnung in engen Strassen und zwüschet den
Büschen begrieffen, solcher gestalt, dass, so die Puren ihne angegriffen,
schwerlich Widerstand zu tun gewesen wäre; als er nun die Pauern in
das Gesicht bekäme und ihre Postur sahe, nahm er etliche Officiers
beyseits und sagte dise Worte: ,Wir sind um etwas zu weit gegangen;
wann die Pauern thun wollen, was sie können, so kommen wir mit harter
Mühe von einanderen; schlagen wir, so ist die Partey zu ungleich;
wir müssen hier einen Meisterstreich und mehr Vernunfft als die Waaffen
brauchen'...»
Klarer kann man kaum darstellen, dass die ganze Armee Rudolf
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 517 - arpa Themen Projekte
gut ausgerüsteten und gut postierten Bauern eingeschlossen
und erdrückt zu werden —falls diese sich ihrer Macht bewusst geworden
wären! Ferner geht aus dem eben zitierten Passus hervor, dass
Rudolf Werdmüller zu Verhandlungen nur als zu einer List griff, um
sich inzwischen dieser gefährlichen Lage entziehen zu können. Ausserdem
steht dies noch ausdrücklich in einem der nächsten Sätze: «Unterdessen
schickte er, Herr General-Major Werdmüller, um Zeit zu gewinnen,
einen Tambour an die Bauern, Officiers zu begehren, mit welchen
er reden könne...» Worauf dann ausführlich geschildert wird, wie er
während den Verhandlungen seine Truppe Zug um Zug aus der
Schlinge zog.
Es war also eitel Bramarbasiererei verhinderter Draufgänger, wenn
zwei Tage darauf der St. Galler Hauptmann Studer an seine Regierung
schrieb: «Wenn wir vorgestern angriffen hätten, so hätte das gwüsslich
etlich 1000 Puren das Leben gekostet.» Ebenso, wenn der Untervogt
Schnorf von Baden, der uns als Tagsatzungsbote bereits wohlbekannte
Herrendiener, meinte, es wäre an diesem 2. Juni «schon Glegenheit gewesen,
einen gewaltigen Streich gegen die Puren zu versetzen, welches
mit Unwillen einiger Officiere unterbliben».
Ein viel «gewaltigerer Streich» aber wurde den Bauern durch die
Verhandlungen versetzt, die als Ausweg aus der tödlichen Verlegenheit
Rudolf Werdmüllers eröffnet worden waren. Höchst bezeichnend bemerkt
darüber das vermutlich von ihm selbst inspirierte «Schreiben» an
einen guten Freund»: «wie nun sein Intention mehr ware zu schlagen
als zu tractieren, dessen er keine limitierte Commission nit hate, so
auch seinen Officieren und Soldaten das Angenehmste gewesen wäre,
gedachte er doch, den Bauern solche Articul vorzuschreiben, dass wenn
sie selbige eingingend, man wohl ungeschlagen seyn könnte» — also
den Sieg ohne Schwertstreich auf seiner Seite hätte! Und zwar war
«des Herrn General-Major vornemste Intention» dabei — wie bereits
bei einer vorgegangenen «Traction» tags zuvor —, «Ohneinigkeit zwüschen
die Bauern zu bringen».
Auf das mit Drohungen gespickte Verhandlungsangebot Rudolf
Werdmüllers hatten die Bauern eine Stunde Bedenkzeit verlangt, nach
deren Ablauf, wie Basthard sagt, «die grossen Stuckhen unter si spulen
seiten». «Indessen kam», wie Peter erzählt, «General Werdmüller (der
Generalissimus) mit zweitausend Mann Fusstruppen und der verlangten
Artillerie an; er war bereits, da die Bedenkzeit verstrichen war,
ohne dass die Bauern abgezogen waren oder eine Antwort gegeben
hätten, im Begriffe, Befehl zum Schiessen zu geben, als eine Patrouille
des Hauptmanns Holzhalb meldete, vom nächsten Dorfe (Othmarsingen)
her ,eräugten sich Mittelspersonen'. Es waren einige Abgesandte
der Lenzburger, mehrere Bauernführer und zwei Geistliche: Hans Ulrich
Bülich (?Basthard schreibt: Külich), ,ein schwarzgrauer, wohlberedter
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 518 - arpa Themen Projekte
Die Abgesandten baten General Werdmüller ,um der teuren
Leiden Jesu Christi willen inständig, flehentlich und dringend um Gewährung
eines weiteren Waffenstillstandes' bis sieben Uhr des folgenden
Morgens und gelobten ihm in die Hand, dass ,si so viii bei ihrer
Pursame erhalten wollen, dass alssdann solle ein völliger Verglych getroffen
werden'»!
Diese verdächtig bereitwilligen Unterhändler haben also in der
Tat, wie Hauptmann Wetter schreibt, «der Gnad begehrt», ja geradezu
um Gnade gewimmert. Es war eine von vornherein zur Kapitulation
entschlossene Gesandtschaft! Und dies zwar eine, die wohl ganz bestimmt
nicht von der Gesamtheit der Bauern bevollmächtigt worden
war — dazu hätte schon die Zeit nicht gereicht. Aber auch die Zusammensetzung
der Delegation legt dies nahe: zwei Pfarrer aus Dörfern
der nächsten Umgebung führen sie an, und sie selbst besteht offenbar
hauptsächlich aus ortsansässigen Bauern der nächsten Umgebung,
«einigen Lenzburgern» und «mehreren Bauernführern», die in keiner
Quelle näher bestimmt sind. Es hat vielmehr ganz den Anschein, als
ob unter dem Eindruck der örtlichen Panik eine regionale Kapitulanten-Partei
die wunderbare Gelegenheit des Werdmüllerschen Verhandlungsangebots
an sich gerissen hätte, um im Interesse der Wiederherstellung
der bisherigen Zustände, d. h. im allgemeinen Interesse der Herren.
«Frieden» zu machen — und zwar einen «Frieden» um jeden Preis!
Denn folgendes sind — nach dem «Schreiben an einen guten
Freund» — die Bedingungen, welche die beiden Herren Werdmüller
dieser Delegation wagen durften vorzuschreiben»:
«Erstlichen: Ohne einichen Verzug sich voraus hinweg aus dem
Felde nach ihren Häusern zu begeben und ihre Waaffen beyseits zu
legen.
Zweitens: Sie sollind den ohnbefügten Pundt, den sie unter sich
selbsten gemacht, widerruffen und abthun und der Oberkeit auf ein
Neues huldigen.
Dritens: Sie sollind ihre Beschwerden alle uns schriftlich und
mündtlich eingeben, zwüschet ihnen und ihren Herren zu urteilen, auch
uns vor ihre Richter erkennen und anloben, allem dem unverbrüchlich
nachzukommen so von uns werde erkennt und geurteilt werden.
Zum Vierten: Dass sie diesere unsere Armee ohne einiche Hinderung
oder Ergreiffung einicher Waaffen in dem Land hin und bar
nach unserm Belieben sollen gehen lassen, um denjenigen, der sich der
Gerecht- und Billigkeit wiedersetzen wollte, mit Gewalt und unseren
Waaffen zur Gebühr zu bringen, da hingegen versprochen seyn solle,
alle gebührende gute Disziplin und Ordres zu halten.
Ueber diese 4 Puncten nun sollend sie sich eilends erklären, ihr
Ja oder Nein sagen; brächte uns kein Hindernis an unseren billichen
Waaffen und Vorhaben; allein so sie der Gebühr und Billichkeit zuwider
disen Vorschlag nit annemmen werdind, so solle hiemit das unschuldige
Blut, so hierüber möchte vergossen werden, auf ihren Köpfen
ruhen gegen Gott zu verantworten.»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 519 - arpa Themen Projekte
Charakteristisch für diese ganze «Gesandtschaft» des Pfarrers
Hemmann ist, dass dieselbe Quelle von der sofortigen Annahme dieser
«articul» seitens derselben reden darf und zwar unter — ihrerseits —
äusserst bereitwilliger Stellung von Geiseln: «Wie sie nun in die
4 Puncten eingewilliget haien, wurden Geisel von ihnen begehrt... Sie
offerierten sich alle, Geisel zu seyn oder welche der Herr General-Major
von ihnen begehrte»! Wenn dieser dann auf die Geiselstellung verzichtete,
so nur aus dem guten Grund, dass solche «Unterhändler» dem
Zweck der Entzweiung und Zersetzung der bäuerlichen Uebermacht
einen weit besseren Dienst leisteten, wenn er sie als Agenten für die
Propagierung der 4 Punkte der Kapitulation ins Lager der Bauern zurücksandte!
Das «Schreiben» «Schreiben» nämlich fährt unmittelbar fort: «Hierüber
fragt er sie, ob aber alle Bauern seines begehrens wo! berichtet
und dessen zufrieden wären. Sie antworteten: nit alle (sic!), dann es in
der Kürze der Zeit nit Hate seyn mögen. Hiemit sagte er ihnen: ,So begehre
ich keine Geisel. Es fängt an, Abend zu werden; gehet hin, berichtet
sie alle diese Nacht über, und so es euch Ernst ist, so kommt Morgens
früh in das Lager, aufs Längste bis 7 Uhren, so wollen wir die
Puncten in Schrifft verfassen'» —d. h. den Friedensvertrag, den «völligen
Verglych», abschliessen, den von «ihrer Pursame erhalten» zu wollen
diese seltsame Gesandtschaft dem General von vornherein «in die
Hand gelobte»!
Als dieser dunkle Handel eben abgekartet wurde, dröhnten vier
Kanonenschüsse vom unfernen Schloss Lenzburg über Land. Es war
das zwischen der Generalität und dem Schlosskommandanten Junker
May von Rued abgemachte Zeichen dafür, dass die Berner Herren nicht
gesonnen seien, den Murifeld-«Frieden» einzuhalten! Das nämlich war
die einzige gewissermassen «offizielle» Nachricht über diesen «Frieden»,
die der Generalissimus und die Zürcher Herren überhaupt in der ganzen
Zeit seit dessen Abschluss von den Berner Herren zu erhalten vermochten.
Denn diese letzteren hatten ein eminentes Interesse daran,
die kriegerische Exekution gegen die Bauern, die der Vorort im Auftrag
der Tagsatzung entfaltete, ja nicht durch die Mitteilung eines
«Friedens» zu hemmen, den sie ohnehin schon beim Unterschreiben zu
brechen entschlossen waren.
Diese vier Kanonenschüsse im Rücken des Bauernlagers trugen
natürlich mächtig dazu bei, die Bauern in Schrecken zu jagen, auch
ohne dass diese um deren eigentliche Bedeutung wussten. Umgekehrt
feuerten die vier Schüsse den Kriegswillen der Herrenarmee, d. h. ihrer
Offiziere, umso mächtiger an, als diesen die Bedeutung der Schüsse bekannt
war. Das geht aus den Offiziersberichten hervor, unter denen
z. B. der des St. Galler Hauptmanns Studer sagt: «... da haben die
Generalen genug zu tun gehabt, dem Angriff zu wehren, so begierig
war man zu schlagen.»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 520 - arpa Themen Projekte
Umso eifriger war es den Herren Generalen jetzt darum zu tun,
endlich das Original des Murifelder Vertrags zu Gesicht zu bekommen,
auf das sie nun schon seit drei Tagen ständig vergeblich Jagd gemacht
hatten, da sich die Bauern bei jeder Gelegenheit darauf wie auf ihr
Evangelium beriefen. Dies Original aber konnte nur mit Leuenberger
und. seiner Kriegskanzlei ins Lager der Bauern gelangen, und das geschah,
wie wir wissen, erst in der darauffolgenden Nacht zum 3. Juni.
Höchst wahrscheinlich aber hat General Werdmüller auch der so äusserst
willigen Kapitulanten-Delegation des Pfarrers Hemmann gegenüber
jetzt umso nachdrücklicher auf der Vorweisung oder gar Auslieferung
des Original-«Friedens» von Murifeld bestanden, als er jetzt
erstens, nach den Signalschüssen von Lenzburg, der Meinung sein
konnte, es könnte sich dabei um eine von den Berner Herren gar nicht
unterschriebene Fälschung handeln, und als er jetzt zweitens selber im
Begriffe zu sein schien, einen ähnlichen «Frieden» ohne Kampf abzuschliessen.
Denn noch war bis jetzt und mit dem 2. Juni «von einem eigentlichen
Kampfe... überhaupt nicht zu reden», und zwar, um die Lage
mit den Worten Peters nocheinmal zu unterstreichen, «weil sich Generalmajor
Werdmüller einem mächtigen Feinde gegenübersah, so dass er
den Weg nach Lenzburg nicht mit Gewalt zu nehmen versuchen wollte»
(? konnte!). Sein einziger «Vorteil war die überlegene Artilleriestellung,
weil es den Bauern an grobem Geschütz mangelte». Im übrigen war
seine Armee an diesem Tag —der schönfärberischen Tendenz des Zürcher
Herrenchronisten zum Trotz —sehr wohl in eine «bedrängte Lage»
geraten, wie wir oben durch Zitat der Quellen ausführlich bewiesen
haben. Darum konnte Rudolf Werdmüller bei seinem Vorstoss in Richtung
Lenzburg nur versuchen, sich am Nordabhang des Hügels Maiengrün
an der Landstrasse nach Othmarsingen (das ist der in den früher
zitierten Quellen erwähnte «Berg von Bruneggen» oder «Berg uff Megenwil»)
in einer für unsere Artillerie möglichst günstigen Gefechtsstellung
defensiv einzurichten, um den Bauern während den Verhandlungen
ständig drohen zu können, «dass die grossen Stuckhen unter si
spulen selten». Das scheint auch tatsächlich den Eindruck auf die
Bauern nicht verfehlt zu haben; denn Peter berichtet: «Angesichts des
auf sie gerichteten schweren Geschützes zog sich ein Teil der Bauern
in die Wälder zurück; andere Abteilungen blieben zwar stehen, gingen
aber keineswegs zum Angriff vor» — so vollkommen verkannten sie
ihre wirkliche Stärke, den nach Rudolf Werdmüllers eigenen Ausführungen
aussergewöhnlichen Vorteil ihrer Stellungen der Herrenarmee
gegenüber. Trotzdem schien den Herren ihre vorgeschobene Stellung
auf dem Maiengrün offenbar nicht sicher genug, um sie über Nacht
gegen einen eventuellen Handstreich der Bauern halten zu können.
Denn nach vollzogenen Verhandlungen zogen sie diesen starken Aussenposten
wieder ein. Peter berichtet: «nachdem sich die unter einer
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 521 - arpa Themen Projekte
Stellungen zurückgezogen... hatten, marschierten die eidgenössischen
Truppen in ihr Lager zurück» — «zwar mit etwas Unwillen der Soldaten,
dann sie lieber gefochten hätten», meint das «Schreiben an einen
guten Freund»; «mit Unwillen einiger Officiere», sagt wohl richtiger
der Untervogt Schnorf.
An der Spitze der «unwilligen» Offiziere, die jede verpasste Gelegenheit,
unter den Bauern ein Blutbad anzurichten, erzürnte, stand
vom Anfang des Feldzugs an, und gewiss auch jetzt wieder, der Generalmajor
Rudolf Werdmüller -—trotzdem er für den Augenblick gezwungen
war, mit den Bauern zu «tractieren». Nur zähneknirschend
hat sich der notorische Haudegen und Bauernfresser den aus vorsichtigerer
Einschätzung der Lage eingegebenen Befehlen des Generalissimus
gefügt. Dafür aber hat er sich anderweitig schadlos zu halten gewusst,
indem er nämlich schon jetzt — nicht etwa, wie sonst damals
üblich, erst nach gewonnener Schlacht seiner gewordenen Söldnerbande
die «libertet» zum Plündern und Brandschatzen der ansässigen
Bauern gab. Das geht aus höchst unverdächtiger Quelle hervor: aus
Berichten des Zürcher Rats selbst aus diesen Tagen an den Berner und
an den Luzerner Rat! So berichtet Zürich an Bern bereits am 1. Juni:
«Ein Teil der Reiter zeigte sich dabei wie in Feindesland, indem
sie sich in Wohlenschwil und Büblikon ans Plündern machten.» Und
an Luzern ging der Bericht: «Uss dem Lager wird geschriben, es seye
schlechte Disciplin, gehe mit Reuben und Plündern, Fluchen und
Schweren ungebunden.» Noch «manche Berichte bestätigen», sogar
nach Peter, «dass sie raubten und plünderten...» So berichtete beispielsweise
der Vogt von Knonau ebenfalls bereits am 1. Juni an seine
Regierung, den Zürcher Rat: «aus den Freien Aemtern bringe jedermann
Hab und Gut auf Zuger und Zürcher Gebiet in Sicherheit...;
denn es «herrsche im Freiamt ein grosser Schrecken, weil die Armee
um Mellingen alles gar arg zerstöre». Aus einem weiteren Bericht im
Zürcher Staatsarchiv geht hervor, dass der Generalissimus die Truppen
sowohl im Städtchen als auch im Lager konsignieren musste, «wyl by
den Puren wegen des Roubens und Plünderns der Reütter grosser Zorn
vorhanden». Und Peter berichtet: «General Werdmüller sah sich veranlasst,
einen Armeebefehl mit Androhung der härtesten Strafen gegen
das Plündern zu erlassen.»
In der Nacht vom 2. auf den 3. also übernahm Leuenberger den
Oberbefehl über die Bauernarmee. Das militärische Erbe, das er antrat,
war —nach allem, was wir aus den Quellen nachweisen konnten
— keineswegs entmutigend, geschweige katastrophal. Dies umso weniger,
als in der Zwischenzeit die Organisation des ursprünglich so plan-
und führungslos zusammengelaufenen Bauernlagers ganz über Erwarten
in Ordnung gebracht worden war. Das war das Verdienst Hans
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 522 - arpa Themen Projekte
Abendsitzung der Ausschüsse der zweiten Landsgemeinde zu Huttwil
am 14. Mai, in die militärische Leitung des Aufstandes gewählt worden
war. Er hat als faktischer, wenn auch nicht formell bestellter
Statthalter Leuenbergers bis zu dessen Ankunft ganz hervorragende
Arbeit geleistet. Das wichtigste waren die gewaltigen Verschanzungen,
die er in ganz wenigen Tagen in grossem. Umkreis um das Bauernlager
hatte schlagen lassen. Diese haben das Staunen der Generalität der
Herrenarmee erregt, als diese wenige Tage später, nach gefallener
Entscheidung, auf dem Vormarsch nach Lenzburg diese Gegend durchquerte.
Ein zeitgenössischer Herrenchronist, der aus den besten Quellen,
aus direktem persönlichem Verkehr mit den Angehörigen der Generalität
selbst, schöpfen konnte, hat uns dies bezeugt: der Zürcher
Pfarrer Johann Konrad Wirz in seiner «Ohnparteyischen substanzlichen
Beschreibung der Eidgenössischen Unruhen im Jahre 1653» —
einer waschechten Herrenchronik, die jedoch auf Reklamation der
Berner Regierung damals schon deshalb nicht erscheinen durfte, weil
sie das einzige authentische und darum populäre Leuenberger-Bildnis
(unsere Abbildung 6) enthielt, das damit vernichtet werden sollte.
Wirz schreibt dort über die Verschanzungen des Bauernlagers: «Sunsten
hat man auf dieser Reiss (als sich General Werdmüller nach dem
Friedensschluss nach Lenzburg begab) hin und wider mit Verwunderung
gesehen, mit wass ansehnlicher Mühe und unverdrossener Arbeit
die Puren fast aller orthen sich verhauen und gleichsam verschanzet,
mächtig grosse und übereinander gefällte Bäume, hinder denen sie
sich mit grossem vortheil hätten wehren können.»
Ferner aber hat Hans Jakob Hochstrasser in wahrhaft fieberhafter
Tätigkeit für allseitiges Aufgebot aller Bundesgenossen in allen vier
Kantonen und für fortgesetzte Mahnungen um Zuzug und Nachschub
immer neuer Bauerntruppen gesorgt. Manche von ihm ausgefertigte
Aufmahnzeddel vom 1., 2. und 3. Juni sind noch erhalten, so im Berner
Staatsarchiv. Einen der von Peter publizierten Zeddel wollen wir
hier, als besonders ergreifendes Zeugnis für die bäuerliche Aktivität
der letzten Stunde, im Wortlaut abdrucken. Er ist geschrieben um
2 Uhr früh des Entscheidungstags, des 3. Juni, und lautet:
«Ir lieben Landtsleüth und Bundtsgenossen durch das gantze Bärn
und Solothurner Biet, wo es hinkhombt. Es ist unsser gantz ernstliches
bitten und begehren an Euch, Ihr wollet doch umb Gottes Willen uns
in aller Yl Volckh schicken; dan wir sind von den Zürchern und Schaffhaussern
überfallen mit Reüttern und fuossvolckh, deren ein gros anzahl
ist, und wir gar hart sind angefochten. Derentwegen sprechen wir
an alle und jede Bundtsgenossen, so weit es möglich ist, d'ir wollet unss
in aller yl volckh schicken. Wir haben etlich Schuss auss Lentzburg
ghört, wurden wir schon zum 3. mal angriffen mit scharmutzieren und
ist unss auf heut um sieben Uhren der Streit angekündt. Hierums nochmalen
unser bitt, wo etwas Volckh uff der Reis wär, die sollen und
wollen unss ungentz zu Hilf kommen. In yl usa dem Lager 3. Juni,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 523 - arpa Themen Projekte
Jakob Hochstrasser.»
Dieses war nun ein bereits in Anwesenheit Leuenbergers und mit
seinem Willen oder auch direkt auf seinem Befehl verfasstes Mahnschreiben
Daraus geht hervor, dass Leuenberger sich kurz nach seiner
Ankunft im Lager entschloss, nicht zu verhandeln, sondern zu kämpfen!
Das kommt in dem Schreiben vor allem in dem Passus zu geradezu
programmatischem Ausdruck: «.... und ist unss auf heut um sieben
Uhren der Streit angekündt.» Denn auf 7 Uhr erwartete General
Werdmüller ja die Fortsetzung der Kapitulationsverhandlungen, die
er tags zuvor mit dem von Pfarrer Hemmann geführten Deputation begonnen
hatte, sowie wohl auch die Vorweisung des Originals des Murifelder
«Friedens». Wenn also Leuenberger sich weigerte, darauf einzugehen,
vielmehr die Zumutungen des Generals als Kampfansage auffasste,
so fasste er damit einen Beschluss von einer bei ihm und unter
den gegebenen Verhältnissen ganz unerwarteten Kühnheit und Tragweite:
er warf der Kapitulanten-Partei den Fehdehandschuh hin und
setzte seine ganze Hoffnung auf eine Karte: das Schlachtenglück! Dass
dies wirklich seine Meinung war, bewies er dadurch, dass er noch in
derselben Nacht nicht nur die Aufmahnungen um Nachsendung von
Verstärkungen durch Eilboten in alle Windrichtungen, besonders in
die Kantone Bern und Solothurn, sandte, sondern auch eine militärische
Anordnung von grosser Bedeutung traf: er liess die strategisch
wichtigsten Höhen zwischen beiden Armeen, den Hahnenberg und dasselbe
Maien grün, das eben noch im Besitz Rudolf Werdmüllers gewesen
war, durch starke Kontingente besetzen! Diese Befehle sind Zeugen für
einen nicht minder erstaunlichen militärischen Klarblick des eben erst
im Lager Eingetroffenen.
Aber die Zwietracht, die Zersetzung durch den Unterwerfungswillen
der Kapitulanten, hatte sich während der drei ungewissen und politisch
führungslosen Tage des Lagerlebens angesichts der wohlgerüsteten
und provozierend sich gebärdenden Herrenarmee —insbesondere
unter dem einschüchternden Eindruck der täglich wiederholten gewaltsamen
Rekognoszierungen Rudolf Werdmüllers —bereits viel tiefer in
das Bauernheer, aber besonders auch in die landeseingesessene Bauernschaft,
eingefressen, als der eben erst hier eingetroffene Leuenberger
auch nur ahnte. Darum wird aus verschiedenen Quellen übereinstimmend
berichtet, dass Leuenberger über die Uneinigkeit im Lager «erstaunt»
oder «verwundert» war. So meldet z. B. das «Schreiben an einen
guten Freund»: er «fand eine grosse Zweytracht unter ihnen, dessen
er sich sehr verwunderte, dann er wusst nichts von dem, was den vorigen
tag gehandelt worden».
So stand also Leuenberger ganz unvermittelt vor den «Vier Punkten»
der Kapitulation und — was weit schlimmer war — vor einer bereits
unaufhaltsam weiterfressenden Wirkung dieser «Vier Punkte».
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 524 - arpa Themen Projekte
selben Abend, und zwar noch kurz vor dem Eintreffen Leuenbergers,
in wahrhaft katastrophaler Weise für die Zwecke der Kapitulationspartei
ausgenützt worden. Peter berichtet darüber: «sowohl im Heere
als auch in vielen Gemeinden der Grafschaft Lenzburg war man nämlich
am Abend (des 2. Juni) zur Beratung der Frage zusammengetreten,
ob gegenüber dem zürcherisch-ostschweizerischen Heere der Weg
der friedlichen Unterhandlung zu beschreiten oder ,gwalt anzulegen'
sei; darüber hatte man sich entzweit: ,Theils (d. h.: ein Teil) wolte den
Löwenberger zuerst berichten' ...» —das waren die dem Bunde Treugebliebenen,
«,doch entlieh abgemehret, der generalitet gnad und versprechen
zu geloben; der meist Theil welt die vorgeschlagenen artickel
annemmen und morgens früh ins lager gehen, dieselben zu besteten'».
Die Mehrheit war also für den Verrat an der ganzen Bauernsache gewonnen,
als Leuenberger im Lager eintraf!
Umso imponierender und erschütternder ist es, dass und wie Leuenberger
sofort nach seinem Eintreffen den Kampf gegen die Kapitulanten
und insbesondere gegen die Absendung einer Delegation an
Werdmüller aufnahm. «Fr. Leuenberger», heisst es in dem «Schreiben
an einen guten Freund», «missriethe ihnen dasselbige aufs höchste,
ihnen sagende, sie sollind ihme folgen. und ihne mit den blauwen
Züricheren handlen lassen. Er wolle sie dörfen versicheren, dass wann
sie mit ihrer Armee vor der Züricheren Lager ruken, dass sie (die Zürcher)
ihnen nicht Fuss halten werden.» Nach dem, was wir soeben
von der militärischen Lage am 2. Juni gehört haben, kann dies nicht
einfach als leere Prahlerei bezeichnet werden; vielmehr ist, wenn man
die Voraussetzung, die Leuenberger dabei macht —dass wirklich die
ganze Armee entschlossen angreift —, als erfüllt annimmt, auch diese
Aeusserung Leuenbergers ein Beweis für seine richtige Einschätzung
der militärischen Lage, wenigstens ihrer Möglichkeit nach, soweit diese
vom Glauben an die Sache abhing. Diesen Glauben aber scheint Leuenberger
tatsächlich durch sein Auftreten wieder neu belebt zu haben.
Denn der Verfasser des «Schreibens» fügt hinzu: «Die Bauern liessen
sich bereden, kam auch am Morgen keiner zur bestimmten Zeit ins
Lager...»
Doch so leicht, wie dies danach scheinen könnte, gaben die Kapitulanten
und Verräter ihr Spiel nicht auf. Im Gegenteil: jetzt brach das
Geschwür des Verrats erst offen auf! Und zwar war es in der Hauptsache
die in der näheren oder weiteren Umgebung des «Schlachtfeldes»
ortsansässige Bauernschaft, vor allem die Lenzburger, die, von der
Angst um ihre Habseligkeiten gepackt, zum Judas an Leuenberger und
an der gesamten Bauernsache wurde. Trotzdem es nämlich Leuenberger
gelang, die Mehrzahl der Bauern im Lager wieder umzustimmen
und für den Kampf zu gewinnen, «verlangte die Mehrzahl der
Lenzburger Bauern», wie Peter berichtet, «dass sich innerhalb der angesetzten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 525 - arpa Themen Projekte
Lager begeben sollten, um den Frieden unter den von General
Werdmüller aufgestellten Bedingungen anzunehmen. Als ihrer Bitte
nicht entsprochen wurde, sandten sie am frühen Morgen des 3. Juni
eine Gesandtschaft von fünf Hauptleuten, mit Pfarrer Hemmann von
Ammerswil an der Spitze, zu General Werdmüller und baten ihn im
Namen der ganzen Grafschaft Lenzburg ,unter dem anhange, dass man
sie für (vor) dem Löwenberger und anderen Rebellen schütze' (!) um
Frieden...»
Das war also nackter Verrat angesichts des Feindes und offenes
Ueberlaufen zu ihm! Und das bedeutete den entscheidenden Schlag
für die innere Kampfbereitschaft der Bauernarmee wenige Stunden vor
der letzten Kraftprobe...
Umso tragischer all dies, weil nun Leuenberger gegen die Früchte
seiner eigenen verhängnisvollen Schule des Verhandelns und Kapitulierens
zu kämpfen hatte, die ihn selber soeben noch auf dem Murifeld
zur Preisgabe des Bundes und zur einseitigen Waffenniederlegung geführt
hatte —genau wie das die «Vier Punkte» jetzt wieder verlangten!
Wohl mochte er gerade daraus jetzt endgültig gelernt und gerade
daraus seinen neuen Kampfwillen geschöpft haben, dass er in seiner
eigenen Schule so bitter enttäuscht und so schmählich betrogen worden
war. Aber nun war es endgültig zu spät: weder durch Einsicht,
noch durch kühne Tat war die offene Wunde, die er selbst so weit geöffnet
hatte, jetzt noch zu schliessen —unaufhaltsam floss aus ihr nun
das Verderben der Bauernschaft...
Der Generalissimus Werdmüller wurde während des Vormittags
des 3. Juni durch vergebliche Erwartung gar hart auf die Folter gespannt.
Denn durch den von Leuenberger erzielten Mehrheitsentscheid
gegen die Kapitulanten-Deputation des Prädikanten Hemmann war
diese letztere entwertet worden und kein Instrument mehr zur Erzielung
eines kampflosen Unterwerfungsfriedens. Darum gab ihr der
General zwar «freundlichen Bescheid», schickte jedoch erneut «drei
Trompeter» zu Leuenberger und seiner Mehrheit, «vom gegentheil zu
wüssen, wessen sy gesinnet», und «erwartete der übrigen Pauren Resolution
mit höchstem Verlangen». «Endlich kamen», wie Vock erzählt,
«als Parlamentärs ein paar Feldmusikanten der Bauern» und
überbrachten dem Oberbefehlshaber Werdmüller ein Schreiben Leuenbergers,
in welchem er diesen auf den nächstfolgenden Tag, den 4. Juni,
einlud, «der Herr Generalfeldobrister wolle unbeschwert Morgens um
7 Uhr zwischen Ihrer Gnaden Armee und unserer Armee halben Wegs
erscheinen»!
Diese Sprache von Gleich zu Gleich scheint nun aber für das
Prestige des Generals, nachdem dieser in den vier Punkten bereits die
sofortige Zustimmung zur vollen Unterwerfung verlangt hatte, untragbar
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 526 - arpa Themen Projekte
Leuenbergers, als Schiedsrichter den Alt-Hofmeister von
Königsfelden, Johann Georg Imhof, anerkennen zu wollen, den verhältnismässig
populärsten Berner Herrn, gebürtiger Aarauer, aber
längst Berner Burger und Mitglied des Grossen Rates, der sich gerade
zu Besuch in Werdmüllers Lager befand. Denn diese Anerkennung
eines Einzelnen, nicht unmittelbar am Krieg Beteiligten als Schiedsrichter
musste in Werdmüllers Augen eine glatte Ablehnung des dritten
der vier Punkte bedeuten, der in der unverfrorensten Weise verlangte,
die Bauern sollten die gegen sie kriegführenden Herren als ihre «Richter»
anerkennen, deren Befehlen sie «unverbrüchlich nachzukommen»
hätten. Kurzum, «General Werdmüller lehnte, unter Hinweis auf die
am 2. Juni abgegebenen Versprechungen (!) der Bauern, Leuenbergers
Vorschlag bestimmt ab», wie Peter formuliert. Als ob die «Versprechungen»
der von der Mehrheit der Bauern desavouierten Verrats-Delegation
des Pfaffen Hemmann für Leuenberger verbindlich gewesen wären!
Gleichzeitig aber stellte der Generalissimus dem Leuenberger ein
Ultimatum von drei Stunden, sich bei ihm, im Lager des Generals, zu
«Unterhandlungen» zu stellen; «nach Verfluss der drei noch anberaumten
Stunden aber werde er seine Pflicht tun und jene, die freundlichen
Ermahnungen (!) ihr Ohr und Herz verschliessen, die Strenge der Gewalt
fühlen lassen. Dies sollen sie dem Leuenberger eilends zur Kenntnis
bringen», erzählt Vock. Mit diesem Bescheid schickte Konrad
Werdmüller die Feldmusikanten Niklaus Leuenbergers an diesen zurück.
Der General jedoch scheint an den Erfolg seiner Aktion selbst
nicht mehr geglaubt, sondern den Widerstandswillen Leuenbergers
richtig herausgefühlt zu haben. Denn ohne dessen Antwort abzuwarten,
«liess General Werdmüller, um ein freieres Schussfeld zu erhalten,
in der Ebene um das Lager eiligst mehrere hundert Bäume fällen» und
mit den gefällten Bäumen das Lager seinem «ziemlich tiefen und breiten
Graben» entlang noch besser verschanzen.
In der Tat würdigte Leuenberger den Generalissimus keiner Antwort
mehr. Dafür kam kurz nach zwölf Uhr mittags von der «Reiter-Wacht»
der «sichere Bericht», «dass sich ihre (der Bauern) ganze
Armee bewegte und auf unser (der Herren) Lager zugienge», wie das
«Schreiben an einen guten Freund» meldet. Auch der Hauptmann Studer
berichtet von diesem Augenblick, dass «das Heer der Bauern allerseits
mit grosser Gwalt anmarschierte». Und Basthardt erzählt: «...so
kommen die leichtfertigen Bauten und stellen hinder dem Berg, rechts
vor unserem Hauptlager, von den in Hölzern versambleten Bauern selbe
in Batalia, praesentieren sich bei gedachter Höche alles schwarz vornen
mit 2 weissen Fahnen, also dass von ihrem Volckh alles schwarz
war.» Im Lager der Herrenarmee aber ward —wie wieder das «Schreiben»
meldet — unverzüglich «resolviert, sich stille in dem Lager zu
halten und sie ankommen zu lassen; der Reüter-Wacht ward Ordres
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 527 - arpa Themen Projekte
Nach denselben Quellen resümiert und präzisiert Peter, «dass
teils von den Höhen des Maien grün herunter, teils von Bruneck her
einige tausend Bauern auf das Lager zumarschierten. General Werdmüller
besammelte hierauf den Kriegsrat, der beschloss, ,im Lager zu
halten und Leib und Gut zuzusetzen'. Die Reiterwacht wurde zurückgezogen
und so nahm das eidgenössische Heer, gestützt durch das befestigte
Lager und gesichert durch die wohlauf gepflanzte Artillerie,
eine abwartende Stellung ein.»
Das ist der Beginn dessen, was Vock mit einigermassen übertreibendem
Pathos die «Schlacht bei Wohlenschwil» nennt. Er lässt dabei
das gesamte zürcherische Heer samt Artillerie das Lager verlassen,
mächtig nach Westen bis an das verschanzte Lager der Bauern vorstossen,
wobei das Dorf Büblikon «zur Hälfte verbrannt» wird, dort
«ihr grobes Geschütz kreuzweise durch die Wälder spielen», dann gegen
Süden einschwenken, um einen Umgehungsmarsch und Flankenangriff
Leuenbergers in schwerem, dreistündigem Kampf abzuwenden.
«Beim und im Dorfe Wohlenschwil stiessen die Parteien aufeinander
und entbrannte heisser Kampf. Die Bauern schlugen sich mit grosser
Unerschrockenheit drei volle Stunden, bis das Dorf Wohlenschwil in
Brand aufging und die Kirche, die Pfarrwohnung und fast alle Häuser
in hellen Flammen standen. Dieser schreckliche Anblick, vereint mit
der ununterbrochenen Tätigkeit des groben Geschützes auf Seite der
Eidgenossen, dämpfte die Raserei der Bauern und brach ihren Mut.»
Erst als «die Truppen beiderseits von der Anstrengung erschöpft waren,
zogen sich die beidseitigen Heere in ihre Lager zurück».
Diese — hier nur im Auszug wiedergegebene — «klassische» Schilderung
der «Schlacht bei Wohlenschwil» ist leider, wenn man die Quellen
vergleicht, nichts als ein Phantasieprodukt des guten alten Domdekans
Aloys Vock! Die einzigen realen Fixpunkte dieses Phantasiegebildes
sind die halbe Einäscherung Büblikons und die ganze Einäscherung
Wohlenschwils, mit dem Unterschied von der Wirklichkeit,
dass diese auch dafür teilweise grundsätzlich andere Ursachen
denn allgemeines Kriegsbrandunglück aufweist — nämlich bewusste
Brandstiftung als Terrormassnahme seitens des Junkers Rudolf Werdmüller!
Wir wollen hier dem Phantasiegebilde die nüchterne Schilderung
des Verlaufs dieses Entscheidungskampfes folgen lassen, wie ihn Hans
Nabholz nach den Quellen wiederhergestellt hat. Dann wollen wir die
Darstellung eines andern modernen Historikers nach denselben Quellen
folgen lassen, die Leuenbergers «Feldherren»-Rolle bedeutend positiver
hervortreten lässt und die bezüglich der Herren eine wichtige
Korrektur enthält, welche den Brand von Wohlenschwil betrifft; denn
über dieses Ereignis gleitet auch Nabholz schonungslos hinweg. Nabholz
berichtet:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 528 - arpa Themen Projekte
«Der erste Angriff der Bauern auf die rechte zürcherische Flanke
war äusserst flau. Er hatte einzig den Zweck, die Zürcher aus ihrer
wohlbefestigten Stellung herauszulocken. Die Bauern beschränkten sich,
wie Hauptmann Müller» (das ist der Landammann von Glarus, Hauptmann
des Glarner Kontingents) «erzählt, darauf, sich von weitem .frei
öffentlich zu präsentieren mit Drohen, Hurten, Winken, das Hindere
(rev.) Kehren und Grosstun'. General Werdmüller empfing sie mit
einigen wohlgezielten Schüssen und schickte ihnen ein Kontingent Musketiere
und Kavalleristen, das nach Basthards Bericht 3000 Mann stark
war, entgegen, vor dem sich die Bauern rasch in den Schutz der Wälder
zurückzogen. Auf keinen Fall hat das gesamte zürcherische Heer
samt Artillerie das Lager verlassen.
Nach diesem ersten Angriff, der den Charakter einer blossen Demonstration
hatte, scheint eine Pause eingetreten zu sein. In diesem
Momente kam die Meldung, dass Leuenberger mit einigen Tausend
Bauern hinter den Höhen von Mägenwil vorrücke, um die linke Flanke
des Lagers anzugreifen. ,Daruff wir gute wachtung gehalten', notiert
Scheuchzer in seinem Tagebuch, worauf er folgendermassen weiterfahrt:
,und zu abent umb 3 und 4 uhren der und mit villen fahnen zu
dem lager sich genachnet.'
Also erst 2-3 Stunden nach dem ersten Auftauchen der Bauern
erfolgte ihr Hauptangriff und zwar gegen den linken Flügel des zürcherischen
Heeres. Hier kam es nun zu einem mehrstündigen Gefechte,
das sich indessen niemals zu einem hitzigen Kampfe entwickelte. Man
gab stark Feuer auf die Bauern, sagt Scheuchzer und scharmützierte
mit ihnen bis gegen 7 oder 8 Uhr abends.
Ueber diesen Teil des Kampfes ist der Extrakt» (d. h. das von uns
schon wiederholt zitierte «Schreiben an einen guten Freund») «am
ausführlichsten. Auf die Kunde von Leuenbergers Vormarsch, erzählt
er, erhielt Generalmajor Werdmüller vom Höchstkommandierenden
die Erlaubnis, mit 1000 Musketieren und Kavallerie gegen Leuenberger
vorzugehen, der auf Kanonenschussweite vom Lager Halt gemacht
hatte. Der Vorstoss Werdmüllers hatte den Zweck, ,einen ihrer Posten
zu ataquieren und zu sehen, was hinter ihnen stecke. Greng hiemit aus
und geschah ein ernsthafter Scharmutz, der bis auf den Abend währte'.
Bei dieser Gelegenheit ging das Dorf Wohlenschwil, wie Studer und
Basthard übereinstimmend erzählen, in Flammen auf.» (Studer berichtet
darüber jedoch noch etwas ganz anderes, wie wir gleich sehen
werden!) «Aber auch diese beiden Berichterstatter erzählen in ganz
gleicher Weise, dass es sich nur um ein ,Scharmüzieren' handelte. ,Ist
also von 2 nachmittags bis umb 8 uhr scharmütziert worden', meldete
Studer nach St. Gallen. Und Basthard erzählt, man habe mit solchem
Eifer ,chargiert', dass man jeden Augenblick das ,Haupttreffen' erwartete.
Allein gerade in diesem Momente seien Trommelschläger der Bauern
beim General erschienen, die im Namen Leuenbergers um Einstellen
der Feindseligkeiten ersuchten.
Also auch auf der linken Flanke, bei Wohlenschwil, ist es zu keinem
ernstlichen Kampfe gekommen, weil sich auch hier die Bauern
vor dem Geschütz Werdmüllers und den vorrückenden Truppen rasch
wieder in die Wälder zurückzogen, in denen sie sich nach Basthards
Ausspruch wie die Murmeltiere verkrochen hatten.
Dass es nirgends zu einem ernstlichen Kampfe gekommen war,
beweisen auch die Verlustziffern. Die Zürcher hatten einen Toten und
zwei Verwundete.» (Das ist eine offensichtliche, wenn auch oft wiederholte,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 529 - arpa Themen Projekte
im «Schreiben an einen guten Freund» steht: «...also dass byderseits
tod! und verwundt, zwahren mehr auf der Bauern als unser Seithen
waren»; womit und zwar von einem Augenzeugen, offensichtlich mehr
als ein Toter gemeint ist!) «Da zu jener Zeit noch die Entscheidung
im Nahkampfe mit Schlagwaffen herbeigeführt wurde, spricht schon
diese geringe Zahl von Opfern auf zürcherischer Seite für die Tatsache,
dass die Bauern nirgends ernstlichen Widerstand geleistet haben.»
(?) «Ueber die Zahl der gefallenen Bauern liegen keinerlei zuverlässige
Angaben vor. Die ganz vagen Schätzungen schwanken zwischen
50 und 200...
Während des ganzen Kampfes war das Vorgehen der Bauern zögernd
und unentschieden. Es fehlte jedenfalls an einem einheitlichen,
die ganze Masse beseelenden festen Willen zum Kampfe. Die Mehrzahl
der Bauern, die dem Rufe zum Zuzüge Folge geleistet hatten, war wohl
bereit, ihren Herd gegen den Angriff des Zürcherheeres zu verteidigen.
Dagegen hatten sie keine Lust, selbst angriffsweise vorzugehen, um so
weniger als mit den Herren in Bern im Murifeldvertrage ein für die
Aufständischen vorteilhafter» (?) «Friede abgeschlossen worden war.»
So ganz lendenlahm aber, wie Nabholz sie haben möchte, sind die
Bauern denn doch nicht gewesen! Vor allein wird in den nicht gerade
auf gründlicher Analyse beruhenden Schlussfolgerungen der entscheidende
Umstand überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass es in der
Bauernarmee eben zwei Parteien gab: eine kampfentschlossene Kriegspartei,
und zwar diesmal unter der Führung Leuenbergers, und eine
zur Kapitulation entschlossene Partei, die ja vor der Ankunft Leuenbergers
und der zahlreichen Hilfsscharen sogar das Uebergewicht gehabt
hatte und, als sie durch Leuenberger in Minderheit versetzt worden
war, noch am Morgen dieses Entscheidungstages zum offenen Verrat
überging.
Mit einer derart innerlich gespaltenen Armee zu sie gen, war ein
Ding der Unmöglichkeit! Dass aber Leuenberger mit ihr trotzdem zu
kämpfen vermochte, ist eine besondere Leistung, die ganz anders gewürdigt
zu werden verdient, als Nabholz dies tut. Wie initiativ und mit
welch erstaunlich gutem militärischem Instinkt Leuenberger dabei vorging,
geht weit besser aus dem Bericht des Zürcher Herrenchronisten
Peter hervor. Wir geben hier darum auch das Hauptstück dieses Berichts
wieder — wobei wir den von Nabholz mit Recht kritisierten
«dritten Angriff der Bauern von Tägerig aus», den Peter aus verschiedenen
Darstellungen ein- und derselben Kampfphase konstruiert hat,
gerne preisgeben. Wir heben dabei die wichtigsten Korrekturen gegenüber
Nabholz besonders heraus. Im Wesentlichen resümiert Peter (nach
denselben Quellen wie Nabholz) folgendermassen:
«... Denn ihr Angriff von Norden her war nur eine Demonstration,
darauf berechnet, einen Teil des eidgenössischen Heeres vom Lager
nach Nordwesten abzulenken, damit alsdann der Hauptangriff
gegen die linke Seite des Lagers umso mehr Aussicht auf Erfolg habe.
Während sich nämlich der linke Flügel der Bauern, von einem Teil
des eidgenössischen Heeres verfolgt, gegen Bruneck zurückzog, führte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 530 - arpa Themen Projekte
des Hahnenberges gegen Wohlenswil, um von dort aus in das Lager
einzubrechen, ,so weit man beurteilen konnte mit dem Plane, sich der
Geschütze zu bemächtigen und den Regierungstruppen die Rückzugslinie
nach Mellingen abzuschneiden'.»
(Hierher gehört ein «Bericht an Hauptmann Schwyzer», die
Quelle, die Peter zur Annahme eines dritten Angriffs der Bauern verführte
und die lautet: «haben sich der Reuss nach hinabbegeben und
vermeint, die unseren im Ruggen anzugryfen, sind aber wie zuvor von
dem Geschütz übel empfangen und von unsern Reuttern mit Verlust
etlicher abgetrieben worden».)
«Wie aber Leuenberger das Lager erblickte, fand er es nicht ratsam,
einen Sturm über das schussfreie Feld hinweg zu unternehmen,
sondern blieb einen Kanonenschuss weit davon entfernt stehen. Nur
kleinere Abteilungen kamen zwischen drei und vier Uhr etwas näher,
um die Truppen aus dem Lager herauszulocken. Sie wurden mit Artilleriefeuer
empfangen und mit ,zimlichem Schaden' zurückgewiesen.
Da brachen plötzlich von Wohlenswil und Büblikon her alle Fahnen
der Bauern in raschem wohlgeordnetem Schritt gegen das Lager
hervor, ,erschracken zuerst die Verteidiger desselben, bsunders da
glychzytig ein heftiges Unwetter lossbrach'. General Werdmüller liess
auf das heranrückende Bauernheer ein heftiges Artilleriefeuer eröffnen,
worauf dieser ,Vormarsch' zum Stillstand kam. Wieder versuchte
Leuenberger kleinere Abteilungen vorzuschieben.
Nunmehr aber führte Generalmajor Rudolf Werdmüller mit tausend
Musketieren und beinahe der gesamten Kavallerie einen Gegenstoss
so energisch aus, dass sich die Bauern zum Rückzug hinter Wohlenswil
und Büblikon genötigt sahen, und nun liess Rudolf Werdmüller,
,um dem Gegner die Schrecken des Kriegsrechts vor Augen zu
stellen, Wohlenswil, dessen Bewohner sich geflüchtet hatten und auch
Rebellen waren, plündern und in Brand stecken'...»
(Diesen Passus zitiert Peter aus Hauptmann Studers Bericht, den
auch Nabholz kennt, ohne diese für die Erkenntnis der geschichtlichen
Wahrheit über den Brand von Wohlenschwil entscheidende Nachricht
wiederzugeben! Sie wird übrigens ferner gestützt durch einen Bericht
des päpstlichen Nuntius in der Schweiz vom 12. Juni nach Rom, in
dem er, mit deutlicher Spitze gegen den Protestantismus, schreibt:
«Der Zürcher General liess... ein ganzes katholisches Dorf in der
Nähe von Mellingen in Brand stecken; in der Kirche verbrannten alle
Heiligtümer.» Ja, letztere wurden sogar noch während des Brandes
von den Herrentruppen geraubt, z. B. «ein Kelch, so 70 Gulden gekostet»;
aber auch «dem Pfarrherrn seine meisten Mobilien, über 250
Gulden wert», wie aus einem Brief des Kapitels von Mellingen an die
regierenden VII Orte hervorgeht, den Vock wiedergibt.)
«,Noch in währender Action' liess darauf Leuenberger General
Werdmüller durch Parlamentäre um Einstellung des Kampfes bitten.
Die Bitte wurde wiederholt, und Leuenberger übersandte General
Werdmüller das Original des Murifelder Vertrages, worauf die Feindseligkeiten
sofort abgebrochen wurden.»
Aus dieser Darstellung Peters —der keineswegs etwa der «Bauernfreundlichekeit»
bezichtigt werden kann —geht eindeutig hervor, dass
Leuenberger und seine Getreuen diesmal — unter den gegebenen Umständen
—wirklich bis zum äussersten gekämpft haben, ehe sie klein
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 531 - arpa Themen Projekte
vom 12. Juni, in dem über die letzte Phase des Kampfes zu lesen
steht: «Die Bauern versuchten in grosser Anzahl mit äusserster Anstrengung
sich des Reussübergangs zu bemächtigen; sie wurden aber
mit starken Verlusten zurückgeworfen und infolgedessen sehr eingeschüchtert
und entmutigt, so dass sich bei ihnen eine starke Sehnsucht
nach Frieden einstellte.»
Ferner geht aus allen Quellen und Darstellungen eindeutig hervor,
dass Leuenbergers militärische Führung sehr initiativ und für einen
Nichtmilitär geradezu erstaunlich geschickt war! Schon dass er
bereits in der Nacht, kaum im Lager angekommen, die beiden strategisch
beherrschenden Höhen Maiengrün und Hahnenberg besetzen
liess, bekundet dies. Am darauffolgenden Tag wurden diese beiden
Höhen von Leuenberger zu den Hauptstützpunkten für seine beiden
Hauptaktionen gemacht: das Maiengrün zu demjenigen der ersten
Scheinoffensive, des Ablenkungsmanövers nach Nordwesten; der Hahnenberg
zu demjenigen der Umgehungsaktion, die zum Hauptangriff
von Süden her führte. Und wie kühn ist dieser Einbruchsversuch in
die südliche Flanke der Herrenarmee, ja in deren Rücken ausgedacht!
Hier wäre durch die Abschneidung der Rückzugslinie und die Eroberung
des Reussübergangs im Rücken der Herrenarmee in der Tat ein
ganz grosser, vielleicht vernichtender Sieg der Bauern über die Herren
zu erfochten gewesen, wenn...! Ja, wenn es Leuenberger gelungen
wäre, die Bauern zu einem Sturm auf die Geschütze zu bringen, wie
er es offensichtlich vergeblich versucht hat, — wenn nicht inzwischen
in seinem Rücken die Panik gesiegt und die «Sehnsucht nach Frieden»,
d. h. der Wille zur Kapitulation, die Oberhand gewonnen hätte...
Denn militärisch besiegt wurden die Bauern von den Herren überhaupt
nicht. Das ist das zweifelsfreie Ergebnis auch der kritischsten
Sondierung aller Quellen und Berichte. Ja, jetzt erst, nach dem mehrstündigen
Treffen mit den Bauern, fuhr den Herren die «Furcht vor der
eigenen Courage» in die Glieder — wohl der beste Beweis dafür, dass
die Bauern, die überhaupt in den Kampf eingetreten waren, also Leuenberger
und seine Getreuen, sich wirklich imponierend geschlagen
haben müssen! «Bezeichnend für die Lage im eidgenössischen Lager»,
so referiert Peter, «ist der Umstand, dass nach Abbruch des Kampfes
noch am Abend des 3. Juni die gesamte Artillerie nicht weiter im Lager
verblieb, sondern auf dem rechten Ufer der Reuss auf einem Hügel
(nordwestlich von Mellingen, wo jetzt die Eisenbahn im tiefen Einschnitt
durchgeht, ,Krummet 421 m') Stellung bezog...» Darüber lässt
Rudolf Werdmüller sich durch seinen Lobredner im «Schreiben an
einen guten Freund» folgendermassen fast wie für einen Sieg belobigen:
«Gegen Abend zöge sich der Herr General-Major mit guter Ordnung
zurück in das Lager, von welchem er auf der anderen Seithen
der Reuss eine Höhe ersehen, von deren man den Bauern mit Stuken
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 532 - arpa Themen Projekte
hinzubringen.» Aber es war ein klarer Rückzug der Herren, und als
Ergebnis des gefährlichen Flankenvorstosses Leuenbergers gegen die
rückwärtige Basis der ganzen Herrenarmee war es ein glänzendes
nachträgliches Zeugnis der Herren Generäle für Leuenbergers militärische
Begabung!
Ja, selbst die Berichte, die die Generalität während den Ereignissen
des 3. Juni fortlaufend an den Rat des nahen Zürich sandten, müssen
eher Panikmeldungen als Siegesnachrichten geglichen haben. In
Zürich herrschte eine fieberhafte Erregung und Tätigkeit bis tief in
die Nacht. Das am 1. Juni angeforderte dritte Aufgebot wurde in aller
Eile marschfertig gemacht, «um sogleich nach Mellingen abmarschieren
zu können». Noch nachdem man bereits Nachricht vom Friedensverlangen
der Bauern erhalten hatte, ordnete zwar der in Abendsitzung
tagende Rat unverzüglich den Bürgermeister Waser und den Statthalter
Salomon Hirzel als Unterhändler ins Lager von Mellingen ab, aber mit
einer höchst kleinlauten Instruktion: «mit den Fürgesetzten Rücksprache
zu nemmen, warum man nit Gust befinde, noch auch könnte
inen mehr Hilfe als die bereits aufgebotene schicken, und dahin zu
trachten, wie eine Ussglych intreten syn möchte»! Ja, «weil man sich
auf eine längere Kriegsführung gefasst machen wollte, beschloss der
Rat, bei den Zünften alsobald eine Gutssteuer zu beziehen, den französischen
Gesandten um eine namhafte ,Geldserlegung' zu mahnen und
vom venezianischen Gesandten die monatliche Erlegung von viertausend
Dublonen, die im Kriegsfalle, gemäss Vertrag, zu bezahlen war,
zu verlangen...» —und was derartiger, in vollendeter Schamlosigkeit
längst zur Gewohnheit gewordener Rückgriffe auf das Schandgeld auswärtiger
Fürstensklaverei mehr gewesen sein mögen. Jedenfalls aber
wollen wir mit Peter zusammenfassend konstatieren: «Man erkennt aus
diesem Ratsbeschluss und aus dem Verhalten Werdmüllers, dass der
Rat und die Feldherren den mächtigen Gegner als äusserst gefährlich
ansahen»! Wenn das die Bauern — wenn das Leuenberger gewusst
hätte...!
Jedoch, nachdem Leuenberger erlebt hatte, dass sein Plan, sich
der Geschütze zu bemächtigen, undurchführbar war, weil die Bauern
sich offensichtlich weigerten, das dazu nötige Blutopfer zu bringen;
nachdem dann die Geschütze unter den Bauern erst recht ungehemmt
hatten aufräumen können und infolgedessen die reine Todesangst den
ohnehin schon starken und organisierten Kapitulationswillen in den
Massen rapid wieder obenauf gebracht hatte: nach dem allem musste
Leuenberger jetzt verhandeln. Das war so klar, dass sogar ohne oder
gegen seinen Willen verhandelt worden wäre —wie ja der Mellinger
«Friede» andern Tags tatsächlich ohne seine Beteiligung zustandekam.
Und das war so.
Am Abend des Gefechts selbst wurde nur noch über das Vorgehen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 533 - arpa Themen Projekte
wozu Werdmüller «einen Waffenstillstand bis morgens zehn
Uhr» bewilligte. Es scheint, dass schon diese Abmachung über Leuenbergers
Kopf weg getroffen wurde, zwischen dem General und den
Kapitulanten direkt. Denn nebenher läuft Leuenbergers eigene, erfolg.
lose Anstrengung, vom General eine Zusammenkunft «auf halbem
Wege», eine Besprechung «auf freiem Felde» zu erlangen. Leuenberger
war also entschlossen, sich nicht geschlagen zu geben, sich nicht zu
unterwerfen, vielmehr betont von Gleich zu Gleich zu verhandeln. Zugleich
mit seinem abschlägigen Bescheid liess General Werdmüller den
Obmann und Feldherrn der Bauernarmee zur blossen «Teilnahme an
den» — mithin anderweitig bereits festgesetzten — «Friedensverhandlungen
im Lager» einladen, und dies durch ein zwar sehr höflich abgefasstes
«eigenhändiges Schreiben», das jedoch den «Gnädigen Herren»-Stil
in keinem Wort verleugnet: «...dass selbiger an einem bequemen
Orth mit mir zu reden begehrte, so bezügen ich hieruff, dass Imme
solliches bewilligt syn solle und er demnach zu mir in mym Lager
kommen, syn begehren und angelegenheit gebührlichen ablegen...»
etc. Aber Leuenberger blieb — was alles Peter berichtet —auch dann
noch fest und antwortete, «er wünsche daran festzuhalten, dass die
Zusammenkunft ,auf halbem Wege' stattfinde». Werdmüller trat auf
dieses Begehren wieder nicht ein; da er jedoch diesen Hecht unbedingt
in seinem Teich haben wollte, lud er Leuenberger am 4. Juni früh
neuerdings ganz besonders angelegentlich ein, «er möge mit einer beliebigen
Anzahl Begleiter, mit fünfzig oder mehr, zwischen 7 und 8 Uhr
ins Lager kommen, ,so könent mir, was zum lieben friden des werden
Vatterlandes mag gereichen, unss mit einanderen besprechen...'; er sei
noch diese Stunde freundlich gegen ihn gesinnt und wolle, was seine
Feldküche ertragen könne, mit ihm teilen».
«Allein dieses freundliche Schreiben erreichte Leuenberger schon
nicht mehr im Lager. Er hatte, da ihm General Werdmüller keine Besprechung
auf freiem Felde bewilligen wollte, offenbar Argwohn geschöpft.»
Das mag allerdings sein; jedoch wohl nicht —wie Peter zu
vermuten scheint —, dass Leuenberger seine Gefangennahme befürchtet
hätte. Aber er witterte vermutlich Verrat in einem anderen Sinne: er
sollte einer Komödie beiwohnen und in ihr sogar die Hauptrolle übernehmen
— er sollte den elenden Verrat der Hemmann'schen Kapitulanten
mit seinem ehrlichen Namen decken und dadurch den «Sieg» des
Zürcher Generals ansehnlich, ja erst eigentlich zu einem solchen machen
und vor Mit- und Nachwelt besiegeln! Doch nein, das gab es für
einen Leuenberger nicht! Er konnte irren und sich verwirren bis zur
Verzweiflung —ja, bis zu einem (aber ganz gewiss unwillentlichen!)
Verrat, wie ihm das noch eben, vor genau einer Woche, den Berner
Herren gegenüber mit dem Huttwiler Bund passiert war. Aber willentlich
verraten —das konnte ein Leuenberger nicht...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 534 - arpa Themen Projekte
«Daher machte er sich noch während der Nacht mit wenigen Begleitern
davon» — nicht deshalb (wie Peter in seiner Begründung
dieses Faktums vermutet), weil er, «seit er den durchaus undiplomatischen
Vertrag auf dem Murifeld eingegangen war, sein früheres Selbstbewusstsein
eingebüsst» hätte. Erst recht nicht deshalb (wie Peter
ferner vermutet), weil er «vielen seiner früheren Bundesgenossen, da
er entgegen dem Huttwiler Bunde mit der Berner Regierung einen Separatfrieden
geschlossen», möglicherweise «als Verräter erschienen»
wäre. Denn das war ja gerade sein neues Selbstbewusstsein: dass er
entschlossen war, aus seinem kapitalen Fehler im Lager auf dem Murifeld
zu lernen! Und das bewies er, wie es nicht besser zu beweisen war:
durch die Tat —indem er sich von der ersten Stunde seiner Ankunft
im neuen Bauernlager von Othmarsingen an zum Träger des entschlossensten
Kampf willens machte. Gewiss mag er bis dahin gerade einigen
der echtesten Revolutionäre unter den Bauern wegen des Separatfriedens
mit der Berner Regierung — aus guten Gründen also — «als Verräter
erschienen» sein. Aber jetzt, nachdem er als äusserst tätiger Feldherr
24 Stunden lang vor aller Augen den Kopf für seine neu, wenn
auch zu spät gewonnene Ueberzeugung hingehalten — jetzt waren
ganz gewiss nicht dies seine Feinde mehr, die echten Revolutionäre,
die nun vielmehr beginnen konnten, aufzuatmen. Sondern seine Feinde
waren die, die noch in der Morgenfrühe dieses Schlachttages zum
feindlichen General übergelaufen waren und diesen gebeten hatten,
«sie vor dem Löwenberger zu schützen»! Es waren die entschlossenen
Kapitulanten, die Verräter, die ihrerseits ja nur ihre Freude an dem
«Verräter» vom Murifeld gehabt haben müssten, und deren hasserfüllte
Kritik an Leuenberger eben die war, dass er sie in ihren Kapitulationswünschen
so völlig enttäuscht und durch seinen neuen Kampfwillen
ihnen neue schwere und vielleicht tödliche Verantwortungen gegenüber
den Gnädigen Herren und Obern aufgeladen hatte!
So also kam es, dass zum Abschluss des «Mellinger Friedens» am
Morgen des 4. Juni kein Leuenberger erschien, auch keiner seiner
Kriegsräte als Beauftragter Leuenbergers, ja kein einziger von all den
namhaften Bauernführern, die uns bisher begegnet sind. Zwar stellten
sich in des Generalissimus Konrad Werdmüller Zelt vor diesem und
seinem gesamten Generalstab, sowie vor dem eilig aus Zürich geholten
Bürgermeister Waser und dem Statthalter Hirzel, nach Peter ihrer 35,
nach Vock gar ihrer 43 «Abgeordnete» (angeblich 24 Berner, 10 Solothurner,
7 Luzerner und 2 Basler) ein. Es sollen «ansehnliche, achtbare
Männer» gewesen sein; aber keine Quelle meldet auch nur ihre Namen
— bis auf zwei unbedeutende Ausnahmen, vor allem den ihres Anführers
Stephan Reinli, eines geschichtlich völlig bedeutungslosen Untervogts
von Aarburg. Geschweige dass wir erführen, wie diese «Delegation»
zustandekam, wer sie beauftragte und womit! Sie taucht unvermittelt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 535 - arpa Themen Projekte
auf dem Intrigentheater.
In der Tat ist diese «Delegation» nichts anderes als eine verstärkte
Auflage ein- und desselben Kapitulanten-Ausschusses, der am Montag
Nachmittag, dem 2. Juni, unter Führung des Prädikanten Hemmann
mit Rudolf Werdmüller verhandelt und der am frühen Morgen des
3. Juni, zum Feind übergelaufen, um Schutz vor Leuenberger gebeten
hatte! Das geht wörtlich aus dem «Schreiben an einen guten Freund»
hervor, wo es — nach einer Lobeserhebung auf Generalmajor Rudolf
Werdmüllers glorreichen Rückzug der Artillerie auf das rechte Reussufer
— heisst: «Als er aber den 25 ten May (4. Juni) Morgens bey guter
Zeit wiederumb in das Lager kam, in des Herrn Generaln Zollt, fand
er die Abgesandten von Zürich, als Herr Bürgermeister Waser und
Herr Statthalter Hirzel und eben die Bauern, so den Montag zuvor (das
ist am 2. Juni nachmittags) mit ihme auf dem Feld tractirt haten.»
Nur, wie gesagt, waren es jetzt mehr als «eben die Bauern» —sie bildeten
viel mehr nur noch den Kern einer sehr angeschwollenen Gesandtschaft,
die nichtsdestoweniger stark lokalen Charakters gewesen zu
sein scheint, wie schon aus der Führung derselben durch einen Aarburger
Untervogt hervorgeht. Die 24 «Berner» werden in der Hauptsache
Aargauer gewesen sein («Lenzburger» etc.); die 10 Solothurner
naturgemäss Anhänger des Erzkapitulanten Adam Zeltner; auch 7 namenlose
Kapitulanten unter den Luzernern waren natürlich leicht aufzutreiben;
während es nicht ganz so leicht fällt, sich den einzigen
andern (ausser Reinli) in einer Quelle mit Namen Genannten, den «vom
Landsturm von Liestal her bekannten» rotbärtigen Zweihänderschwinger
Hans Bernhard Roth, als «Ausschuss bei den Verhandlungen mit
Werdmüller» vorzustellen, wie Heusler berichtet.
Es konnte den Herren nicht schwer fallen, mit einer derartigen
Untertanen-Delegation fertig zu werden. Es bedurfte dazu kaum der
einleitend ausgesprochenen Drohung Wasers, «im Feld keinen Mann
von dem andern zu nemmen, biss alles widerumb richtig und in guten
Stand kommen». Denn Stephan Reinli führte gleich zu Beginn aus,
sie seien «nunmehr des Verderbens der Früchte müde» (eine der naturgegebenen
Grenzen jeder Bauernerhebung!) «und wegen des grossen
Kostens zum Kriege unmutig». Zwar wollte er anfänglich, wie Peter
berichtet, «an der Rechtskräftigkeit des Murifelder Vertrages festhalten»
— was allerdings nicht viel bedeutete —; ferner schlug er anstelle
des verratenen Bundes einen Kompromiss mit den Herren vor, indem
er «verlangte, dass man, falls der Huttwiler Bund durchaus nicht anerkannt
werden könnte, zur Regelung der Differenzen zwischen den
Bauern und ihren Obrigkeiten ein Schiedsgericht einsetze, bestehend
aus je zwei Abgeordneten der Regierungen von Bern, Luzern, Basel
und Solothurn und aus ebenso vielen der Bauernschaft jener Kantone»;
schliesslich forderte er gar, «dass sowohl die Regierungstruppen, als
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 536 - arpa Themen Projekte
bedeutete nur die etappenweise Durchführung eines von vornherein
festgelegten Rückzugs. Denn so «versöhnlich» — nach dem Herrenchronisten
Peter — Werdmüller, Waser und der ebenfalls beigezogene
bernische Althofmeister von Königsfelden Imhof «gestimmt» gewesen
sein mögen, so «konnten und wollten sie auf solche Begehren unter
keinen Umständen eintreten»!
Nun machte sich der «geschichtskundige» Bürgermeister Waser
daran, die Ideologie des Bauernbundes mit der Wurzel auszurotten.
Dazu bot ihm Reinli selber die beste Gelegenheit. Was auf dieser Stufe
der Revolution wohl keinem Entlebucher Bauernführer mehr eingefallen
wäre: Reinli berief sich auf die «alten Bünde», besonders das
Stanser Vorkommnis! Darauf suchte Waser ihnen klar zu machen,
«dass der Huttwiler Bund eine neue Eidgenossenschaft involviere, die
in oder neben den alten Bünden unmöglich bestehen könne, da sie
,inen schnurrichtig zuwiderlaufe'». Darin hatte Waser, wie wir wissen,
insofern recht, als der Huttwiler Bund zwar nicht den wirklich «alten
Bünden», d. h. der Ureidgenossenschaft der Gründungszeit, wohl aber
der Herren-Eidgenossenschaft «schnurrichtig zuwiderlief»; die eben
durch dasjenige Dokument begründet worden war, das Reinli nun in
beglaubigter Abschrift aus der Tasche zog: durch das Stanser Vorkommnis.
Ein echter Revolutionär hätte Wasers Einwand zum Stichwort
für die Forderung gemacht: jawohl, wir wollen mit dem Bauernbund
eine «neue Eidgenossenschaft» aufrichten, aus ihrer echten alten
Wurzel der Bauernfreiheit wieder aufrichten, und zwar so, ,dass sie
unsern heutigen und künftigen Nöten gründlich abhilft; und darum
muss die Herren-Eidgenossenschaft, die uns dabei im Wege ist, dem
Bauernbunde weichen! Statt dessen wies Reinli ausgerechnet das Stanser
Vorkommnis vor, mit der Begründung, «der Bauernbund sei gerade
infolge dieses allgemein eidgenössischen Abkommens berechtigt. Da
fiel es dem geschichtskundigen Zürcher Bürgermeister nicht schwer,
die Bauern zu überzeugen, dass das Stanser Vorkommnis direkt die Unterdrückung
von Volksaufläufen bezwecke»! In der Tat, dazu brauchte
Waser aus diesem Dokument nur laut und deutlich folgende Sätze
vorzulesen:
«Und ob under uns einicherley sundriger Personen, eine oder
mehr, theinist sölliche überpracht, uffrühr oder gewaltsammi, als obstath,
gegen jeman under uns oder den unseren, oder denen, wie vor
gelütert ist, ane (ohne) Recht fürnemmend oder begiengend, wer oder
von welchem Orth under uns die joch währind, die söllend, so dick
das beschicht, von stund an, nach ihrem verdienen und gestalt der
sach, darumb von ihren Herren und Obern wie alle hindernuss und
widerrede gestraft werden...
«Wir sind auch übereinkomen, und habend gesetzt, dass ouch fürbas
hin under uns, und in unser Eydtgnoschaft, weder in Stetten noch
in Ländern leman theinerley sunderbarer gefarlicher Gemeinden
(Landsgemeinden), Sammlungen, oder Antrag, da von dan jeman
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 537 - arpa Themen Projekte
öffentlich fürnemmen, noch thun soll, ane willen und erlouben siner
Herren und Oberen... (Wer solches dennoch) ze thun fürnemme, darzu
hilff oder Rath thäte, der und dieselben sollend alsdann nach ihrem
verschulden gestracks und ane verhindern von ihren Herren und Obern
gestrafft werden.
«Wir haben ouch mit sunderheit zwüschend uns abgeredt, und
beschlossen, dass fürbashin in unser Eydtgnoschaft und under uns by
Eyd und ere, nieman dem andern die sinen zu ungehorsami uffwysen
soll, wider ihr Herren und Obern ze sind, noch nieman die synen abzüchen,
oder understan widerwertig ze machen, dadurch die abtrünnig
oder ungehorsam werden möchten. Und ob jeman under uns die synen
wyderwertig syn wollten, oder ungehorsam wurdend, dieselben söllend
wir einander mit guten Trüwen förderlich helf fen ihren Herrn wider
gehorsam machen, nach lüt und durch kraft unser geschwornen
Pundtbrieffen. »
Das war also wahrlich kein Freiheits-, sondern ein Unfreiheits-Brief
—die feierliche Besiegelung der Bauernsklaverei! Und wenn die
Bauern sich auf ihn beriefen, so konnte dies nur aus krasser Unkenntnis
und Unverstand von Analphabeten geschehen. Denn damit banden
sie sich selber an Händen und Füssen...
Kein Wunder also, dass keine lange Sonderberatung der Bauern —
noch dazu dieser Kapitulanten-Gesandtschaft — von nöten war, um
Waser und den Werdmüllern den billigsten Triumph ihres Lebens zu
verschaffen. «Die Bauernausschüsse», schreibt Peter; «baten darauf
nach kurzer Beratung um Verzeihung für ihre Unbotmässigkeit und versprachen,
wieder als getreue Untertanen zu ihren Obrigkeiten halten zu
wollen, ,da sie der Obrigkeit so wo!! als des lieben Brots' bedürften.
Ohne Obrigkeit könnten sie ,weder busen noch hofen', sie begehrten
allein, dass ,man mit ihnen recht handle'.»
So aber sah der Friedens- oder besser Unterwerfungsvertrag von
Mellingen aus, mit dem diese bejammernswerte Bauerngesandtschaft
zu Kreuze kroch (Wortlaut nach Vock):
«Demnach Dienstags, den 24. Mai (3. Juni) 1653, der vier Städte,
Bern, Luzern, Basel und Solothurn, angehörige Unterthanen in starker
Anzahl sich gegen der Stadt Zürich und ihrer beiwesenden Eidgenössischen
Hilfsvölker vor Mellingen geschlagenen Lagern genähert, und
sie feindlich anzugreifen unterstanden, dieselben aber sich tapfer resolviert
und in die Gegenwehr erzeigt, hat darauf ermeldeter Unterthanen
aufgeworfener Oberster, Niklaus Leuenberg, einer Friedenshandlung
an einem Mittelorte begehrt, das ihm aber abgeschlagen, hingegen sind
sie in das Lager beschieden worden mit Versprechung sichern Geleits,
worauf auch in die 40 Ausschüsse daselbst erschienen, und folgendes
Begehren gethan:
1. Man solle sie bei ihrem Bunde verbleiben lassen, oder aber aus
den vier interessirten Städten benanntlich von jeder zwei Sätze aus
den Räthen, auch von den Unterthanen jeder Herrschaft zwei Sätze
geordnet werden, die noch streitigen Sachen zu entscheiden.
2. Die Waffen solle man so wohl, als sie, niederlegen, und aller
Orte die Städte und Schlösser von der Besatzung erledigen und räumen.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 538 - arpa Themen Projekte
3. Dass man sie solle verbleiben lassen bei demjenigen, was sie
mit ihren GH Herren der Stadt Bern auf dem Murifelde gehandelt.
Obgeschriebene drei Begehren hat man ihnen rund abgeschlagen,
und sich verlauten lassen, wenn sie sich nicht anders erklären würden,
würde man sie mit den Waffen, vermittelst göttlicher Hilfe, zur Gebühr
bezwingen, worauf sie eine Friedenshandlung in nachfolgenden
Artikeln begehrt, die dann auch erfolgt auf nachgeschriebene Form:
1. Sollen sie ohne Verzug, ein jeder, sich wieder nach Haus begeben,
die Waffen niederlegen, und fürohin dergleicher Auszüge sich
müssigen.
2. Den Bund, so sie vermeintlich mit einander gemacht, sollen sie
widerrufen und dem absagen, wie dann beschehen. Und die hierum
aufgerichteten Bundesbriefe sollen sie dem Herrn General von Zürich
unverweilt übergeben.
3. Was den Oberkeiten oder Unterthanen noch weiter möchte angelegen
sein, solle, in Ermangelung freundlichen Vergleichs, dem
Rechten unterworfen sein.
4. So lang und bis alle Sachen ihre Richtigkeit haben, und die
Huldigung erfolgt sein wird, sollen die Oberkeiten und hilfleistenden
Orte den Gewalt (die Truppen im Felde) noch behalten mögen.
Welche vorgeschriebene vier Artikel die Unterthanen von Bern,
Basel und Solothurn allerseits angenommen, und deren getreue Haltung
an Eides statt angelobt, die Ausschüsse der Luzernischen aber
sich entschuldigt haben, dass sie dazu nicht bemächtigt seien. Jedoch
haben sie auch an Eides statt angelobt, da man sie heimziehen lassen,
die Wehr alsbald niederzulegen, und wider ihre Herren und Obern
noch andere löbl. Orte nicht mehr zu gebrauchen, sondern gebührenden
Gehorsams sich zu befleissen. Darauf der Abzug von aller Orte
Unterthanen beschehen. Aktum im Lager bei Mellingen den 25. Mai
(4. Juni) 1653.»
So haben Waser und Werdmüller das Stanser Vorkommnis —wie
dies Carl Hilty ganz allgemein vom Gebrauch desselben in den «folgenden
Jahrhunderten» sagt — «zu geistloser Tyrannei gegen die Untertanen
missbraucht», dank der «korrupten Auffassung von einem selbständigen
Rechte souveräner Regierungen und einem Bund, der bloss
zwischen solchen, nicht zwischen Völkern besteht»!
Für die rechtliche Beurteilung alles dessen, was nun als Rachefeldzug
der Herren gegen die Bauern noch folgte, sehr bedeutungsvoll,
ist der Umstand, dass einer der vier oben wiedergegebenen Unterwerfungsbedingungen,
und zwar dem dritten Punkt, von seiten der Zürcher
Generalität nachträglich eine ganz andere, weit gravierendere Bedeutung
unter geschoben worden ist. Dieser Punkt 3 nämlich sollte, nachdem
die Bauern die Waffen niedergelegt hatten, auf einmal bedeuten,
dass die Bauern ihre Rädelsführer ausliefern und diese hingerichtet
werden sollten! Das war eine Bedingung, zu der die Zustimmung selbst
einer Kapitulanten-Delegation wie derjenigen Stephan Reinlis wohl
schwer erhältlich gewesen wäre. Vock muss deshalb berichten: «Die
Zürcherische Generalität behauptete nachher, sie habe den Ausgeschossenen
der Bauern mündlich angezeigt, dass die Bestrafung der Rädelsführer
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 539 - arpa Themen Projekte
vorbehalten sei.»
Jedoch das ist nichts als eine feige Finte der Zürcher Herren gewesen,
um sich nachträglich der blutgierigen Rachepolitik der Berner
Herren unter deren Druck anzupassen. Das ergibt sich selbst aus Peters
Darstellung, der resümiert: «Von der Auslieferung der Rädelsführer
war jedenfalls ursprünglich nicht die Rede. Das geht aus dem ersten
Bericht Zürichs an Bern über den Friedensschluss hervor, ebenso aus
Studers Bericht» (des St. Galler Hauptmanns in der Herrenarmee). Es
handelt sich also um; eine willkürliche Fälschung des Sinnes der Abmachung
zwischen dem Vorort der Eidgenossenschaft und den aufständischen
Bauern aller beteiligten Kantone; eine Fälschung, wie sie
ehemals ganz wesensgleich der eidgenössische «Ehrengesandte» Zwyer
am Rechtlichen Spruch in Ruswil schriftlich beging, während jetzt der
eidgenössische Vorort selbst sich nicht scheute, sie dem grundlegenden
«Schlussfrieden» mit den Schweizerbauern wenigstens mündlich unterzuschieben!
Es ist darum ja nicht von ungefähr, dass einer der ersten, die
Waser zu seinem diplomatischen Sieg über die Bauern gratulierten,
Zwyer war, der eben erst — am 2. Juni — vom Kaiserhof heimgekehrt
war und jetzt Waser triumphierend schrieb: «Die Aktion bei Mellingen
hat den Bauern den Kompass verrückt...»
In der Tat liefen nun die Bauernmassen, die doch ein Wille zur
Entscheidungsschlacht aus allen Winkeln der Heimat ins Feldlager
von Othmarsingen getrieben hatte, wie von einer Panik gepackt, nach
allen Richtungen der Windrose auseinander. «Sie kamen auf Einem
Wege nach Mellingen, und sie sind durch mehr als 24 Wege wieder
davon und heim geflohen», spottet die Aarauer Herrenchronik. Ob aber
wirklich, wie der St. Galler Herrenkorporal Basthardt meint, «die Pursame
mit solcher Freud und Eile nachher nach Hauss zogen, nit allein
gezogen, sondern gleichsam geloffen und seiend froh, dass sy daheim
rüewig syn können» —das ist denn doch mehr als zweifelhaft. Starke
Kontingente, die nur die durch den Hemmann'schen Verrat erreichte
Spaltung im Lager ohnmächtig machte, zogen zähneknirschend lediglich
ab, um sich ein anderes Schlachtfeld für die Entscheidung zu
suchen.
So zog bereits in der Nacht vom 3./4. Juni Leuenberger «mit einer
Schar Emmenthaler nach Langenthal zurück»; wie Vock meint: «wohl
einsehend, dass der auf dem Murifeld geschlossene Friede den vier
Artikeln des Mellinger-Vertrags weit vorzuziehen sei». Sehr wahrscheinlich
aber hatte Leuenberger bereits am Abend des 3. durch Botenläufer
Kunde davon erhalten, dass am selben Tag frühmorgens die
7000 Mann starke Berner Herrenarmee unter dem Junkergeneral Sigmund
von Erlach aus der Stadt Bern in Richtung Oberaargau ausmarschiert
sei. Auch Peter erklärt: «Ein Teil der Bauern marschierte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 540 - arpa Themen Projekte
am 5. Juni hatte Leuenberger, der keineswegs gewillt war, den Bundesbrief
herauszugeben, eine Proklamation erlassen, ,dass zwar zu Mellingen
Frieden geschlossen sei: falls aber durch die vorrückenden
Armeen irgend jemand ein Leid zugefügt werde, wolle er sofort Hilfe
bringen'. Leuenberger empfand es offenbar als ein Unrecht, dass im
Mellinger Frieden der Murifelder Vertrag nicht geschützt worden war,
und er war entschlossen, weiterhin Widerstand zu leisten. Daher zog
er bei Herzogenbuchsee so schnell als möglich die noch in Widerstand
verharrenden Bauernscharen zusammen...» Das führte dann am
8. Juni zur letzten Kriegshandlung im Bauernkrieg, zu dem infernalischen
Gefecht in Herzogenbuchsee selbst, das — wie wir noch sehen
werden — bereits nichts anderes mehr war als eine Massenhinrichtung,
ein feiger Racheakt der Berner Junker am Berner Volk.
Ferner aber brach am 4. Juni «nach vier Uhr abends» auch Schybi
mit seinen 2000 Luzernern aus dem Lager in Othmarsingen auf und
trat «missvergnügt», nach andern Berichten geradezu «wütend», den
Rückmarsch nach Luzern an. «Ihm folgten», wie Vock berichtet, «die
Truppen aus den Freien Aemtern», von denen der grössere Teil, statt
heimzukehren, mit den Aufrührern bei der Gisliker Brücke sich vereinigte.
Auch Schybi mag von den sofort nach Zwyers Rückkehr —
d. h. ebenfalls bereits am 3. —angeordneten Agressivmassnahmen der
Luzerner Herrenarmee schon in Othmarsingen unterrichtet worden
sein. Und auch der Abmarsch Schybis führte, bei der genannten
Brücke, zu einem heissen Gefecht, und zwar bereits am Tag nach dem
Abmarsch, am 5. Juni.
Beide Gefechte, das letzte Schybis und das letzte Leuenbergers,
sind zwar nur noch defensive Verzweiflungsakte der Bauern gegen die
sofort einsetzende Rache-Offensive der Herren gewesen; umso aussichtsloser,
noch eine Wende herbeiführen zu können, als diese Gefechte
mit solch tragisch zersplitterten Kräften, weit voneinander entfernt,
geschlagen werden mussten. Aber eben als solche leidenschaftliche
Ausbrüche des Bauernzorns nach vollzogenem «Mellinger Frieden»
widerlegen sie auf das schlagendste die von der Geschichtschreibung
bis auf den heutigen Tag unentwegt weitergeschleppte Herrenmär,
die Bauern seien in Mellingen sämtlich schier aus dem Häuschen
geraten vor Glück über diesen «Frieden» und dann «mit grossen Freuden
heimgezogen» — «ess ist nit usszusprechen, so haben die Puren
ein Freud wieder heimzugehen»!
Solche Weisheiten des St. Galler Hauptmanns Studer, oder gar
die ordinären Scherze seines liebedienerischen Korporals Basthardt,
wie etwa der, die Bauern seien in Othmarsingen auseinandergestoben
«wie die fledermeuss in der Wäldern hin und widerflattern», werden
aber heute auch von unsern «gut demokratischen» Schweizer Historikern
gern zur Stütze dieser Herrenlegende angeführt. Dabei müssen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 541 - arpa Themen Projekte
wie etwa Peter, selbst von den nicht mit Leuenberger oder Schybi abgezogenen
Bauern noch für deren Verhalten am 6. und 7. Juni Feststellungen
machen wie die: «es befänden sich in den Wäldern ,ob
Lenzburg gegen den Flecken Othmarsingen' zahlreiche Bauernabteilungen»,
die nicht weichen wollten; welche Trümmer der Bauernarmee
daher General Werdmüller mühsam aus dem festen Lager herausoperieren
musste; oder es sei gleichzeitig Bericht eingegangen, «dass
sich bei Schinznach jenseits der Aare, oberhalb Brugg, neuerdings
,eine grosse Anzahl sehr schwieriger rebellischer Puren immerhin befinden'»,
sodass der Generalmajor Werdmüller mit einem Heeresteil
nach Königsfelden marschieren musste, wo er übrigens nach alter Gewohnheit
durch Sengen und Plündern Schrecken verbreitete. Ja, Peter
muss noch vom 7. Juni feststellen: «Es hatte aber doch den Anschein,
als wollten sich die Bauern, die westlich von Lenzburg lagen, daselbst
ernstlich zur Wehr setzen, da» (immer noch!) «,in 8000' beisammen
waren.» Welch ein zähes Hangen an der Hoffnung, den Herren den
Weg doch noch verlegen zu können —und welche Tragödie der Enttäuschung
an allem, was den Bauern heilig war, haben doch diese
Wälder zwischen Othmarsingen und Lenzburg in den Tagen und
Nächten dieser traurigen Pfingstwoche gesehen!...
Aber auch der Basler Bauernzorn — nur von dem der Solothurner
hören wir nichts mehr —entlud sich nochmals nach der «Schlacht»
bei Mellingen bezw. Wohlenschwil, und, wie es scheint, in direktem
Zusammenhang mit den noch unbereinigten diplomatischen Folgen
derselben. Es scheint nämlich, dass nach dieser «Schlacht», aber noch
vor dem Abschluss des «Mellinger Friedens» «von Mellingen heimgekehrte
Landstürmer» —mithin solche, die, wie Leuenberger und seine
Schar, das Lager von Othmarsingen bereits in der Nacht vom 3./4. Juni
verlassen haben müssen — am 4. Juni in den «oberen Aemtern» des
Basellandes einen «Landsturm» auslösten. Denn welcher Grund für die
an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt erstaunliche Volksexplosion
auch immer genannt werden möge —der Funke ins Pulverfass konnte
wohl kaum etwas anderes sein als direkte Kunde der ersten Basler
Heimkehrer aus dem grossen Kampf, an dem infolge völligen Versagens
der Basler Bauernführer so wenige der doch so kampfentschlossenen
Baselbieter Bauern teilnehmen konnten. Das hatte im Baselland eine
fieberhaft gespannte Erwartungsstimmung geschaffen, in der die geringste
Nachricht von «fremden Völkern» die Explosion auslösen
konnte. Was die Ausschüsse der oberen Aemter zwei Tage darauf zur
Entschuldigung für ihre Rebellion vom 4. Juni verbrachten: es sei ihnen
glaubwürdig berichtet worden, «Ihre Gnaden (d. h. die Herren) wären
mit 9000 Mann und 12 Stück grossem Geschütz im Anzug, um die
Unterthanen zu ruinieren» — das kann sich sehr wohl auf die Tagsatzungsarmee
beziehen, mit deren furchterregendem Kriegsapparat
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 542 - arpa Themen Projekte
hatten.
Kurzum, Heusler berichtet: «In allen Dörfern wurde Sturm geläutet,
Alles eilte bewaffnet Liestal zu, einige tausend Mann kamen auf
dem alten Markte zusammen.» (Vermutlich sind dies die «mehrere
tausend», die Vock irrtümlich bereits am 2. Juni dort versammelt
glaubte.) «Vor das Schloss Farnsburg, welches seit einiger Zeit schon,
um das Einziehen von Soldaten zu verhindern, mit Wachen umstellt
war, kamen Scharen, welche die Herausgabe der Amtsfahne begehrten
und unter Vorzeigen von Aexten mit gewaltsamer Einnahme drohten.
Dem Landvögte Eckenstein gelang es, sie bis zum folgenden Tag
(dem 5.) zu vertrösten. Da wiederholten sie ihr Begehren und schickten
sich bereits an, mit Aexten das Tor einzuschlagen, worauf der Vogt,
der ohnehin wusste, dass die Sache zu Ende ging (!), zwanzig Mann
herein liess; sie nahmen Pulver, Lunten und Blei, schleppten auch eine
Kanone aus dem Turme in den Hof herunter, doch nicht weiter...»
Kurz, es war der Sturm auf eine Basler Bastille, der nicht zuende kam,
weil er nicht den Anfang, sondern das Ende einer Revolution bedeutete!
Von den am 4. auf dem alten Markt in Liestal Zusammengeströmten
wird berichtet, dass dieser bewaffneten Masse Alles fehlte — nur
nicht die «Täuschung». «Die von Mellingen heimgekehrten Landstürmer
hatten nämlich», so meint Heusler, «den Friedbrief (den oben
wiedergegebenen Mellinger Vertrag) mitgebracht, welcher zuerst die von
den Bauern gestellten Begehren, die rund abgeschlagen wurden, und
dann erst die wirklich bewilligten Friedensbedingungen aufzählte».
Einer Versammlung aber, die am Morgen, oder selbst erst am Mittag
oder Nachmittag des 4. Juni in Liestal zusammenlief, konnten diese
Heimkehrer unmöglich bereits den erst «zwischen drei und vier Uhr»
nachmittags dieses selben Tages in Mellingen abgeschlossenen und
durch Salvenfeuer verkündeten Vertragstext vorgelegt haben! Wohl
aber konnten sie den Text der drei Punkte mitgebracht haben, die am
Abend des 3. Juni im Lager von Othmarsingen aufgestellt und diskutiert
worden sein müssen, um sie zur Marschroute für Stephan
Reinlis Friedensverhandlung mit der Generalität am folgenden Morgen
zu machen und die jedermann im Bauernlager gegenüber den Herren
durchzusetzen hoffen musste.
So bescheiden nun auch diese drei Punkte an sich sein mochten —
für den Durchschnittsbauern, und besonders für den durch keine
höheren Forderungen verwöhnten Baselbieter Bauern, konnten sie bereits
als einen anfeuernden Sieg über die Herren gelten. So allein —
weder durch «absichtliche Täuschung», noch durch ein, bei Vorhandensein
des wirklichen Friedensvertrags ganz unmögliches Uebersehen
des Hauptteils des Vertragstextes —ist es zu erklären, dass sowohl der
Rat von Liestal als auch die Ausschüsse der vier oberen Aemter sich
unter dem Eindruck des von den Heimkehrern mitgebrachten Schriftstücks
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 543 - arpa Themen Projekte
richten, die ganz durch die drei Punkte inspiriert sind, welche von der
Generalität in Mellingen rundweg abgewiesen wurden.
In diesem Sinne also ist der Bericht zu korrigieren, den Heusler
davon gibt: «War es nun absichtliche Täuschung (!) oder lasen sie in
Liestal nur den ersten Teil des Friedbriefes (?), genug, im Namen des
Rates von Liestal und in dem der Untertanen der obern Aemter ergingen
am 26. Mai (5. Juni) zwei Schreiben nach Basel, welche vorgaben,
nach Inhalt des Friedens seien den Landleuten die alten Freiheiten zugesichert,
neue Auflagen aufgehoben, der neue Bund, so dem alten nicht
zuwider, in denselben eingeschlossen, streitige Fragen aber schiedsrichterlich
durch acht Mann aus den Städten und acht aus den Untertanen
zu entscheiden.» Und wenn bereits am Tag darauf der Rat von Liestal
und die Ausschüsse der oberen Aemter vor dem Basler Rat jäh und
jämmerlich in die Knie gingen und für die eben abgegangenen Briefe
winselnd um Gnade flehten — «der getrösteten und unterthänigsten
Hoffnung, Ihre Gnaden werden ihnen solchen Aufstand keinem Bösen
vermerken, sie wiederum in Gnaden erkennen und ihnen gnädige Resolution
widerfahren lassen» —: so spiegelt sich in diesem plötzlichen
Niederbruch alles Mutes bei den sonst so mutigen Landschäftlern zweifellos
die niederschmetternde Wirkung wieder, die eben der wirkliche
«Friede von Mellingen», dessen vollständiger Text dem andern der
blossen drei Punkte auf dem Fusse folgte, auf die so hochgemut zur
Tat bereiten Basler Bauern gemacht haben muss! Zugleich zeigt dies,
wie von aller Führung verlassen diese Basler Bauern sowohl wie die
Liestaler Bürger gewesen sind...
Jetzt fiel überhaupt Alles auseinander. Des zum Zeichen sei hier,
mit den Worten Heuslers, die ergreifende Geschichte von Galli Jennys
Signalfeuer erzählt, die im engsten Zusammenhang mit dem letzten
Landsturm der Baselbieter geschah und die diesen greisen Meyer von
Langenbruck zum erschütternden Symbol der Verwirrung und der Verlassenheit
seiner Klasse macht. Da Gally Jenny der Letzte ist, der nach
den Bernern, den «Oberländern», den Bundesgenossen des grossen
Volksbundes jenseits des Jura, schreit, so kann es nicht fehlen, dass er
dafür den Märtyrertod auf dem Schafott wird sterben müssen.
«Zur Mahnung der Oberländer war, unter Vorsichtsmassregeln zur
Verhütung blinden Lärms, ein Feuerzeichen auf dem Buchsiberg bei
Langenbruck errichtet, von wo der Blick über Buchsgau und Aartal,
über Hügel und Seen bis an den Kranz der Alpen dringt. Der
Meyer von Langenbruck, der 70 jährige Galli Jenny, hatte den Befehl
über das sorgsam bewachte Lärmzeichen. Mit dem nach Liestal eilenden
Isaak Dettwyler, Glaser von Langenbruck, hatte er das Losungswort:
,Herr Jesu hilf uns!' verabredt. Dieses Losungswort gab Dettwyler
den Liestalern, aber mit der Bitte, um Gottes Willen keinen Gebrauch
davon zu machen. Sofort eilten Hans Jakob Gysin, der Rothgerber
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 544 - arpa Themen Projekte
Wirz (der wie seine Nachkommen bis auf den heutigen Tag den
Dorfnamen Buschber führte), nach Langenbruck. Sie rüttelten den
alten Jenny aus dem Schlafe auf, wiesen sich durch Mittheilung des
Losungswortes aus und erzählten, welsches Volk aus dem Bisthum sei
eingebrochen, man schlage sich bei Liestal. Auf die wiederholte Versicherung,
es sei dem also, gab Jenny den Befehl zum Anzünden des
Signals, dessen helle Flammen die so oft gefürchteten und ersehnten
Oberländer herbeirufen sollten. Als aber niemand erschien, ging Jenny
selbst nach Buchsiten und Langenthal, um die Hülfe zu holen; aber da
war nichts zu finden, die Berner Bauern waren selbst durch General
von Erlach bedrängt.»
Galli Jennys Signalfeuer auf dem Buchsiberg, vom Jurakamin zum
Alpenkamm, ist der letzte, bereits stumme Anklageschrei des Schweizervolkes
gegen seine Bedrücker im Bauernkrieg —zugleich der letzte
Hülfeschrei, dem keine Antwort mehr wird, nach dem grossen rächenden
Volksbund, der wie ein Traum im Rauch der Geschichte verschwindet.
.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 545 - arpa Themen Projekte
XIX.
Wie «disem ungeheuweren Thier der Rebellion syn
Kopf abgeschlagen, hiemit syne Krafft und Würkung
benommen» wurde
Das «eidgenössische» Schlusspiel, mit Marter, Richtschwert, Galgen
und Galeeren, nebst herrenfrommen Bibelsprüchen
«Ihr sollt in Leibeigenschaft bleiben —nicht in der, in welcher ihr
bisher gelebt, sondern in einer unendlich schlimmeren... Solange Wir
leben und mit Gottes Gnade dieses Land regieren, werden Wir Unsere
Vernunft, Unsere Kraft und Unser Vermögen dazu verwenden, euch
so zu misshandeln, dass eure Sklaverei ein warnendes Beispiel für die
Nachkommenschaft sein wird!» So wagte ein König von England am
Ende eines andern Bauernkriegs zu den Bauern zu sprechen, nachdem
er diese —wie die Berner Herren den Leuenberger, die Zürcher Herren
die Bauernarmee bei Mellingen — durch einen Vertrag hereingelegt
hatte, um diesen Vertrag, kaum dass die Bauern von der Hauptstadt
abgezogen waren, unverzüglich zu brechen. Doch das war bereits im
Jahr 1381 ... Der moderne Geschichtschreiber, der diesen «pompösen
Wortbruch» des englischen Königs berichtet —Karl August Wittfogel
in seiner «Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft» —, fasst dann, was
darauf gegen die Bauern erfolgte, in die Worte zusammen: «Der weisse
Schrecken hauste erbarmungslos.»
Genau dies war es, was nun auch die «Könige» in der hochwohllöblichen
«Eidgenossenschaft», «Mine Gnädigen Herren und Obern»,
im Jahr 1653 als Schlusstrich unter den Bauernkrieg zu setzen trachteten,
nachdem die Bauern auch ihnen auf den Leim von Verträgen
gekrochen waren, die nur dazu bestimmt waren, die Bauern an ihrer
Vertrauensseligkeit aufzuhängen. Und auch unsere «Könige» hatten dabei
«mit Gottes Gnade» keinen andern Zweck im Auge, als die Bauern
so zu misshandeln — zu entmachten, zu entrechten und zu entmenschen
—, dass die Nachkommenschaft des schweizerischen Bauerntums
auf unabsehbare Zeit von jeder Wiedererhebung des echt eidgenössischen
Freiheitsgeistes abgeschreckt werden würde. Und das ist
unseren «Königen» gründlich gelungen... gründlicher sogar als dem
König von England!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 546 - arpa Themen Projekte
«Alles deutete darauf, dass die Bauern nur einen Waffenstillstand
bis nach dem Schluss der Ernte eingehen und dann mit verstärkter
Macht einen neuen Krieg anfangen wollten. Diese Ansichten» — so meldet
Liebenau — «finden sich in zahlreichen Korrespondenzen zwischen
den Staatsmännern von Zürich und Bern ausgesprochen.»
Wir brauchen dem Klarblick dieser Herren wohl bestimmt keine
überflüssige Ehre anzutun; denn «diese Ansichten» sind ja nur der
Ausfluss ihrer Angstpanik vor der möglichen Machtentfaltung der
Bauern. Aber mit der Vermutung, dass die Bauern nur unter dem
Druck des nahenden Erntebeginns sich immer wieder derart mehrheitlich
zu Verhandlungen, ja zu Kapitulationen bereit fanden, treffen
«diese Ansichten» der Zürcher und Berner Herren ins Schwarze.
Denn das eben ist der verwundbarste Nerv jeder Armee von Bauern
in einem Bauernkrieg: dass der Bauer zu gewissen Jahreszeiten
einfach «ökonomisch unabkömmlich» ist! Darum hat noch jeder reine
Bauernkrieg stets zwischen Aussaat und Ernte stattgefunden. Ja, noch
mehr: mit Recht bezeichnet der Geschichtschreiber der bürgerlichen
Gesellschaft, Wittfogel, diese Stellung des Bauern im naturwüchsigen
Produktionsprozess als den «tiefsten Grund für die Grenzen der Kraft
aller Bauernrevolutionen». Und er gibt auf unsere zentrale Frage bezüglich
der Verhandlungsbereitschaft der Bauern — auf die Frage
nämlich: wie konnten die Bauern ihren Peinigern denn immer wieder
so blind auf den Leim kriechen? —die schlagende Antwort: «sie trauten,
weil sie wirtschaftlich gedrängt wurden, zu vertrauen»!
Aber nicht nur ihre Besorgnis um Aussaat und Ernte, um das
«Verderben der Früchte» —das ja auch Stephan Reinli den Waser und
Werdmüller gleich zu Beginn der Verhandlungen als Motiv für die
Kapitulationsbereitschaft der Bauern hervorstellte —; nicht allein die
natur gesetzliche Seite ihres Berufs also, ihre grosse Abhängigkeit von
den Naturbedingungen ihrer Arbeit, bestimmte das Verhalten der Bauern
im Krieg in sehr verhängnisvoller Weise. Vielmehr geschah dies
auch von einer andern Seite ihres Berufs, von der gesellschaftlichen
Seite her, in nicht weniger verhängnisvoller Weise. «Die Stellung der
Bauern im Produktionsprozess zwingt sie zu einem dezentralisierten,
zerstreuten Leben», sagt Wittfogel. Mit andern Worten: die bäuerliche
Arbeitsweise im bürgerlichen System, ihr individuelles Produzieren
in oft weit voneinander entfernten Bauernhöfen, zwingt den Bauern
zu einer gewohnheitsmässigen Absonderung von den andern Menschen,
die ihm jede Gemeinschaftsaktion überaus erschwert. Daher der uns
nun schon weidlich bekannte individualistische Anarchismus der Bauern,
mit dem sie alle ihre Kriege verlieren oder wenigstens verderben
— wenn ihnen nicht eine andere Klasse zu Hilfe kommt: eine aufsteigende,
um neue Produktionsbedingungen kämpfende und darum revolutionäre,
wie damals in England und später in Frankreich und ganz
Europa die bürgerlich-kapitalistische Klasse (die allerdings dann ihrerseits
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 547 - arpa Themen Projekte
Befreiung vom Feudalismus —übernahm!); oder wie heute die Arbeiterklasse,
die infolge ihrer Stellung im Produktionsprozess durch ein
gesellschaftlich dem Anarchismus des Bauern gänzlich entgegengesetztes
Produktionsprinzip, durch das Prinzip der Kooperation und
Assoziation, geschult ist und von der daher das Bauerntum lernen
kann, wie man wirklich genossenschaftlich produziert und solidarisch
kämpft.
Aus der Vereinzelung und Absonderung des Bauern, die ihm
durch seine Produktionsweise unter bürgerlichem System auferlegt ist,
entspringt vor allein jene im Krieg verhängnisvollste Art des bäuerlichen
Anarchismus, die berüchtigte «Lokalborniertheit» der Bauern,
mit der sie so leicht «in einzelnen Landsmannschaften abgesondert für
sich operieren». Denn diese anarchische Zersplitterung in regionale
Gruppen ist das Krebsübel aller Bauernkriege; die eine Gruppe widerstrebt
der andern, sodass selbst unwillentlich und unwissentlich die
eine die andere schliesslich verrät. Eine solche regionale «Lokalborniertheit»
war bereits die eigentliche Ursache des verhängnisvollen
Sonderfriedens der Berner Bauern auf dem Murifeld, der Leuenberger
sogar zur Abschwörung des allgemeinen Bauernbundes und damit zum
objektiven Verrat an seinen Luzerner, Solothurner und Basler Bundesgenossen
verleitete. Und eben noch sahen wir, wie dieselbe, noch
enger regionale «Lokalborniertheit» —nämlich die jämmerliche Angst
um die Verderbnis der eigenen Häuser, Wiesen und Aecker im umliegenden
Kriegsgebiet —die Lenzburger Kapitulanten-Gesandtschaft
des Pfaffen Hemmann dazu führte, ihrerseits den Leuenberger als Obmann
und Feldherrn des Gesamtbundes zu verraten und damit den
Zusammenbruch der Bauernsache im ganzen schweizerischen Bauernkrieg
einzuleiten. Es ist dies im Wesentlichen genau dasselbe, wie
einst im englischen Bauernkrieg 1381 die Essexer Bauern den Oberführer
Wat Taylor und seine Konter Bauern verrieten, indem sie ihren
eigenen «Vertrag» mit dem König machten; oder wie im deutschen
Bauernkrieg 1525 die «Seebauern» um den Bodensee sogar ihre eigenen
Bundesgenossen, die Hegauer, mit den Waffen angriffen, weil auch sie
mit den Fürsten ihren eigenen «Vertrag» schlossen, kraft dessen sie
bis zu dieser Schmach übertölpelt werden konnten...
Soviel über «die zeitliche Gebundenheit aller Bauernaktionen»,
über «das Wechselvolle und die Grenzen der bäurischen Kampfbewegung»,
kurz, über die spezifisch bäuerlichen, natürlich und gesellschaftlich
bedingten Ursachen des nun allseitig in Gang gekommenen
Zusammenbruchs der Bauernsache auch im grossen schweizerischen
Bauernkrieg 1653.
Aber die Herren von 1653 zogen keinen theoretischen, sondern
einen eminent praktischen Schluss aus ihrer Befürchtung, «dass die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 548 - arpa Themen Projekte
und dann mit verstärkter Macht einen neuen Krieg anfangen
wollten». Den Herren war daran gelegen, dem Schluss der bäuerlichen
Ernte, dessen blosse Vorstellung für sie solche Angstträume gebar, mit
einer Ernte des Todes zuvorzukommen, die gründlich mit der Gefahr
aufräumen sollte, dass die Bauern «dann mit verstärkter Macht einen
neuen Krieg anfangen» könnten!
Zunächst sollte die Todesernte unter den Bauern noch auf militärischem
Wege, ja gleichzeitig auch auf dem mit diesem eng verschlungenen
diplomatischen Wege eingebracht werden — bis zu dem
Augenblick, wo man, als Frucht der diplomatisch -militärischen
Abwürgung der Bauern, die Kriegsgerichte einsetzen und dieses Geschäft
nach allen Regeln der Henkerkunst besorgen lassen konnte. So
musste unter Aufgebot aller Kräfte auf allen Geleisen zugleich gefahren
werden, wenn man dem frühstmöglichen Abschluss der bäuerlichen
Ernte mit allem zuvorkommen wollte. Wie auf Verabredung —
und es ist klar, dass eine solche vorgelegen haben muss — schlugen
daher die Herren sowohl in Bern wie in Luzern genau gleichzeitig,
nämlich an demselben 3. Juni los, an dem die gewaltsamen, provokatorischen
Erkundungen Rudolf Werdmüllers der vorhergehenden Tage
endlich den entscheidenden Angriff der Bauern gegen das Mellinger Lager
auslösten. Und diese militärische Promptheit war einerseits bereits
die Frucht der diplomatischen Anstrengungen, anderseits selbst wieder
der stärkste Antrieb für die Durchpeitschung derselben bis an deren
Ziel: bis zur endgültigen Fesselung des Schweizer Volkes an die Galeere
des aristokratischen Absolutismus...
Wir haben bereits gesehen, mit welch zynischer Absichtlichkeit
die Berner Herren nicht nur vor und während des Abschlusses des
Murifelder Friedens, vielmehr besonders fieberhaft und mit provozierender
Offenheit auch nach dem Abschluss desselben ihre Kriegsrüstungen
auf die Höhe trieben, als wäre überhaupt kein Friede geschlossen
worden. Aehnlich zynisch verfuhren die Luzerner Herren mit
den «Friedensverhandlungen» in Stans. Mit vollendeter Schamlosigkeit
frohlockt darüber Liebenau: «Der Rat von Luzern hatte von vornherein
nicht das geringste Vertrauen auf den Erfolg der neuen Verhandlungen
in Stans; deshalb benutzte er die für dieselben in Aussicht genommene
Zeit hauptsächlich zu Vorbereitungen zum Kriege, zur
Vollendung der Schanzen bei Luzern und Gisikon, zur Rekognoszierung
der feindlichen Stellungen und zur Hilfewerbung.»
Unmittelbar fortfahrend —auf derselben Linie, ohne Absatz, ohne
Atempause, mithin ganz offen unter die eben aufgeführten Kriegsvorbereitungen
eingereiht — berichtet dann Liebenau: «Grossen Wert
legte man auf ein theologisches Gutachten über die Frage, ob die Regierung
das Recht habe, Krieg zu führen»! Klar, dass ihr dies von den
am 29. Mai im Hof zu Luzern versammelten Geistlichen und Theologieprofessoren
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 549 - arpa Themen Projekte
sogut wie vom Guardian und vom Vikar der Franziskaner, Seraphim
Keisersberg und Modest Griebler; von dem uns wohlbekannten Laufhund
der Herren, Kapuzinerprediger Plazidus und andern Kapuzinern
ebenso wie natürlich von den zwei Professoren am Jesuitenkollegium,
den Patres Heinrich und Anton, geschweige vom Professor der Kasuistik
mit dem sehr passenden Namen Johann Fuchs; aber auch von
zwei willigen Pfarrherren vom Lande, denen von Kriens und Wolfenschiessen,
die zu diesem Akt in die Stadt zitiert wurden; und naturgemäss
auch von dem adligen Chorherrn Wilhelm Pfyffer. Nach allen
diesen war der Krieg der Herren gegen die Bauern — unter Verfluchung
der letzteren und ihrer Helfer in den Sündenpfahl der Hölle —
«ein Gott, dem Allmächtigen, wohlgefälliges Werk».
Ganz demselben Zweck einer im Schutz des Waffenstillstandes
durchgeführten Kriegsmassnahme, nämlich der Zersetzung der Bauernarmee
durch moralischen Terror, diente eine Proklamation des Luzerner
Rates, mit welcher dieser das Manifest der servilen Geistlichen am
gleichen Tag sekundierte: darin hetzte der Rat während des Waffenstillstandes
die zur Kapitulation neigenden Bauern offen dazu auf,
«nach Ablauf des Waffenstillstandes die Waffen nicht mehr zu ergreifen»
und versprach den Verrätern, sie «eüsserst unserem Vermögen
nach schützen und schirmen» zu wollen —ein klarer Bruch des Waffenstillstandes.
Es hat für uns keinen Sinn mehr, uns noch lange im Labyrinth
der tausend Details dieser durch und durch verlogenen «Friedensverhandlungen»
aufzuhalten. Der Krieg ist ja seitens der Herren eine von
vornherein beschlossene Sache; alles Gerede derselben, ihre «Klagakten»,
ihr Schriftwechsel, ihre Hin- und Her-Instruktionen usw. nichts
anderes als ein unausgesetzter Wirbel von Tarnungen und Täuschungen
zu dem einzigen Zweck, die Bauern zu verwirren, zu zersetzen und
solange hinzuhalten, bis soundsoviel weitere Hülfstruppen aus den
katholischen Ländern und besonders aus den ennetbirgischen Vogteien
(unter dem Kommando des Hauptmanns Krepsinger, der den Kraftspruch
von den «gefrorenen Welschen» getan, mit denen man die
Entlebucher zu Paaren treiben solle!) anmarschiert und bis irgendeine
Siegesnachricht von den Zürcher oder Berner Herren eingetroffen
sein würde.
Um nur eine kleine Kostprobe von dem fast unwahrscheinlichen
Grad der Verlogenheit dieser Herrenakten zu geben: in der Zusammenstellung
der Klagen des Luzerner Rats zuhanden des «Schiedsgerichts»
in Stans erklärten die Herren nicht nur unverfroren, sie seien
«durch oberzellte und mehrer verloffenheiten (d. h. durch die von
ihnen erzählten Ereignisse des Bauernkriegs) unverschuldet (!) by
nahend in 300000 Gulden kosten... geworfen worden», deren Ersatz
sie von den Bauern natürlich verlangten; vielmehr hatten diese schamlosesten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 550 - arpa Themen Projekte
Schweiz, die die «Freiheit des Vaterlandes» längst hundertfach an die
gutzahlenden gekrönten Häupter des Auslands verschachert hatten,
die Stirn, dieser Heuchelei noch hinzuzufügen, dass diese Summe von
300000 Gulden «zu erhaltung... der fryheit des vatterlandes wider
frömbde Fürsten und herren besser hette können verwendet werden...»!
Nur ein paar wenige wichtige Daten seien aus dem trüben Strom
endloser Akten, wie sie Liebenau wahllos wiedergibt, herausgehoben.
Der Zusammentritt des «Schiedsgerichts», unter dem Vorsitz des
Urner Altlandammanns und Pannerherrn Carl Emanuel von Roll —
eines Statthalters Zwyers —, erfolgte in Stans am 30. Mai; es tagte bis
zum 7. Juni. Inzwischen aber wurde seit dem 3., und zwar auf Angriff
und Ueberfall seitens der Herren, frisch drauf los Krieg geführt.
Am 30. Mai «begann man nach alter Vätersitte die Verhandlungen mit
einem feierlichen Gottesdienst in der durch Nikolaus von Flüe geweihten
Friedensstätte». Wie hätte das auch anders sein können!! Bemerkenswert
aber ist, dass trotzdem bereits von dieser feierlichen Eröffnungssitzung
berichtet wird, dass «die Bauern... durch ihr halsstarriges
Benehmen die Schiedsrichter verletzten»!
Diese «Schiedsrichter» nämlich waren ihrer Herkunft und ihrer
Rolle nach keine andern als die alten «eidgenössischen Ehrenräte»
bezw. «Ehrengesandten» des Ruswiler «Rechtlichen Spruches» schlimmen
Zwyer'schen Angedenkens; nur dass jetzt ausschliesslich die vier
katholischen Bauernorte der Innerschweiz, ohne Solothurn und Freiburg,
die Vermittlungsposten besetzten. Die Erzwingung einer Anerkennung
des «gefälschten Machwerks» vom 18. März seitens der Bauern
war übrigens einer der Hauptpunkte der Instruktionen, die der Luzerner
Rat seinen Gesandten mitgegeben hatte; einer der Hauptpunkte
auch des Programms der in keiner Weise neutralen «Schiedsrichter»
selbst, die — mit Ausnahme ganz weniger, wie abermals Peter Trinklers
von Zug — die Repräsentanten der Herrenklasse der Urkantone
und also lediglich die Sekundanten der Luzerner Herrenpartei waren.
Waren doch sowohl der Vorsitzende von Roll wie dessen Schreiber
Paul Ceberg, Landschreiber von Schwyz, durch «die Kriegsräte (!)
der vier katholischen Orte... ernannt» worden, die den Luzerner Herren
geholfen hatten, eine Armee von 4000 Mann gegen die Bauern aufzustellen!
Die wichtigsten andern Punkte der Rats-Instruktionen waren natürlich:
die Auflösung des Bauernbundes, der Ersatz der Kosten und
jetzt vor allem, mit äusserster Energie erstrebt, die exemplarische Abstrafung
der «Rädelsführer»! An der Spitze der Ratsdelegation stand
der handfeste Faustkämpfer der Luzerner Herren Schultheiss Ulrich
Dulliker selbst. Zu ihren Hauptaufgaben gehörte auch, gegenüber den
Unabhängigkeitsansprüchen besonders der Entlebucher unausgesetzt
«den 250-jährigen Besitz der Landeshoheit» herauszustreichen und der
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 551 - arpa Themen Projekte
ihrer Herrschaft glaubhaft zu machen. Die grossartige und
durchschlagende Anfechtung dieser Herrschaft, die Hans Emmenegger
und der Schulmeister Müller an ihrem grossen Tag zu Schüpfheim am
18. Mai so überlegen demselben Dulliker gegenüber durchgeführt hatten,
muss also dem Luzerner Rat in die Glieder gefahren sein. Es darf
darum unterstrichen werden, dass es ihm auch in Stans nicht gelang,
auch nur ein einziges Dokument über die in Schüpfheim widerlegten
Dokumente hinaus zu produzieren!
Was nun die Haltung der Bauern in Stans gegenüber diesem*konzentrierten
Ansturm der Herrendiplomatie betrifft, so kann man sie
in ihrem ersten Teil nur als sehr konsequent und tapfer bezeichnen, so
ungern, spärlich und versteckt unser Herrenchronist darüber berichten
mag und so gründlich die Spuren davon auch tatsächlich bereits in den
Quellen (durch die Herren von 1653 selbst!) getilgt worden sein mögen.
«Die Bauern nahmen inzwischen», sagt Liebenau, «von den aufgelegten
Originalurkunden Einsicht, beharrten aber darauf, die Obrigkeit
habe ihre Hoheitsrechte durch Werbung fremder Truppen verwirkt;
vom Bund wollten sie nicht lassen» — und dies zwar eben
deshalb, weil der Bund ihr Weg und ihre Hoffnung war, zur Eigenstaatlichkeit
zu gelangen.
Erinnern wir uns aber daran, dass die Entlebucher Führer über
die hier von Liebenau referierte Form der Begründung ihres Unabhängigkeitsstrebens
bereits am 18. Mai in Schüpfheim weit hinaus
waren. Dort argumentierte Hans Emmenegger dem Dulliker gegenüber
echt revolutionär: «Die Regierung hat durch die strengen Strafen der
Landvögte ihre Herrschaft verwirkt!» Also: wir wollen von eurem
ganzen Ausbeutungs-Regime nichts mehr wissen, selbst wenn ihr uns
beweisen könntet, dass die Behauptung über den von euch verlangten
Einfall fremder Truppen unrichtig sei — «auch dann nicht»!
Echt Emmenegger'schen Geist — Geist des 18. Mai in Schüpfheim
— atmen auch die «neuen Begehren» der Bauern in Stans, über die
Liebenau mit sichtlich bagatellisierender, ja abwürgender Tendenz
berichtet (dass sie z. B. «mit dem vorliegenden Streite in keinem Zusammenhang
stunden»!). Aber allein ihre Nennung verrät schon ihren
Geist: «Am 31. Mai verlangten die Entlebucher, die Luzerner sollen
ihnen den Verräter nennen, der die geheimen Beratungen der Entlebucher
geoffenbart habe»! (Ob das nicht der Kaspar Steiner war, der
ja seltsamerweise mit im entlebuchischen «Geheimen Landrat» sass?)
Aber weiter: «Sie verlangten das Recht des Blutbannes» — d. h. ein
ganz spezifisch landesherrliches Recht der Souveränität! —, «das Besetzungsrecht
der Schweizergarde in Rom» — das hätte eine internationale
Sonderstellung der Entlebucher begründet! —, und schliesslich
«Restitution der Kosten und der ungerechterweise bezogenen
Bussengelder»!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 552 - arpa Themen Projekte
In alledem erkennen wir mühelos den echten Revolutionär Hans
Emmenegger, wie er sich schliesslich herausgebildet hat — und dies
trotz den Bemühungen der Geschichtschreibung, sein Bild zuletzt bis
zur Unkenntlichkeit zu zersetzen! Wir haben aber nicht das geringste
Anzeichen dafür, dass Pannermeister Hans Emmenegger zwischen
Schüpfheim und Stans seine revolutionäre Erkenntnis und seinen revolutionären
Mut eingebüsst hätte. Ganz im Gegenteil: noch in Stans
ist Emmenegger der wirkliche Führer der revolutionären Bauernpartei
— und ist hier ganz auf seiner Höhe vom 18. Mai! Und dies offenbar
eben deshalb weil er sich entschlossen hatte, seine ganze Kraft
in Stans einzusetzen, um auf dem weit grösseren Verhandlungsfeld
mit seiner neuen Verhandlungskunst womöglich einen ebensolchen Sieg
zu erfochten wie am 18. Mai in Schüpfheim. Eben deshalb aber fehlt
Hans Emmenegger in der entscheidenden Zeit im Lager der Bauernarmee!
Nicht nur in demjenigen vor Luzern, wo an seiner Stelle der
subalterne Landessiegler Niklaus Binder kommandiert; sondern vor
allem fehlt Emmenegger aus diesem Grunde im Feldlager von Othmarsingen,
an der Seite oder an der Stelle Leuenbergers, fehlt im Gefecht
bei Wohlenschwil und — vielleicht entscheidend — in den Verhandlungen
mit Waser und Werdmüller!
Und doch atmen wir auf, Hans Emmenegger nocheinmal in seiner
wahren Rolle zu entdecken, wenn auch nur in Stans, wo nicht die
grossen Entscheidungen fallen. Hier aber verkörpert er — wie wir
trotz dem jämmerlichen Zustand der Quellen noch zweifelsfrei fest-'
stellen können — noch mitten im grossen Zusammenbruch den stolzesten
und entwickeltsten Geist der Revolution, den wir im ganzen
Bauernkrieg gefunden haben. Er ist hier noch bis zur letzten Stunde
der Führer einer revolutionären Mehrheit — bis die grossen Entscheidungen
von anderswo ihm sein zäh gehaltenes und zäh entwickeltes
Instrument aus der Hand schlagen. Wir müssen Emmenegger in
den Berichten über die Stanser Verhandlungen überall dort als ihren
Sprecher einsetzen, wo die Herrengeschichtschreibung nur allgemein
von «den Bauern» spricht, dass sie «halsstarrig» gewesen seien, dass
sie auf ihren früheren Forderungen «beharrten», dass sie solche Forderungen
wie die eben erwähnten stellten etc.
So auch, wenn nun Liebenau weiter berichtet: «Da wurde der Vermittlungsvorschlag
eingebracht: der Bund soll nicht gegen die Regierungen,
sondern nur gegen ,fremde Völker' Kraft haben. Aber auch
diesen Vorschlag wollten die Bauern nicht annehmen; sie erklärten:
der Bund soll ihnen gegen Bern, Basel und Solothurn dienen» — das
heisst also: gegen deren Regierungen; und da diese Regierungen mit
der Regierung von Luzern verbündet waren, natürlich auch gegen die
Luzerner Regierung! Der einfältige Ablenkungsversuch mit den «fremden
Truppen», als ob diese nur ausländische Truppen sein könnten,
gegen die der Bauernbund gar zur Leibgarde des heimischen Herrenregiments
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 553 - arpa Themen Projekte
heisst bei Emmeneggers Revolutionspartei, in keiner Weise verfangen;
zu gut wussten sie längst, dass für sie «fremde Truppen» einfach die
Bürgerkriegstruppen der heimischen Herren partei waren, ob diese nun
heimischer oder ausländischer Herkunft waren und ob Sie nun die
eine oder die andere Kantonsfarbe trugen.
Aber es gab in Stans noch eine andere Bauernpartei und deren
Führer trug den Unglücksnamen Kaspar Steiner! Es ist ja gar nicht
anders zu erwarten, als dass ein Mann, der während der Dauer der
ganzen Bewegung so oft und so heftig von einer Partei zur andern
geschwankt ist, zum Schluss, als die Revolution nun unverkennbar
lebensgefährlich geworden war, nocheinmal auf deren Baisse spekulierte
und sich an die Spitze der Kapitulanten schwang. Er mochte
angesichts der immer leidenschaftlicher erhobenen Forderung der
Herren nach den Köpfen der «Rädelsführer» hoffen, durch einen ganz
grossen Verrat sich um die Herren endgültig verdient zu machen und
so nicht nur den eigenen Kopf zu retten, sondern sich gar noch einen
Lohn zu verdienen. Aber die Zeit, da die Herren einen Kaspar Steiner
brauchten, musste mit dem Augenblick ablaufen, in dem die Nachricht
vom «Sieg» der Zürcher Herrenarmee über die Bundesarmee der Bauern
in Luzern und Stans einlief; das war am 4. juni. Die Frist konnte
sich allerhöchstens noch bis zu dem Augenblick erstrecken, in dem
auch Schybis Truppen auf Luzerner Boden wenn auch nicht besiegt,
so doch zerstreut und damit ausgeschaltet waren; das war am 5. juni.
Ueberhaupt müssen wir von diesem Zeitpunkt an den militärischen
Faktor als entscheidend für Fortgang und Abschluss der Stanser
Verhandlungen einsetzen. Und dies zwar in dem allgemeinen Sinne,
wie Peter ihn formuliert: «dass das gleichzeitige Vorrücken einer starken,
hauptsächlich zürcherischen und einer ebenso starken bernischen
Armee auch ohne deren direktes Vorgehen gegen die luzernischen Aufständischen
doch den Abschluss des Stanser Friedens beschleunigte».
Eine charakteristisch luzernische Spezialität aber betrifft es, wenn in
diesem militärischen Zusammenhang weiter berichtetet wird: «Sodann
gaben die heranrückenden Zürcher und Berner bei vielen Luzernern
Anlass zu Befürchtungen für die ,Sicherheit der katholischen Religion',
weswegen ein schleuniger Abschluss der Vermittlungsverhandlungen
umso wünschenswerter erscheinen musste.» Dieses Motiv wurde namentlich
— und das ist äusserst bezeichnend für die reaktionäre Rolle
der Herrenpartei in der Kirche — vom päpstlichen Nuntius in Luzern
zu entscheidendem Druck auf die Bauern ausgenutzt, um, wie er vorgab,
«den Zürchern jede Gelegenheit zu nehmen, in Luzern einzudringen
und aus einer Burg der katholischen Religion eine Prädikantenschule
zu machen»!
So sollte also durch Religionshetze die gefährliche soziale Spannung
wieder einmal in das allbewährte Geleise des Religionshasses abgelenkt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 554 - arpa Themen Projekte
Der Nuntius betrieb diese Hetze bereits als eines der Hauptmittel, um
die Stanser Verhandlungen überhaupt gegen die revolutionäre Mehrheit
der Bauern zustandezubringen. Hören wir ihn selber, wie er darüber
bereits am 29. Mai, also noch vor deren Eröffnung, nach Rom
berichtete: «Inzwischen suchen die Zürcher, die stets gewohnt sind,
auf eigenen Nutzen auszugehen, auf jede Weise den Frieden in den
Kantonen Bern und Basel herbeizuführen, und zu gleicher Zeit schüren
sie beständig die Empörungen der Luzerner Untertanen; denn wenn
der Brand nur auf dieser Seite weiter tobt, erhoffen sie davon irgend
einen wesentlichen Vorteil für ihre falsche Religion (!). Da ich diese
Absicht durchschaut habe, habe ich alles Mögliche zur Herbeiführung
des Friedens getan; gerade heute Abend ist mir von einem Kapuziner,
den ich zu den Bauern geschickt hatte, berichtet worden, diese hätten
sich bereit erklärt, ihre Differenzen dem schiedsrichterlichen Urteile
der Kantone Unterwalden, Schwyz, Zug und Uri zu unterbreiten; in
jedem dieser Kantone sollen zwei Deputierte von den Aufständischen
und zwei von der Obrigkeit von Luzern gewählt werden; ohne Zweifel
wird dies morgen geschehen, sodass man sofort in Stans zusammentreten
kann, wohin auch ich einige Ordens geistliche senden werde, um
die Schwierigkeiten überwinden zu helfen...»
Aber noch am 5. Juni, am Tag des in Luzern als äusserst bedrohlich
empfundenen Gefechts von Gisikon, hielt es der Nuntius für nötig,
folgendes nach Rom zu berichten: «Ich fürchte daher, wenn die Dinge
sich zuspitzen, werde niemand mehr den (Luzerner) Rat davon abhalten
können, sich den Zürchern in die Arme zu werfen, die bereits
mit einem starken und gut disziplinierten Heer im Feld stehen und
angefangen haben, die Untertanen von Bern zum Gehorsam zurückzuführen;
sie verhalten sich so klug und vorsichtig, dass sie binnen kurzem
Schiedsrichter in dieser Angelegenheit sein werden; man erkennt
aus ihrem Vorgehen klar, dass sie ganz besonders darnach trachten,
in die Stadt Luzern zu gelangen, um bei dieser Gelegenheit der katholischen
Religion erheblichen Schaden zuzufügen (!)... Da indessen der
Kongress in Stans immer noch versammelt ist, habe ich die Hoffnung
immer noch nicht ganz aufgegeben (!), dass doch Frieden geschlossen
werde, den man auf jede Weise erstrebt.» Und es ist höchst bezeichnend
für die ausserordentliche Stärke des Widerstandes, den die Bauern,
das heisst vor allem die Entlebucher Emmeneggers, allen derartigen
Versuchen, sie zu korrumpieren, bis zu diesem Augenblick entgegensetzten,
dass der Nuntius noch in diesem Schreiben vom 5. über das Verhalten
der Bauern feststellen muss: «aber die Bauern zeigen sich sehr
hartnäckig; sie weigern sich, die ihnen vorteilhaften Anerbietungen
anzunehmen»!
Es ist also dem religiösen Druck der höchsten Kirchenautorität
für sich allein bis zum 5. Juni überhaupt nicht gelungen, die «halsstarrige»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 555 - arpa Themen Projekte
zu verwandeln — dies vermochte er nur in Verbindung mit dem
vom 5. Juni an maximal sich auswirkenden militärischen Druck. Für
dessen wirksamen Einsatz in Luzern aber war entscheidend die Rückkehr
des Urner Obersten und österreichischen Generalfeldmarschalllieutenants
Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach von seiner Reise an
den Kaiserhof in Augsburg.
Schon am 2. Juni, 5 Uhr morgens, wurde in Luzern die Kriegsbereitschaft
für den Mittag desselben Tages angeordnet — mitten in
dem, auch nach früherer Abmachung erst am 3. Juni abends ablaufenden
Waffenstillstand, der überdies inzwischen von den «Friedensverhandlungen»
in Stans abgelöst worden war und also normalerweise
automatisch hätte verlängert werden sollen. Dieser qualifizierte militärische
Bruch des Waffenstillstands ist vermutlich das erste Zeichen von
Zwyers erfolgter Rückkehr nach Luzern. «Am Tage des Gefechts bei
Wohlenschwil (3. Juni)» nun, so erzählt Peter, «gab Zwyer Befehl, dass
die Bauern in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni gleichzeitig an vier
Orten angegriffen werden sollten: bei Horw, bei Kriens, am obern
Gütsch und bei der Gisikoner Brücke». Die Absicht war dabei, wie
Vock meldet, eine echt Zwyer'sche: «den schiedsrichterlichen Spruch
womöglich durch einen glücklichen Entscheid vermittelst der Waffen
unnötig zu machen»! Allein, wie Peter weiterberichten muss: «Infolge
der Weigerung der vierörtischen Soldaten, zum Angriff überzugehen,
konnte Zwyers Plan nur teilweise ausgeführt werden», nämlich bei der
Gisikoner Brücke, wie wir gleich sehen werden. «Denn, wenn auch
viertausend Fussoldaten wirklich unter den Waffen stehen», so klagt
darüber der Nuntius in seinem Bericht vom 5. Juni, «so weigern sich
doch viele, zu kämpfen. Als daher Oberst Peregrinus Zwyer, ihr General,
diese Nacht» (es ist aber die Nacht vom 3,/4. gemeint) «von mehreren
Seiten über die Quartiere des Feindes herfallen wollte, erklärten
fast alle, sie seien bloss zur Verteidigung der Stadt hierher gekommen.
Wenn die Hülfstruppen, die man von Lugano und andern Orten erwartet»
(der Nuntius schreibt am 4.: «Man wartet mit Sehnsucht auf
die Verstärkungen aus Lugano, Bellinzona, Locarno etc.»), 'nicht mutiger
sein sollten, so könnten die Angelegenheiten der hiesigen Obrigkeit
eine sehr gefährliche Wendung nehmen» («si potriano ridurre
in stato molto pericoloso gl'interessi di questa Superiorità»).
Dieser letzte Passus im Schreiben des Nuntius zeigt uns klar, dass
noch jetzt eine grosse Chance für die Sache der Luzerner Bauern bestand.
Diese Chance erscheint umso bedeutender, als jetzt auch die
Luzerner Stadtbürger sich wieder regten: sie sabotierten richtiggehend
den grossen Ueberfallsplan Zwyers, indem sie den Ueberfall, als er eben
ins Werk gesetzt werden sollte, durch offensichtlich verabredete Signalschüsse
den die Stadt belagernden Bauern draussen verkündeten! Vock
entnimmt der zeitgenössischen Chronik des nachmaligen Luzerner
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 556 - arpa Themen Projekte
«Als sich das Volk (Kriegsvolk) allbereit auf dem Fisch- und Kornmarkt
in der Nacht versambt (versammelt) und man gleich aufbrechen
sollte, da wurden durch zwei Schuss von zwei meineidigen Burgern
die Bauern des Ueberfalls gewarnt. Der einte Loosschuss geschah
bei der Apothek auf dem Fischmarkt, der andere aber bei dem alten
Spital in der Kleinstadt. Da nun die Bauern diese Loosschüsse wahrgenommen,
haben sie gleich auf dem Gütsch zwei andere gethan, dadurch
die Ihrigen, so in dem Krienserboden lagen, zu warnen. Es ist
nicht zu zweifeln, dass die Bauern alle Anschläge der Stadt von den
rebellischen Burgern vernommen haben.» Ja, ebenso zweifellos waren
sie es auch, die rebellischen Bürger, von denen die Zersetzung der
innerschweizerischen Besatzung der Stadt und damit die fast allgemeine
Meuterei derselben ausging.
So wären also in diesem Augenblick rebellische Bürger und meuternde
Bauern innerhalb der belagerten Stadt selbst für die Bauernsache
einzusetzen gewesen! Diese ungeheure Chance in letzter Stunde
— ihre letzte Chance — haben die Bauern vor der Stadt nicht zu nützen
verstanden! Und dies zwar ganz offensichtlich deshalb, weil ihnen
ein wirklich fähiger militärischer Führer fehlte und weil auch die relativ
fähigsten Bauernführer gar nicht im Lager vor Luzern anwesend
waren, wo nur der schwache Niklaus Binder, «ein ganz unbedeutender
und mutloser Mann», wie ihn allerdings Liebenau bezeichnet, und der
schon bei der Belagerung im März zweifelhaft gewordene Glanzmann
kommandiert zu haben scheinen. Schybi war soeben mit 2000 der Besten
nach Mellingen abgezogen (und übrigens das Ersatzaufgebot aus
den Aemtern noch gar nicht vor Luzern eingetroffen) — und der Pannermeister
Hans Emmenegger setzte seine ganze Kraft auf die grosse
Illusion eines Verhandlungs-Sieges in Stans!
Jedoch, wie es scheint, abwechslungsweise auch auf einen solchen
im Lager vor Luzern, in direkten Verhandlungen mit den Luzerner
Herren! Wenigstens behauptet das Liebenau, der folgenden Beschluss
«von dem Pannerherrn Johann Emmenegger und den Entlebuchern
auf dem Knubel ausgegangen» sein lässt: «Sie anerboten am 4. Juni
direkte Unterhandlungen und wünschten, dass die Stadt zu diesem
Zwecke 6 Kleinräte, 6 Grossräte und 6 Bürger abordne. Der Rat berief
deshalb seine Gesandten aus Stans zurück.» Vom Inhalt des Angebots
aber erfahren wir nichts! Er muss echt Emmeneggerschen «halsstarrigen»
Geistes gewesen sein — denn der Rat wies das Angebot energisch
zurück! Keinesfalls kann es identisch gewesen sein mit einem andern,
von Liebenau ebenfalls unterm 4. referierten und sicherlich zu Unrecht
«den Entlebuchern» unterschobenen Angebot: «Noch ehe die
Kunde von dem zu Mellingen geschlossenen Frieden in Kriens eingetroffen
war, stellten deshalb die Ausschüsse der 10 Aemter (?) am
4. Brachmonat in Kriens einen neuen ,Anlassbrief' aus, wonach die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 557 - arpa Themen Projekte
des Huttwiler- und Wolhuser-Bundes ihr rechtsverbindliches Urteil abzugeben».
Einen solchen Verrat an der gesamten Bundesidee — nach
den Erfahrungen mit Leuenberger vor Bern und vor der Entscheidung
in Mellingen, und überhaupt — einem Hans Emmenegger, wenn auch
nur indirekt (über «die Entlebucher»), in die Schuhe schieben zu wollen,
verrät eine düstere Absicht des Herrengeschichtsschreibers, nichts
sonst! Vielmehr haben wir in dieser Aktion eine typische Kapitulanten-Intrige
zu erblicken, die niemand anderes als Kaspar Steiner geleitet
haben kann, der im Wettrennen mit seiner ablaufenden Zeit zu einem
durchschlagenden Mittel greifen musste, um seinem «halsstarrigen»
Antipoden Emmenegger den Boden unter den Füssen wegzuziehn und
den Herren einen entscheidenden Dienst zu leisten. Hans Emmeneggers
wirkliche Meinung über die Treue zum Bund werden wie gegen Ende
der ganzen Stanser Verhandlungen erfahren, wenn die Herren auch
ohne Kaspar Steiner dem Bunde den Todesstoss versetzen werden.
Hier stellen wir einstweilen nur fest, dass Hans Emmenegger zwar
höchst wahrscheinlich am 4. und 5. im Lager zu Kriens weilte — vermutlich
wegen des vierfach geplanten, aber teilweise missglückten
Zwyer'schen Ueberfalls hingeeilt —, dass aber auch er zur Ausnützung
der grossen Chance für die Bauern, die wir oben schilderten,
offenbar zu spät gekommen ist. Denn diese Chance bestand einzig und
allein während der Nacht vom 3. auf den 4. Juni. Dass aber Hans
Emmenegger bei dieser Gelegenheit die Bauernsache an die Luzerner
Herren — auch wenn er mit ihnen verhandelte — hätte verraten wollen,
das wagt auch der reaktionärste Herrenchronist nicht offen zu
behaupten! Im Gegenteil muss beispielsweise Vock zwar feststellen, dass
die Luzerner Regierung «wirklich zu wiederholten Malen versucht hatte,
Unterhandlungen mit den Bauern, die vor der Stadt lagen, anzubahnen
und einzuleiten»; ebenso aber muss Vock unterstreichen, dass «diese
Versuche stets an dem trotzigen Uebermute der Häuptlinge des Aufruhrs
scheiterten»!
Zu diesem Zeitpunkt aber begann bereits die Panik über die Kapitulation
der Bauernarmee vor Mellingen das Bauernlager vor Luzern
zu zersetzen und die Verhandlungsposition der Führer hier, wie natürlich
auch in Stans, von Grund auf zu erschüttern. Diese Panik drang
ja just am 5. Juni in der Person Schybis und seiner 2000 Rückkehrer
von Othmarsingen, Wohlenschwil und Mellingen in tausendfach verkörperter
Potenz in die Reihen der Bauern im ganzen Luzernerland
herein. Die grosse Bundesfront war also — das war der eigentliche Inhalt
der Hiobskunde —zusammengebrochen, und die Luzerner Bauern
sahen sich wieder ganz allein auf sich gestellt! Die Erzählungen der
Kämpfer von Wohlenschwil über die mächtige Zürcher Armee mit
ihrer erstklassigen Artillerie verbanden sich mit den wildesten Gerüchten
über den Vormarsch der ebenso mächtigen Berner Armee, ja über
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 558 - arpa Themen Projekte
das steigerte die Panik zur allgemeinen Wut und Verzweiflung.
Noch jetzt hätte ein grosser militärischer Führer der Luzerner
Bauern, der den Mut, die Kraft und die überlegene Begabung besessen
hätte, die Wut und die Verzweiflung des Volkes mit den hier zahlenmässig
in Uebermacht vorhandenen bewaffneten Kräften in eine entsprechende
militärische Tat umzumünzen, — noch jetzt hätte ein solcher
Führer, wenn auch kaum einen Tag lang oder für ein paar Stunden,
die geschichtliche Chance gehabt, einen vielleicht nicht nur für
Luzern entscheidenden Sieg an die Fahne der Bauern zu heften! Denn
auch die Berner Bauern standen voll Wut und Verzweiflung noch in
Waffen und waren unter dem jetzt kampfentschlossenen und auch
schon etwas kampferfahreneren Leuenberger bereit, nochmals Alles an
ihre Sache zu wagen. Aber wie er, so war auch Hans Emmenegger der
überlegene Feldherr nicht, der vermocht hätte, alle Kräfte auch nur
im Umfang des Luzernbiets zur entscheidenden militärischen Tat zusammenzufassen.
Auch Schybi war dieser Feldherr erst recht nicht, trotzdem er
allein von allen Luzerner Bauernführern es war, der die letzte allgemeine
Volkswut und Verzweiflung in einer tapferen militärischen Tat
zum Ausdruck brachte. Dort wo es Zwyer mit seinem Ueberfallsplan
allein gelungen war, der Herrenarmee einen wichtigen Vorteil zu
sichern, am Reuss-Uebergang bei Gisikon, dem ersten Ort auf Luzernerboden,
den Schybi auf seinem Heimmarsch erreichte, dort griff er sofort
mit seinen 2000 Luzernern und etlichen hundert Freiämtler Bauern
ein, um die von Zwyer tags zuvor eroberte Position zurückzuerobern.
Zwyers Stosstrupp, dem der Urner Gewaltige seine vertrautesten Urner
Haudegen aus den vornehmen Familien einverleibt hatte, unter dem
Befehl des forschen Willisauer Landvogts Jost Pfyffer, einem soldatischen
Veteran, den wir von Beginn des ganzen Handels an als politisch
zielbewussten Reaktionär reinsten Wassers kennen lernten, — dieser
Stosstrupp hatte in der Morgenfrühe des 4. die dort als Brückenwache
liegenden Bauern aus dem Münsteramt in dichtem Nebel vollkommen
überrumpelt, war sofort über die Brücke vorgestossen und hatte sich
der dort von den Bauern erst kürzlich errichteten starken Schanzen
bemächtigt.
«Am folgenden Tage, den 5. Juni», so berichtet nun Vock den Fortgang,
«entstand ein weit heftigerer Kampf. Der Probst von Luzern und
neugewählte Bischof von Lausanne, Jost Knab, begab sich mit einigen
Herren von Luzern und Schwyz zur Brücke von Gisilikon, um dort,
vermutlich aus Neugierde, die den Bauern weggenommene Schanze zu
sehen' (zu «inspizieren», sagt Liebenau). «Als Sicherheitswache wurden
ihnen einige Soldaten mitgegeben und 12 Männer mit Aexten, beauftragt,
einige Eichen umzubauen. Jene Sicherheitswache und die
Vorposten der Bauern kamen um 2 Uhr Nachmittags aneinander und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 559 - arpa Themen Projekte
machte sich das gesamte Heer der Bauern auf, trieb unter grässlichem
Gebrüll die vorgerückten Luzerner und Eidgenössischen Truppen zurück,
stürmte die tags zuvor ihnen entrissene Schanze und jagte den
Feind heraus». Aus Liebenaus Bericht ergänzen wir hier: «Von Schybi
geführt, dem eine Kugel den Hut durchlöcherte, hätten die Bauern
bald die Stätte umzingelt, wäre nicht schnell zum Rückzug geblasen
worden.» Vock erzählt dann weiter: «Bei der Brücke wurden die Soldaten
handgemein (siehe unsere Abb. 27). Die Stadttruppen beschossen
die Bauern aus grobem Geschütz, aber zu hoch und mit geringem Erfolg.
Die Bauern erwiderten mit zwei Feldstücken, die sie aus dem
Schloss Altishofen genommen hatten, so stark, dass das eine derselben
zersprang. Sie fochten mit einer selbst von ihren Gegnern bewunderten
Unerschrockenheit, liefen mitten ins Feuer und bewiesen bis zum Ende
des Kampfes eine Kaltblütigkeit, die nur durch tollsinnige Raserei erklärt
werden zu können schien.»
Es blieb dem über den Erfolg der Bauern wütenden Zwyer und
seinem modernen Höfling Theodor von Liebenau vorbehalten, die Tapferkeit
der Bauern dem — Alkohol zuzuschieben; Zwyer, indem er in
einem wahren Fälscherkunststück von Bericht über dieses Gefecht behauptet,
«dass 2000 Bauern sich mehrtheils voll und herzhaft gesoffen»,
Liebenau, indem er frech daraus ableitet: «Die stark nach Wein schmeckenden
Bauern verfolgten die Luzerner bis zu den Schanzgräben, wo
sie mit Spiessen zurückgetrieben wurden»! So wird «Geschichte» gemacht!
Freilich, auch der zeitgenössische Aurelian Zurgilgen lässt in
seine Chronik die gemeine Verdächtigung einfliessen, «dass die Bauern
im Treffen vom 5. Juni betrunken gewesen seien». Aber das wird dieser
totalitäre Aristokrat, späterer Schultheiss von Luzern, beflissen dem
Zwyer nachgeschwatzt haben. Und vor allem: dieser Ehrabschneidung
widerspricht ausdrücklich ein anderer Zeitgenosse, der Kaplan Wagenmann
aus Willisau, der dem Ratsherrn Cysat die lateinische Chronik
vom Bauernkrieg machen half, auf die der gute, alte Vock seinen Bericht,
den wir hier wiedergeben, anständigerweise aufs genaueste anschliesst.
Wir beendigen diesen daher mit Vock wie folgt: «Vor allem zeichneten
sich die Willisauer durch ihre Tapferkeit aus; diese wäre, wie
Wagenmann» (doch auch ein waschechter Herrenchronist, wie man
sieht!) «sagt, eines edleren Zweckes würdig und im Kampfe für Vaterland
und Obrigkeit ruhmvoll gewesen (!). Das Treffen dauerte vier
volle Stunden und hätte wahrscheinlich noch länger angehalten, wäre
nicht einerseits bei den Bauern Mangel an Pulver und Blei eingetreten
und andererseits das Eidgenössische Heer durch ein plötzliches Ereignis
in Schrecken und Besorgnis geraten: Vier, in einem Speicher nächst
der Brücke von Gislikon aufbewahrte Pulverfässer wurden vom Feuer
ergriffen, fünf Soldaten des Eidgenössischen Heeres durch diese Explosion
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 560 - arpa Themen Projekte
Jost Pfyffer. «Dieses Ereignis verursachte einige Verwirrung
und Unordnung unter den Truppen der Stadt; man vermutete Verrat
im eigenen Heere (!) weil zwei Tage früher auch in der Stadt von
einigen Verrätern eine ähnliche Explosion beabsichtigt und angelegt,
aber glücklicherweise noch vor dem Ausbruche entdeckt und vereitelt
worden war»! Ein Beweisstück mehr für die Zusammenarbeit der Luzerner
Stadtbürger mit den Bauern (das Vock ebenfalls der Cysat-Wagenmann'schen
Chronik entnimmt), eine Kollaboration, die, zusammen
mit der Meuterei der innerschweizerischen Herrentruppen,
jene grosse Chance für die Bauern schuf, von der oben die Rede war
und die die Bauern nicht zu nutzen verstanden.
Genau so aber haben die Bauern unter Schybi auch ihren eben
erfochtenen, regelrechten militärischen Sieg bei Gisikon über die Herrentruppen
nicht im geringsten auszuwerten vermocht! «Am Abend
führten die Bauern», wie Liebenau erzählt, «ihre Toten und Verwundeten,
deren mehr denn hundert gewesen sein sollen, auf drei 'Wagen
fort. Zweihundertundfünfzig Berner hatten teilnahmslos dem Kampfe
zugesehen und kehrten darauf von Gisikon heim, weil man sie zurückberufen
habe» (ein klassisches Beispiel für die verhängnisvolle «Lokalborniertheit»
der Bauern!). «Auf den Ruf des Obersten von Willisau:
Wer Frieden haben will, folge mir nach! verliessen auch die Willisauer,
nach dem Zeugnis des Fähnrichs Anton Farnbühler, den Kampfplatz.»
So liefen also die Hauptkämpfer aus dem einzigen für die Bauern
siegreich verlaufenen Gefecht direkt auseinander und nachhause! Für
die Luzerner Herren, die eben noch durch Meuterei und Bürgerverrat
aufs tiefste erschreckt und ,jetzt durch die Nachricht von der Kriegsfurie
der Bauern bei Gisikon in eine wahre Panik gejagt worden waren
— welch ein unverhoffter Glücksfall! Noch am Morgen des 6. Juni
zitterte der Luzerner Rat derart vor den Bauern, dass er eine Eilbotschaft
an den Zürcher Rat abfertigte und diesen unter Hinweis auf
«das, wass sich an der Gyslicker Bruckh begeben», flehentlich beschwor,
General Werdmüller möge doch sofort «anerbothner insassen
auf allen fahl mit würcklicher Hilff assistieren»!
Aber General Werdmüller hatte gar keine Eile, «aus der Burg der
katholischen Religion eine Prädikantenschule zu machen». Als er gehört
hatte, dass der Grossteil der Freiämtler Bauern mit Schybi nach
Gisikon gezogen und die Freien Aemter also von aller Wehrkraft entblösst
waren, schickte er, wie Peter berichtet, gerade während des
Gefechts bei Gisikon, «am Nachmittag des 5. Juni 200 Reiter in die
Freien Aemter» und «liess den Ungehorsamen ,Raub und Brand' androhen,
falls sie weiter in ihrer Widersetzlichkeit verharren würden...
Die Drohung rief bei den Freiämtern furchtbaren Schrecken hervor».
Grund genug auch für die Freiämtler Bauern in Gisikon, Hals über
Kopf nachhause zu eilen, um das eigene Dach und die eigenen Leute
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 561 - arpa Themen Projekte
wie selbst der Zürcher Herrenchronist zugeben muss, tatsächlich «neuerdings
zu bittern Klagen der Freiämter Veranlassung», sodass der Zürcher
Rat Werdmüller am 7. Juni zur Rede stellen musste, ob «die Zürcher
Truppen wiederum geplündert hätten», was Werdmüller aber
natürlich abstritt.
Bei dieser Gelegenheit war übrigens der «milde» Zürcher Rat die
erste Regierung, die mit der «Auslieferung der Rädelsführer» Ernst
machte! Schon am 6. Juni mussten von den Reitern zusammengetriebene
Freiämtler «Ausschüsse» dem General Werdmüller feierlich geloben,
«sich und die Rädelsführer auf erstes Verlangen sofort zu stellen».
Dieser «gutbürgerlich» getarnte Fuchs hat mithin das «Versehen»
in dem von ihm und Waser gemachten «Mellinger Frieden», um dessetwillen
ihn der Berner Rat sofort brüsk zur Rede stellte, sehr schnell
wieder gut gemacht...
Vor allem, aber hat der Zürcher Vorort damit allen andern Regierungen
das praktische Beispiel dafür gegeben, was nun als Hauptthema
aller weiteren Verhandlungen angesehen werden sollte; wenn
auch der wirkliche Motor, der sie zu einem wahren Wettlauf der Rache
aufpeitschte, die Berner Regierung war. Diese gab am gleichen 6. Juni
dem bereits unter Sengen und Brennen, Plündern und Rauben im Oberaargau
einmarschierten General von Erlach die ausdrückliche Instruktion:
«... Unssersteils findend wir, mit den sich rebellisch erzeigten
nit vii witers wirt zu komplimentieren, sondern mit aller Strengt zu
verfahren sein.» Das war nicht mehr bloss das Verlangen nach Auslieferung
und Abstrafung der «Rädelsführer» nach irgendwelchen,
wenn auch höchst zweifelhaften gerichtlichen Formen — das war die
kaltblütige Anweisung einer Regierung an ihre militärische Exekutive
zur «Abschaffung» nicht allein der «Rädelsführer», sondern aller «sich
rebellisch erzeigten» durch glatten Mord!
Peter, der seine Zürcher Regierung unentwegt als Muster der Güte
und Milde herausstreicht, muss in direktem Anschluss an diese Instruktion
immerhin zugeben: «Uebrigens war man mit der von Bern geforderten
Auslieferung und einer exemplarischen Abstrafung der Rädelsführer
auch in Zürich durchaus einverstanden; aber bei der Bestrafung
sollte man nach Ansicht des Zürcher Rates» — gemäss einer
etwas späteren Instruktion an Waser und Hirzel im Feldlager bei Werdmüller
— «mehr auf das Geld sehen damit man sich der Kosten erholten
könne»! Eine echt zürcherisch-krämerische Nuance der absolutistischen
Brutalität neben der echt bernisch-junkerlichen Abart derselben!
Unter solchen Auspizien also gingen nun am 6. und 7. Juni die
Stanser «Friedensverhandlungen» zuende. Mit schlecht verhehlter
Schadenfreude stellt Liebenau von dieser Wende fest: «Den Bauern entging
der Ernst der Lage nicht; sie sahen ein, dass sie mit ihren Drohungen
und Unterhandlungen die beste Zeit verloren hatten, dass sie
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 562 - arpa Themen Projekte
sich von ihnen abgewendet habe», das ist ein Wunschgedanke Liebenaus.
Wohl aber mag von diesem Augenblick der endgültigen Auswirkung
aller gegen die Bauern wirkenden Faktoren — des diplomatischen,
militärischen und religiösen Druckes sowohl wie der besonders
lähmenden Enttäuschungen am Verhalten der Bundesgenossen — gelten,
was Liebenau von der «Demoralisation im Lager der Bauern»
sagt: dass «Zwietracht zwischen den Entlebuchern und Willisauern
wegen der Untätigkeit der ersteren ausgebrochen war»; begreiflich, da
Emmenegger um seiner Verhandlungsillusion willen die Entlebucher
wohl bestimmt stillzuhalten zwang, während die Willisauer den Hauptanteil
der Verluste im Gisikoner Gefecht zu tragen hatten; sowie dass
«Mangel an Lebensmitteln sich bemerkbar machte und eine Oberleitung
fehlte». «Wohl war Schybi auch wieder in Kriens angekommen;
aber der vermeintliche Zauberer konnte den Mut der Truppen nicht
mehr beleben.»
Da tritt aus dem weitgehend absichtlich hergestellten Dunkel der
Geschichte plötzlich Hans Emmenegger nocheinmal in seiner ganzen
revolutionären Grösse hervor! Das war am 6. Juni, als unter frechem
Bruch des von den Schiedsrichtern soeben erst wiederhergestellten Waffenstillstandes,
wie Vock meldet, «das grobe Geschütz auf den Schanzen
und in den Umgebungen der Stadt unaufhörlich gegen die Bauern
in Tätigkeit war». Wogegen übrigens die allzu gutmütigen Belagerer
nichts anderes vorzukehren wussten als ein sanftes Brieflein: «Es
nimmt uns wunder, dass bei uns der Stillstand geboten ist und bei Euch
nicht auch ebenmässig...»
Eben war nun, wie es bei Liebenau heisst, «das von Kaspar Steiner
namens der 10 Aemter an Landammann Leu in Stans abgeschickte
Schreiben übergeben» worden — was wohl nichts anderes als die Umschreibung
des grossen Hauptverrats Kaspar Steiners ist. Da «veranstaltete
Emmenegger wieder (!) eine geheime (!) Versammlung der Ausschüsse
bei der Kapelle nächst beim Schützenhause in Kriens und erwirkte
mit Stephan Lötscher und Untervogt Spengler von Kriens einen
neuen einstimmigen (!) Beschluss, dass man beim Bunde bleiben wolle
und dass jeder, der davon abstehe, als ein treuloser und meineidiger
Mann soll betrachtet werden»! Das heisst: mitten im vorläufigen Zusammenbruch
der ganzen Bauernsache versucht Hans Emmenegger mit
eisernem Willen und mit ungebrochenem Glauben die grosse Idee des
Volksbundes als Same für die Zukunft vor einer vorläufig übermächtigen
Gewalt in die Illegalität zu retten — er findet dabei die Unterstützung
einer kompakten revolutionären Mehrheit — und sie schleudern
gemeinsam den Fluch der Treulosigkeit und des Meineids gegen
alle Kapitulanten und Verräter! Mit dieser grossartig versöhnenden
Manifestation verschwindet die Figur Hans Emmeneggers fast spurlos
aus der uns so trümmerhaft überlieferten Geschichte jener Tage. Vielmehr:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 563 - arpa Themen Projekte
des Entlebuchs insgesamt ein, die uns bis zuletzt ungebrochen
entgegentritt, als Hans Emmenegger längst gefangen, verhört, geköpft
und vom Henker verscharrt war...
Die Chronik dieses selben Tages, des 6. Juni 1653, weist noch ein
weiteres Faktum auf, das wieder in anderer Weise ebenfalls in eine
geplante revolutionäre Zukunft weist, wenn auch nicht in ganz zweifelsfreier
und in nicht entfernt solch grossartiger Weise wie das letzte
Auftreten Emmeneggers. Liebenau erzählt von dem fast unwahrscheinlich
«revolutionären» Auftreten eines deshalb in seinen Augen naturgemäss
abgründig «gottlosen Pfaffen» namens Jodokus Kraut, Kaplan
zu Grosswangen. Dabei ist jedoch der Verdacht nicht ganz von der
Hand zu weisen, dass es sich bei diesem, bisher im Kampf für die Sache
der Bauern nicht hervorgetretenen weissen Raben möglicherweise um
einen Lockspitzel gehandelt haben könnte, etwa von den Jesuiten oder
gar vom Nuntius in eigener Person zu dem Zweck unter die Bauern
gesandt, um sie durch trügerische Hoffnungen auf eine künftige, umso
sicherere Rache an den Herren zur sofortigen Niederlegung der Waffen
zu verlocken. Zwar hören wir auch ein wenig später nochmals
etwas «Revolutionäres» von diesem seltsamen Kaplan: dass er in seiner
Kirchgemeinde habe Sturm läuten lassen wollen, als Zwyer mit seiner
Soldateska nach Sursee marschierte, um dort das Kriegsgericht zu errichten;
ja, da habe er gesagt, wenn es wieder losgehe, dann wolle er
selbst «die Ermel hindern litzen und auch drei schlagen»! Andererseits
macht seine leicht geglückte Flucht während seines späteren Strafprozesses
wieder Alles zweifelhaft.
Doch wie dem auch sei, Liebenau berichtet: «Kraut gab am 6. Juni
den Bauern den Rat, sie sollen scheinbar mit der Obrigkeit Frieden
schliessen; dann aber, wenn am Schwörtage die Landvögte erscheinen,
,alle Herrn sämtlich ergreifen und an die Bäume aufhängen'. Ich
wüsste, sagte dieser gottlose Pfaffe, tausend Mittel, wie die Bauern an
der Obrigkeit sich rächen könnten; z. B. sollten die Bauern sich stellen,
als wollten sie an einem Jahrmarkt die Glitten auslösen und dann
die Herren niederschiessen; die Bürger würden Hilfe und Beistand leisten.
Ich wollte es, versichert Kraut, den Herren selbst ins Gesicht
sagen, dass sie am ganzen Unglück allein Schuld seien.» Wenn Jodokus
Kraut diese Ansichten tatsächlich gehegt und geäussert haben sollte,
dann Hut ab vor diesem «gottlosen Pfaffen»! Er wäre alsdann der beste
Demokrat unter allen Luzerner Geistlichen gewesen. Und jedenfalls liegen
diesen Aeusserungen — ob sie nun aufrichtig gemeint waren oder
nur schlau benutzt wurden — wirkliche Gefühle und Gedanken der
breiten Masse des damaligen Volkes zugrunde, das angesichts der Art,
wie man mit ihm umsprang, gar nicht anders konnte, als sich tausend
Mittel und Wege auszudenken, wie es seinen Peinigern heimzahlen
könnte...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 564 - arpa Themen Projekte
Zuletzt war es noch der grossmächtige Zwyer selber, der den
Stanser «Schiedsrichtern» Beine machte, damit sie ja endlich mit dem
«Rechtsprechen» Schluss machten und es ohne solchen Firlefanz ihm
allein, Herrn Zwyer, überliessen, die Gewalt anstelle des Rechts zu
setzen. «Die Vermittler in Stans», sagt Liebenau, «wünschten den Abschluss
eines neuen Waffenstillstandes; allein Zwyer liess zurückmelden,
mit Rechtsprechen lasse sich der Streit nicht beenden. Die Justifikation
(d. h. die Abstrafung der Rädelsführer) müsse der Stadt Luzern
überlassen werden und der letzte Termin des Waffenstillstandes
müsse mit dem Morgen des 8. ablaufen». Der Stadt Luzern — das hiess:
Zwyer!
So unbezähmbar heftig nämlich brannte dieser «edle Eidgenosse»
und «Landsgemeinde-Demokrat» — wie er noch bei unseren modernen
Herrenchronisten heisst — darauf, mit der in seiner Hand vereinigten
militärischen Macht ein Blutbad im entwaffneten Volk anzurichten! Wie
«edel» und «eidgenössisch» schüttet er darüber dem Bürgermeister Waser
sein gequältes Herz in einem Brief vom 8. Juni aus: «Mir will» —
klagt Zwyer über den Nichtgebrauch solch schöner, endlich zusammengebrachter
«eidgenössischer» Armeen — «mir will das Herz
schweinen (!), dass man so ansehnliche Mittel. dem gemeinen Wesen
sämmtlich so wohl aufzuhelfen, nicht braucht (nicht anwendet), und
dass man solches, was schädlich, nicht abwendet und damit so langsam
fährt». Durch Feuer und Schwert möchte der österreichische
Feldmarschallieutenant im Schweizervolk mit all dem Rebellenpack
aufräumen, das sich für die alteidgenössischen (ach, so kompromittierend
anti-österreichischen!) Freiheitsrechte begeistert... Nur so
kann er hoffen, dem «gemeinen Wesen» des absoluten Herrenregiments
innerhalb des Gebildes, das sich noch «Eidgenossenschaft» nennt, «so
wohl aufzuhelfen», dass er es als todsicheres Instrument seinem kaiserlichen
Herrn zu Füssen legen und dessen Lohn und Lob ernten
kann... Nur schade, dass das kostbare Instrument, kaum dass es endlich
wirklich untadelig als einträgliche Söldnerfabrik für fremde Fürsten
funktioniert, von Zwyers Busenfreund Waser an dessen Herrn und
Meister, an den König von Frankreich, ausgeliefert werden und Zwyer
das Nachsehen haben wird...
Endlich «traf am 7. Juni, abends, die Kunde ein, die Schiedsrichter
in Stans hätten den Spruch beendet und wollten denselben am 8. Juni,
um 4 Uhr nachmittags, bei der Eiche auf dem Grossen Hof zu Kriens
feierlich verkünden». Dies geschah also am 8. Juni, Sonntag Trinitatis,
Pfingstsonntag der Protestanten — und «während der Verlesung kredenzte
Maler Hans Andreas Rassmann den zu Pferde sitzenden Ehrengesandten
den vom Rate gespendeten Ehrenwein». Wozu doch auch
Künstler in einem echten Herrenstaat gut genug sind, wenn sie sich zu
solchen Lakaien erniedrigen lassen!
Was da nun aber in dem Stanser Spruch dem Luzerner Volk kredenzt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 565 - arpa Themen Projekte
aller und jeder Volksrechte, andererseits die erste offizielle
Einleitung zum Blut- und Rachegericht über die «Rädelsführer»! Dies
letztere nach einem Prinzip, das die besonders kleinhirnigen Luzerner
Herren bereits in einem Brief vom 2. Juni aus Stans in französischer
Sprache an die Solothurner Herren klassisch formulierten, indem sie
schrieben, sie hätten «die feste Ueberzeugung, dass man aus diesen
Wirren nur herauskomme, wenn man die wahren Ursachen (!) beseitige,
d. h. die Urheber und Aufwiegler»!
Heben wir nur die ganz wesentlichen Dinge aus den 14 Punkten
dieses weitschweifigen Dokuments heraus und fassen wir sie unter den
zwei soeben hervorgehobenen Hauptgesichtspunkten zusammen.
1. Aberkennung der Volksrechte:
Punkt 2: «Was die Freiheitsbriefe betrifft, die die einzelnen Aemter
zu haben behaupten oder von denen sie behaupten, dass sie ihnen von
früheren Landvögten aus den Händen gezogen», d. h. gestohlen worden
seien, «sollen sie, die Unterthanen, dannethin in Ewigkeit (!) von solchem
Geschrei ab- und zur Ruhe gewiesen sein»!
Punkt 3: «Was dann zwischen ihnen, den beiden Partheien, im
verwichenen März dieses Jahres 1653 durch die Herren Ehrensätze der
VI löbl. Orte gütlich, auch rechtlich vertragen (verglichen) und ausgesprochen
worden, solle selbiges alles bei seinem eigenen und ausdrücklichen
Buchstaben unangerupft (unangetastet) in Kräften bestehen und
verbleiben...» (Das heisst: Das «gefälschte Machwerk» des Rechtlichen
Spruchs vom 18. März, von dem die Bauern öffentlich nachgewiesen
haben, dass ihm Zwyer nachträglich drei nie verhandelte Artikel betrügerisch
hinzugefügt hat —. darunter vor allem: die Aberkennung des
Wolhuser Bundes bezw. seine Verfemung als todeswürdigen Hochverrat,
sowie die untergeschobene Selbstbezichtigung der Bauern als strafwürdige
Schuldige etc. — soll wörtlich und buchstäblich anerkanntes
und anwendbares Recht sein und bleiben!)
Ausserdem wird in Punkt 3 ausdrücklich anerkannt, «dass dieselben
Herren Ehrensätze (vom März, also auch der Fälscher Zwyer!)
dabei aufrecht, ehrlich und unparteiisch gehandelt haben»!
Punkt 4: enthält die Aberkennung des Huttwiler Bundes: es sei
«eingesehen, auch zumal gefunden, dass solcher wider Gott, wider geistliche
und weltliche und natürliche Rechte und Gesetze, wider die Vernunft,
wider der IV, wider der VIII und ebenmässig wider der XIII
Orte löblicher Eidgenossenschaft aufgerichtete Bünde sei; ist derowegen
derselbige hiedurch aufgehoben. auch ab und ungültig, tobt und nichtig
gemacht, und hiemit zugesetzt, dass Niemand unter diesen Aemtern,
weder jetzt noch in zukünfigen ewigen Zeiten, dessen gedenken, noch
davon reden, noch desselbigen sich behelfen, auch nicht unterstehen
solle, weder einen solchen noch einen andern dergleichen Bund wiederum
an- und aufzurichten...» Wer aber dawider handeln würde, von
dem solle «Leib und Gut der Obrigkeit ohne Gnade verfallen» sein!
Ebenso, wer einen solchen «Bundesanstifter und Aufrichtet behausen
und behelfen», oder auch nur von ihm «hören oder vernehmen sollte
und der hohen Obrigkeit nicht angeben» würde!
Punkt 6: Allen, die mit der Regierung gehalten, soll Alles durch
den Täter oder das betreffende Amt wieder ersetzt werden, worin sie
geschädigt wurden; auch sollen alle diejenigen wieder in ihre Aemter
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 566 - arpa Themen Projekte
worden waren.
Punkt 9: «Wir ordnen und erkennen, dass inkünftig die Gewehre
nimmermehr von den Unterthanen wider ihre Obrigkeit ergriffen
werden, noch sie wider dieselbe ausziehen.» (Das heisst: Die Revolution
ist behördlich verboten!)
2. Einleitung der Rachejustiz:
Punkt 7: «...Es soll aber daneben den Herren der Stadt Luzern
freistehen, von obbenannten Aemtern (allen X Aemtern) solche Stifter
und Rädelsführer ihrem Belieben nach, an der Zahl zwölf, zu benamsen,
die sich vor ihrer Obrigkeit auf Gnad und Ungnad stellen und
deren eintweders (eines von beiden, Gnad oder Ungnad) erwarten
sollen...»
Weil aber die Bauern behauptet hatten, dass in dem «gefälschten
Machwerk» Zwyers vom 18. März «etwelche Wörter gemangelt haben
oder versetzt worden», dass ihnen insbesondere das Wort «Fehler»
und damit ein Schuldbekenntnis untergeschoben worden sei, so wird
— der Einfachheit halber und weil man dann wirklich «Schuldige»
herausgreifen kann, wo man nur will — mit demselben Punkt 7 ein
allgemeines Schuldbekenntnis angeordnet; nämlich so: «... so ist befunden
und erkennt, dass sie alle miteinander gefehlt haben: derowegen
sie solch ihre Fehler vor ihrer Obrigkeit der Stadt Luzern bekennen,
auch um Gnad und Verzeihung bitten sollen»!
Punkt 10: Der zahllosen «eingebrachten Klägden halb» betr. die
Landvögte, die Bussen, die Strafen etc. wird angeordnet, «dass die
Herren der Stadt Luzern (!) ein unparteiisches (!!) Gericht» zusammensetzen
sollen, bestehend aus «vier uninteressierten Bürgern» ihrer Wahl,
sowie je einem Vertreter der vier Urkantone, unter dem Vorsitz des
Ritters, Pannerherrn und Altlandammanns Karl Emanuel von Roll (des
Präsidenten ebendesselben Schiedsgerichts von Stans, das diese 14
Punkte erlassen hat!).
(In dieser Form ist das «Unparteiische Gericht» nie zustandegekommen;
einfach deshalb, weil im Volk ein unüberwindlicher Hass gegen
die Art «Unparteiischkeit» entstanden war, die die «Ehrensätze»
der vier «Landsgemeinde-Kantone» durch das greuliche Machwerk des
Stanser Spruchbriefs bewiesen hatten. Der Luzerner Regierung blieb
also nichts anderes übrig als das Gericht — wenn sie schon dieses
Feigenblattes bedurfte, um die Blösse ihres schlechten Gewissens zu bedecken
— ganz aus den eigenen Reihen zu besetzen: aus 4 Mitgliedern
des Kleinen Rats, 3 des Grossen Rats und 2 der Bürgerschaft. Das «Unparteiische
Gericht» war also nichts anderes als eine erweiterte Regierungs-Kommission
— und es wurde deshalb unverzüglich zum Zentrum
einer unkontrollierbaren Staatskorruption, indem durch «Verehrungen»,
d. h. durch Bestechung seiner Mitglieder, Ehre und Straflosigkeit,
Recht und Leben käuflich waren.)
Ausser alledem war in dem Spruchbrief natürlich sofortige Waffenniederlegung
seitens des Volkes (innert 2 Stunden!) und völlige Abrüstung
der Schanzen etc, angeordnet, während die Stadt Luzern ihre
Schanzen behalten und Soldaten nach Belieben in Sold behalten
konnte! Ferner sollten natürlich alle X Aemter beförderlichst auf die
Knie gehen und «die alte, gehörige, schuldige Huldigung eidlich thun
und leisten».
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 567 - arpa Themen Projekte
Begreiflich, dass bei Anhörung einer solchen Bedrohung und Beleidigung,
wie sie dieser «Rechtsspruch» darstellt, teils Schrecken, teils
gerechter Zorn das Gemüt der Bauernmassen durchfahren musste.
«Mancher der Hauptanstifter», sagt Vock, «wurde bei Anhörung des
7. Artikels vom Schrecken ergriffen und sah sich darin als Opfer bezeichnet...»
Aber — «die Entlebucher, immer noch trotzigen und ungebeugten
Sinnes, ergaben sich nicht, sondern führten, auf neuen Widerstand
sinnend, die der Stadt Sursee geraubten Feldstücke mit sich
fort». Das ist echt Emmenegger'scher Geist, in gerader Fortsetzung über
die Niederlage hinaus. Und geradezu erschütternd echt Emmeneggerisch
ist, dass sie dabei trotz der Niederlage den Hintersassen Wort hielten,
die Emmenegger als Mitkämpfer aufgerufen hatte, als die Bürger die
Bauern verrieten. Denn Liebenau berichtet noch ausdrücklich von den
Entlebuchern, im Gegensatz zu den übrigen, schleunig auseinanderstrebenden
Bauern: «Die Entlebucher dagegen teilten sich in zwei Kolonnen,
die eine umfasste die alten Landleute, die andere die Hintersassen,
denen man die Aufnahme ins Landrecht versprochen hatte»!
Und auch das ist daran bemerkenswert: dass die Entlebucher, als vielleicht
einzige Bauernsame in der Schweiz, sich für gemeinschaftliches
revolutionäres Handeln disziplinieren gelernt und den eingefleischten
bäuerlichen Anarchismus überwunden hatten! Das prägte noch auf lange
hinaus ihr Gesicht in der traurigen Geschichte, die jetzt ihrer wartete...
Wenn einstweilen im Luzernischen der rachedurstige Herr Zwyer
noch nicht zu dem ersehnten Blutbad gelangte, sondern mit seinen
Truppen nur nach Sursee ziehen durfte, um dort das luzernische Blutgericht
aufzurichten und zu präsidieren — so floss im Bernischen bereits
seit Tagen das Blut in Strömen! Da nämlich war Sigmund von
Erlach, dieser macht- und geldgierige, missgünstige und geizige .Junggeselle,
dabei, sich durch verschwenderisches Vergiessen des Volksbluts
den Titel eines «Retters des Vaterlandes» zu verdienen. Und bei diesem
Wettstreit zwischen dem Urner «Landsgemeinde-Demokraten» und dem
reinblütigen Berner Junker gewann unstreitig dieser!
Schon von den ersten Tagen des Auszugs der 7000 Erlachischen,
vom 3. bis 5. Juni, berichtet Vock: «Die Mannszucht war nicht strenge:
die Soldaten plünderten, verwüsteten, mordeten und misshandelten die
Landleute schrecklich»! Wohlgemerkt, das geschah gegen eine völlig
unbewaffnete, friedliche Bevölkerung, als Erlach durch Münchenbuchsee,
Jegenstorf, Fraubrunnen und Bätterkinden nach Utzenstorf und
Landshut und am 5. bis nach Wangen an der Aare zog, noch an manchen
andern Orten übel hausend. «Schon am 4. Juni hatte dieser Erlach
aus Münchenbuchsee die Befugnis zu kurzem Prozess mit den
Rebellen und zur Konfiskation ihrer Güter im Falle Ausbleibens bei der
Citation verlangt», schreibt Bögli. In keinem dieser Dörfer zeigte sich
auch nur ein einziger Soldat Leuenbergers!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 568 - arpa Themen Projekte
Aber setzen wir einfach das Zeugnis eines Augenzeugen, des wirklich
unverdächtigen, weil vollkommen herrenfrommen Jost von Brechershäusern,
hierher, auf das sich der gute alte Domdekan Vock —
gewiss auch kein Revolutionär — stützt. Jost war eben auch Bauer —
und als er das mitansehen musste, was da an seinem eigenen Land und
Volk geschah, da drückte es ihm doch schier das Herz ab. Er schreibt:
«Nun, wie gemeldt, als man von Mellingen bar heimkommen, und vermeint,
es sigi jetzt alles richtig, sind Mine Gnädigen Herren im Zorn
ufgebrochen, und mahnten die ihrigen Welschen und vii Fremde,
etlich tusend Mann. Nun ging's an um Bern her, unten us gegen den
Landgraben uff Jäggistorf zu und Hindelbank, alles in der Pfingstwoche,
gar jämmerlich geraubt, gefangen, und sollicher Gestalt nach
Uzenstorf, Kilchberg, Koppigen, gar jämmerlich gehauset und Lent
um's Leben gebracht; doch sind nit viel umkommen, aber gefangen
gar viel in Koppigen; da dannen zug ein grosse Macht nach Subigen,
Wangen und gen Bipp, da herum sie übel gehauset.»
Am 5. Juni erliess der Berner Rat einen ausführlichen Befehl zur
neuen Huldigung, in welchem er keine Schmach vergass, die geeignet
war, das Volk dauernd zu erniedrigen. Am 6. Juni früh ersuchte General
von Erlach den General von Werdmüller, mit seiner Armee etwas
mehr «ob sich zu rücken», um eine «Conjunction» der beiden Armeen
herbeizuführen. Schon am gleichen Tage rückte daher die Zürcher Armee
Richtung Lenzburg gegen den bernischen Oberaargau vor. «Inzwischen
wurden zu Wangen und in der Umgegend», wie Vock von den
Erlachischen weiterberichtet, «die Rädelsführer eingefangen, jene, die
sich widersetzten, niedergemacht; das Städtchen Wiedlisbach wurde
den Soldaten zur Plünderung überlassen; oder, wie der von uns schon
wiederholt angerufene Griechisch-Professor im damaligen Bern in sein
Tagebuch schrieb: ward «demnach Wietlispach das Stetli gestürmpt,
die Thor weggenommen, die Ringmuren niedergerissen und also das
Stetli zu einem Dorff gemacht». Zu diesem Zweck habe er, so schreibt
(wie Bögli berichtet) Erlach selber nach Bern, «bei 1200 Mann zu Fuss
nebst der Kavallerie in das Erzrebellennest Wiedlisbach einquartiert
und bei 50 der ersten Rebellen gefangen» genommen. Paul Kasser, der
Geschichtschreiber des Amtes Aarwangen, fügt hinzu: «Was wenig
Wert hatte, wurde zerschlagen, Gold- und Silbergeschirr weggeraubt.»
Vock erzählt weiter: «Die von Bangigkeit und Schrecken überwältigten
Bauern eilten von allen Seiten herbei, ihre Waffen zu Füssen des Generals
niederzulegen und ihn demütigst um Verzeihung und Gnade
zu bitten. General von Erlach zeigte dies der Regierung durch Zuschrift
vom 6. Juni an, mit der Bemerkung, dass es unklug wäre, den
Bauern bei solcher Lage der Dinge noch irgend eine Konzession zu bewilligen.»
«Zur Anwendung brutaler Gewalt» wurde überhaupt, wie Bögli
feststellt, «die Regierung fortwährend von ihrem General von Erlach
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 569 - arpa Themen Projekte
«um Vollmacht für die im Felde stehenden Kriegsräte, dass sie die gefangenen
Rebellen, die man nicht mit hinlänglicher Sicherheit nach
Bern liefern könnte, an Ort und Stelle verurteilen und, andern zum
Schrecken und Exempel, in ihren Aemtern und Dörfern hinrichten lassen
dürfen»! Das war also das Standrecht, wie man es sonst nur gegen
äusserst gefährliche bewaffnete Gegner in der verzweifeltsten eigenen
Situation anwendet. Hier aber ist es — das kann nicht genug betont
werden — eine völlig friedliche, gänzlich unbewaffnete Wohnbevölkerung,
gegen die dieser — wie Rösli sagt — «an schwedische Manieren
gewöhnte» Berner Junker das Standrecht verlangt, einzig um seine Wut
und seine Rachgier hemmungslos an ihr auszulassen!
Die geradezu pathologische Begründung gibt Herr von Erlach
selbst, nämlich dort in seiner oben von Vock referierten Zuschrift an
den Rat, wo er die völlige Unterwürfigkeit der Bevölkerung nicht etwa
als Grund zur Milde, sondern als Grund zu besonderer Strenge empfiehlt.
Das bezeichnendste aber ist nicht, dass dieser feige Herr mit dem
Trieb zur Machtbefriedigung in der Richtung des geringsten Widerstandes
das Standrecht fordert, sondern dass er es von seiner Regierung
auch unverzüglich bewilligt erhält! «Der Rat von Bern», schreibt Vock,
übersandte am 7. Juni dem General von Erlach die verlangte Vollmacht»!
Nicht genug damit — er «fasste zugleich am nämlichen Tage einen
oberkeitlichen Beschluss, wodurch das Landvolk, in Betrachtung seiner
beharrlichen Widersetzlichkeit und revolutionären Gesinnung der bisher
von ihm oberkeitlich bewilligten Artikel und Konzessionen (das
heisst derjenigen von Anfang April!) verlustig und der auf dem Murifeld
geschlossene Vertrag für null und nichtig erklärt wurde! Gebrochen
hatte man diesen Vertrag ja längst. Aber bezeichnend ist es doch,
dass man ihn erst jetzt für null und nichtig erklärte, als er — nach
dem Zusammenbruch der bäuerlichen Gesamtfront in Mellingen — zu
einer Art Zuflucht für die Berner Bauern zu werden begann!
Aber auch damit noch nicht genug! Jetzt war der Berner Rat im
Schwung und daher wollte man nun gleich auch mit dem Mellinger
Vertrag «abschaffen». Denn auch dieser konnte jetzt immerhin als
Zuflucht gegen die Berner Herren angerufen werden und erschien diesen
natürlich als viel zu «milde»; seine «Konzessionen» wurden daher
bereits in der neuen Schwurformel ebenso für ungültig erklärt wie diejenigen
vom April und die des Murifeldfriedens. Ausserdem aber empfanden
die Berner Herren den Mellinger Vertrag «als einen Eingriff
in ihre Standessouveränität»! Peter berichtet: «Einmal erregte es in
Bern lebhaften Unwillen, dass der Kriegsrat der eidgenössischen Armee
überhaupt von sich aus zu Mellingen... mit bernischen Untertanen
über Friedensbedingungen verhandelt hatte... Sodann war der bernische
Magistrat höchst erstaunt darüber, dass der Mellinger Vertrag
nicht ausdrücklich die Auslieferung der Rädelsführer postulierte«!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 570 - arpa Themen Projekte
Dies hatte General Werdmüller zwar, wie wir sahen, bereits am
6. Juni in den Freien Aemtern offiziell korrigiert. Ungleich durchgreifender
aber besorgten dies jetzt General von Erlach und der Berner
Hat; jener mit Schwert, Muskete und Galgen; dieser naturgemäss —
da er jenen deckte — ebenso, ausserdem aber auch mit spitzer Feder
gegen die noch allzu erfolgreichen Zürcher Konkurrenten. «Denn General
Werdmüller», berichtet Vock, «ward auf seine Zuschrift aus
Othmarsingen» (wo sich seine Armee im früheren Bauernlager niedergelassen
hatte!), «vom 7. Juni, worin er von dem mit den Bauern am
4. Juni geschlossenen Vertrage Kenntnis gab und der Regierung von
Bern Schonung gegen das Landvolk» (welche Zumutung für die Herren!
Und also war die Kunde von den Erlachischen Brutalitäten bereits
bis zu Werdmüller gedrungen!) «und beförderliche Anordnung
der neuen Huldigung anempfahl, rückantwortlich grosses Befremden
und Missallen geäussert...» worauf dann die oben von Peter referierten
Bedenken folgen. General Werdmüller nahm übrigens dieses Schreiben
auch seinerseits «sehr empfindlich» auf, und «von da an zeigte sich
seine Misstimmung gegen Bern« noch bei manchen Gelegenheiten und
noch auf lange hinaus — wie natürlich auch umgekehrt.
Am selben Tag, an dem auf dem Krienser Grund bei Luzern der
Stanser Spruch feierlich verkündet wurde, «am Pfingstsonntag der Reformierten,
den 8. Juni», so berichtet Bögli, «zog nun von Erlach gegen
Herzogenbuchsee, weil er vernommen hatte, dass Leuenberger dort
neue Truppen sammle. Wirklich waren auf die Nachricht von den.
Gräueln der Regierungstruppen wieder viele Bauern, hauptsächlich
Emmentaler, zusammengeströmt, allein auf die Versicherungen des
zürcherischen Generals Werdmüller (!) der dem Leuenberger den
Mellingervertrag garantierte (!) grösstenteils heim Geze gen. Gegen das
Heer von Erlachs fanden sich daher jetzt nur noch einige hundert
Bauern ein»!
Wieder, und zum letztenmal, eine Tragödie falschen bäuerlichen
Vertrauens in ein Wort der Obrigkeit... und diesmal wirkte es endgültig
entscheidend und tödlich. Sehen wir zunächst zu, wie diese
letzte Tragödie des falschen Vertrauens zustandekam; alsdann wie sie
sich vollzog und endete.
Am 6. Juni, als sich in und um Herzogenbuchsee — wie Vock nach
Jost von Brechershäusern annimmt — an die 5000 bewaffnete Bauern
um Leuenberger wieder gesammelt hatten, schickte dieser wegen des
Terrors des Generals von Erlach einen Protest und Appell an die
Zürcher Regierung (nicht an General Werdmüller!), welches Schreiben,
nach Vock, folgendermassen lautete:
«Aus Achtung für die Herren Ehrengesandten des Standes Zürich
haben die Landleute vor zwei Tagen bei Mellingen die Waffen niedergelegt
und den Frieden angenommen. Sie dürfen also wohl hoffen, dass
die Regierung von Zürich sie bei den genehmigten Friedensartikeln
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 571 - arpa Themen Projekte
verübe die grössten Gewaltthätigkeiten, und misshandele das Landvolk
auf grässliche Weise. Darum werde die Regierung von Zürich ersucht,
an jene von Bern zu schreiben, dass sie ihre Truppen zurückrufe, und
ihr Landvolk, welches sich fortan gehorsam und unterthänig erweisen
werde, ruhig und unangefochten zu lassen.»
Leuenberger wurde auf dieses Schreiben durch General Werdmüller
geantwortet, und zwar umgehend, so dass Leuenberger bereits am
7. im Besitz der Antwort war. Nach Vock hat in dieser Antwort «General
Werdmüller die erneuerte schriftliche Zusicherung gegeben, dass
Zürich auf Vollziehung der zu Mellingen festgesetzten Friedensartikel
halten und alles Mögliche zur Befestigung der eingeleiteten Versöhnung,
Eintracht und Ruhe tun werde, insofern das Landvolk künftig
die Pflichten treuer Untertanen erfülle und er, Leuenberger, nach seinem
Versprechen die vier Abschriften des Huttwilerbundes samt dem
Original unverweilt ausliefere».
Wie die Bauern durch Leuenberger von dieser Zusicherung in
Kenntnis gesetzt wurden und inwiefern die Wirkung derselben eine
so starke und rasche war, dass vom 7. auf den 8. Juni die angeblichen
5000 Bauern auf ein Häuflein von «einigen hundert» zusammenschmolzen,
darüber sagt uns leider kein Bericht und keine Quelle etwas aus.
Aber auch der neueste Spezialforscher, Rösli, schliesst sich ganz der
Darstellung Böglis an und bestätigt: «Nur ein Rest, Leuenbergers
letzte Schar, beschloss, unter den 'Waffen zu bleiben, bezog bei Herzogenbuchsee
Stellung und verschanzte sich besonders auf dem dortigen
Kirchhofe.» Der Zeitgenosse Jost von Brechershäusern beziffert diese
letzten Getreuen Leuenbergers gar nur auf 200 schlecht bewaffnete
Bauern... gegen eine reguläre Armee von 7000 Schwerbewaffneten
und Berittenen! Tragischer konnte das Machtverhältnis für die Bauern
jedenfalls kaum mehr sein.
Am 7. nachmittags war Sigmund von Erlach von Wangen aufgebrochen,
um mit seiner Armee womöglich noch am gleichen Tag nach
Langenthal zu gelangen. Da sich jedoch zwischen Wangen und Herzogenbuchsee
Scharen bewaffneter Bauern zeigten — es waren die
ersten, die von Erlach überhaupt zu Gesicht bekam —, so liess er seine
Truppen die Nacht über auf freiem Felde lagern. Um ihn nicht als
Feigling erscheinen zu lassen, werden in den Berichten der Herrenchronisten
(die vermutlich auf Erlachs eigenen Berichten beruhen) die
gesichteten Bauernscharen zu einer grossen Armee von Tausenden von
Bauern gemacht, was, wie wir sahen, ganz ausgeschlossen ist; dies umsomehr,
als es sich hiebei nicht einmal um die Hauptmacht der Bauern,
sondern lediglich um eine rekognoszierende Vorhut gehandelt haben
kann. Prompt tritt denn auch gerade in dieser Nacht wieder einmal ein
sicheres Zeichen der Herrenangst, nämlich ein Himmelswunder, auf,
wenn es diesmal auch kein Komet, sondern nur noch eine Sternschnuppe
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 572 - arpa Themen Projekte
von ungewöhnlichem Schimmer» (!) — so berichtet Vock nach dem in
dieser Hinsicht sicher vollkommen zuständigen Markus Huber — «erregte
Furcht und Besorgnis unter dem Bernischen Heere; man suchte
jedoch die Soldaten zu belehren, dass darin nur eine sichere Vorbedeutung
des künftigen Sieges liege»! Diese Sternschnuppe ist nichts als
die natürliche Ausgeburt des schlechten Gewissens einer richtigen
Plünderer-Armee, von der auch Bögli sagt: «Welch ein Gegensatz zwischen
der Haltung der Bauern im Lager vor Bern und den späteren
jämmerlichen Verwüstungen und Plünderungen der regulären Truppen
des Generals von Erlach!»
So vollzog sich am 8. Juni, am gleichen Tag, da auf dem Krienserboden
bei Luzern der Stanser Spruch verkündet wurde, in Herzogenbuchsee
der allerletzte Akt des offenen Bauernkriegs. Das Gefecht bei
und in Herzogenbuchsee hat jedoch zwei Gesichter. Von den Bauern
aus gesehen, war dieses Gefecht vielleicht das wildeste, verzweifeltste
und heldenmütigste, weil wohl am meisten mit dem Bewusstsein der
Aufopferung für die Bauernsache verbundene. Darin können wir den
tragischen Geist Leuenbergers erkennen: während die Mehrzahl der
ihm seit Mellingen wieder zugeströmten Bauern an die Zusage des
Generals Werdmüller geglaubt hat, hat wohl zweifellos Leuenberger
nicht mehr daran geglaubt — sonst hätte er den blutigen Kampf niemals
verantwortet! So wurde er trotz eigener besserer Einsicht das
Opfer der immer noch vorherrschenden falschen Vertrauensseligkeit
seiner eigenen Anhänger und musste die ganze Last des ungleichen
Kampfes allein auf sich und seine kleine Schar nehmen. Von den
Herren aus gesehen aber, war dieses Gefecht nichts anderes als die
Fortsetzung der Strafexpedition mit Brennen, Plündern und Morden!
Darin können wir ebenso zweifellos den sadistischen Rachegeist Sigmund
von Erlachs erkennen, dem es in einem Masse wie keinem andern
auf die physische Ausrottung gerade der ehrlichsten und stärksten
Träger der ganzen Bauernbewegung ankam.
Folgendes ist, nach Vock, der Verlauf des Gefechtes:
«Am 8. Juni früh, am Pfingstfeste der Reformierten, ritt General
von Erlach an der Spitze eines Reitergeschwaders gegen Herzogenbuchsee;
vor diesem Dorfe traf er sechs mit Hellebarden bewaffnete und
Wache stehende Bauern, die ihn freundlich empfingen und auf seine
Anfrage versicherten, dass die rebellischen Landleute sämtlich abgezogen
seien. Wie nun aber der General sich dem Dorfe nähern
wollte, fielen Schüsse zu seiner Linken und Rechten aus Gebüschen
und Hägen. Er eilte zurück, und rückte sodann mit seinem ganzen
Heerhaufen heran. Die Bauern hatten den Wald besetzt, und eröffneten
mit Flintenschüssen den Kampf gegen die anmarschierenden Soldaten.
Lebhaft angegriffen und aus dem Wald über Wiesen und Zäune zurückgetrieben,
flohen sie in's Dorf zurück, wo sie neuerdings Fuss
fassten und kräftigen Widerstand taten. Das Dorf geriet in Brand, und
bald standen ungefähr siebzig Gebäude in hellen Flammen. Erlachs
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 573 - arpa Themen Projekte
Nun warfen sich einige hundert derselben in den mit einer
Mauer umgebenen Kirchhof des Dorfes und wehrten sich tapfer, bis
sie durch grobes Geschütz daraus vertrieben und in wilde Flucht gejagt
wurden. Viele wurden auf der Flucht getötet oder verwundet,
einige lebend in's Feuer der brennenden Häuser geworfen, und sechzig
gefangen genommen. Am folgenden Tage wurden 27 der getöteten
Bauern begraben, andere derselben nachher in den Kornfeldern tot gefunden.
In Erlachs Heere waren ein Lieutenant, ein Wachtmeister und
mehrere Soldaten getötet und viele verwundet worden. Unter den letztern
befand sich auch der Kommandant der Neuenburger Truppen,
Oberstlieutenant von Villars-Chandieu, der beim Sturm auf Herzogenbuchsee
durch einen Flintenschuss an der rechten Hand verwundet
wurde. Hierauf zog General von Erlach mit seiner Armee nach Langenthal,
wo er die gefangenen Bauern in dortiges Kaufhaus einsperren,
das Lager schlagen, und ringsum in allen Gemeinden das Landvolk
entwaffnen liess.»
Aus der Chronik Josts von Brechershäusern ergänzen wir: «Da
kam ein grosse Macht Rüter und Fussvolk und griffen die Wenigen an
und steckten das Dorf in Brand...»! Das sagt der herrentreue Jost, und
so wissen wir also, wie «das Dorf in Brand geriet», wie Vock beschönigend
schreibt. Auch der Berner Griechischprofessor Berchthold Haller
trägt unterm 8. Juni — freudig zustimmend — in sein Tagebuch
ein: «... haben sy (Erlachs Truppen) selbiges Dorf in Aeschen gelegt
und by 70 Firsten mit Brand zu Grunde gerichtet». Ferner ergänzen wir
aus Josts Chronik: «...und füllten das Kaufhus mit Gefangenen, mehr
als 70 Mann, wohl 8 Tag ohn' Spys' und Trank...»!
Damit wir uns aber noch etwas konkreter vorzustellen vermögen,
wie der Bauernschlächter Sigmund von Erlach mit dem eigenen Volk
— und mit zum Teil ganz sicher völlig Unschuldigen — umgesprungen
ist, geben wir hier als weitere Ergänzung zu dem Vock'schen Gefechtsbericht
noch folgende Stelle aus Bögli mit dem Bericht eines Augenzeugen
wieder:
«Der Predikant Hürner zu Herzogenbuchsee gab in einem Schreiben
vom 11./21. Oktober 1653 an den Landvogt von Wangen folgende
im Gefechte vom 8. Juni Gefallene an. Aus Herzogenbuchsee: Joseph
Moser und seine Frau, vorhin umgebracht und hernach verbrannt;
Marti, Pastor, vorhin erwürgt und auch hernach verbrannt; Daniel
Kilchenmann, der Siegrist, auch im eigenen Hause erwürgt und verbrannt;
Andreas Christen, der jung Sattler, erschossen; Jonas Heinrich,
der Hebammen Mann, erschossen; Daniel Grider, auch auf dem Feld
erschossen; Baschi Ingold, in seinem Hause erstochen, weil er nicht
zur Wehr hatte greifen wollen; Anna Haas, des Gerbers Frau, am folgenden
Mittwoch in Folge eines erhaltenen Schusses gestorben. Aeussere:
Ulrich Brechbühler von Nyffel, Kilchmeier zu Huttwyl, der an der
ersten Gemeinde zu Wolhusen gewesen; Joseph Flückiger, Hutmacher,
und Melcher Moser, Schuhmacher, beide von Huttwyl; Hans Leu ab
dem Berg bei Rohrbach. Noch sechs Bauern und sechs, die für Soldaten
angesehen wurden, seien zum Theil verbrannt, wenigstens an
den Kleidern, einer fast ganz.»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 574 - arpa Themen Projekte
Bögli berichtet ausserdem: «Man fand nachher unter den Trümmern
der eingeäscherten Häuser verbrannte Bauern und Soldaten
durcheinander.» Wenn irgendetwas, so bezeugt diese Tatsache die unversöhnliche
Heftigkeit, mit der die Bauern bis zum letzten Atemzug
kämpften. Bögli bezeugt denn auch: «Die Bauern hatten in diesem
Kampfe, der zuletzt im Oberdorf auf dem Kirchhofe stattfand, eine
solche Tapferkeit und Unerschrockenheit bewiesen, dass von Erlach
selbst in seinem Berichte an die Regierung über dieses Treffen sagte,
sie hätten sich besser gehalten, als Bauern zustehe.»
«Nach dem Treffen von Herzogenbuchsee» — so fasst Rösli die
nun überall rasch umgestürzte Lage im Kanton Bern kurz und präzis
zusammen — «hatte Erlach sein Hauptquartier in Langenthal aufgeschlagen...
Die Truppen wurden in den umliegenden Dörfern einquartiert.
Am 10. Juni entsetzte er auch das immer noch belagerte (!)
Schloss Aarburg. Damit hatte er den ganzen Oberaargau und dessen
Schlüssel fest in seiner Hand. Im Unteraargau stand die eidgenössische
Armee, im erfand das Freiburger Hilfskorps unter Oberst Reynold.
Eine starke Abteilung Reiter und Fussvolk unter Welsch-Seckelmeister
Tillier und Zeugherr Samuel Lerber war ins Emmental detachiert und
hielt die Brücke bei Lützelflüh besetzt, während 40 Mann im Schloss
Brandis und 30 in Trachselwald lagen. Auch die übrigen Schlösser und
festen Plätze, wie Thun, Burgdorf, Büren, Laupen, Landshut, Signau,
Wangen, Aarwangen, waren durch grössere oder kleinere Besatzungen
wohl verwahrt. Zahlreiche Patrouillen durchstreiften von diesen Plätzen
aus fortwährend die Gegend. Das ganze von Aufruhr ergriffene Land
lag in schweren militärischen Fesseln. Jeder Widerstand konnte sofort
mit eiserner Faust niedergeschlagen werden.»
Wer aber glaubt, dass es jetzt wenigstens mit dem Plündern des
eigenen Volkes ein Ende hatte, der täuscht sich gründlich. Rösti fährt
unmittelbar fort: «Diese vollständige Okkupation wirkte um so drückender,
als die Regierungstruppen sich in der durch die wirtschaftliche
Krise und die Unruhen bereits schwer heimgesuchten Landschaft wie
in Feindesland benahmen. Nach den Methoden des Dreissigjährigen
Krieges waren Rauben und Plündern an der Tagesordnung.» Wohlgemerkt,
das geschah, als auch der letzte Rest der Bauernarmee zerschlagen
und zerstreut und das ganze Volk weit und breit bereits völlig entwaffnet
war. Und darin zeichnete sich allen voran die Erlach'sche Herrenarmee
unter der direkten Verantwortung des Generals aus. Paul
Kasser, der Geschichtschreiber des Amtes Aarwangen, bezeugt das vielfach:
«Die Soldaten», sagt er zum Beispiel, «nützten die ,Libertet' zur
Plünderung, die der General gegeben hatte, wohl aus»! Aber nicht nur
die Soldaten, sondern auch die Offiziere, die Berner Junker selber! Es
ist Erlach selber, der dies denunziert. Noch in einem Schreiben vom
13. Juni (!) berichtet er an seine Regierung, «dass die Soldaten, auch
Officierer underhabender Armee sich licentierend, aller Orten Pferd
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 575 - arpa Themen Projekte
Passzedeln von anderen Offizieren (!) selbige durchzubringen.» Welch
ein «Feldherr», der zwar ein ganzes wehrloses Volk eiserner Disziplin
unterwerfen — aber seine eigenen Offiziere angeblich nicht am Stehlen
verhindern kann! Doch dies war offensichtlich nur eine Finte des ja
wirklich nicht wählerischen Herrn von Erlach, um die Verantwortung
von sich auf andere abzuschieben und für eine spätere Abrechnung gedeckt
zu sein...
«Ebenso schlimm», berichtet wieder Rösli, «hausten die Truppen
Lerbers im Emmental. Am 10. Juni meldete er selbst von Lützelflüh:
,Was dann belanget unsere Proviant, nimeren (!) ich von den hiesigen
Bauten uff Credit, Korn, Wein und Rinder sampt anderem mehr, und
soll dasselbige ihnen am jüngsten Tag vergolten und bezahlt werden'..»!
Das scheint selbst dem Berner Kriegsrat zu bunt gewesen zu sein; denn
er verwarnte Lerber am 12.: «Es habend Ire Gn(aden) vernommen, dass
sein Purss (?) mit Rauben und Plündern übel haust haben, dannenhar
Ire Gn. Anlass genommen, imme zu bevelchen, selbige ze hinderhalten...»
Das wird ja, bei solcher Räubergesinnung des Oberkommandanten,
viel genützt haben! Dieser replizierte denn auch bereits am 13.:
das habe ja «nur die Rebellen getroffen», der grosse Schaden aber sei
«nit zwar von meinen, sünder von den Fryburgischen Völckeren beschechen...»
Rösli fügt noch bei: «Diese Plünderungen blieben nicht
etwa nur auf blosses Fouragieren beschränkt, die Soldateska stahl
alles»! Als am 12. irgendein Bauer von Regierungstruppen nach Burgdorf
geführt und von diesen bis aufs Hemd ausgeplündert worden war,
lehnte der famose Herr Lerber am 13. der Regierung gegenüber jeden
Ersatz des Geraubten mit der Begründung ab: «wyl das Volck nit nach
Ervorderen in Zaun zu behalten ist...» Ja, über den abermaligen Vorwurf
der Regierung vom 14., «dass seine Reutter... mit Rauben und
Stählen je lenger je mehr fortfahrind..., auch kein Wahrnungen nüt
helffen wellend...», setzt sich dieser penetrante Herr noch am 19. aus
Langnau mit der zynischen Meldung neuer Plündereien hinweg: dass
die am 18. Juni in Langnau eingetroffene Brigade «nit nur allein im
March (?) sündern auch allhie zu Langnouw und nechst darumb ligenden
Hoffen die Bouwersamme blünderindt, (Ion uns unmüglich, dieselben
darvon zu enthalten». Dieselbe feige Ausflucht, wie bei Herrn von
Erlach, mit derselben zynischen Verachtung alles Rechts und aller
Menschlichkeit. Aber es war natürlich keine Rede davon, dass einer
der beiden vornehmen Plünderer von der Berner Regierung abgesetzt
worden wäre, obwohl sie doch ihr «Unvermögen», zu kommandieren,
schamlos zur Schau stellten, um die Plünderung zu decken — deren
Hauptnutzniesser eben zweifellos sie selber waren! Wohl aber berichtet
Rösli von einer andern Regierungsmassnahme, die wenigstens andeutet,
wohin das Diebesgut besonders hinstrebte: «Um zu verhüten, dass
gestohlenes Gut nach Bern (!) gebracht werden konnte, wurden die
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 576 - arpa Themen Projekte
Wachen werden sich ja vor den Sendungen so grossmächtiger Herren
und Regenten wie von Erlach, Lerber, Diessbach, Morlot, Tillier,
Frisching, von Graffenried u. v. a. m. tief genug verneigt haben, um
nicht zu bemerken, was alles mit ihnen in die Stadt kam...
Halten wir bei Gelegenheit der Antwort Lerbers vom 19. Juni aus
Langnau fest, dass sie deshalb von dort erfolgte, weil zu eben dieser
Zeit die drei Regimenter Lerber, Diessbach, und Morlot in Langnau
sich vereinigten, um in Zusammenarbeit mit Zwyer ins Entlebuch einzurücken
und die immer noch ungebrochenen Entlebucher niederzuschlagen!
Doch bevor wir abschliessend zu den Urhebern der ganzen grossen
Bewegung zurückkehren — zu den Ersten, die sich erhoben und den
Letzten, die gebeugt wurden, aber sich niemals beugten —, müssen wir
zusehen, wie das «furchtbare Strafgericht» in Gang kam, das auch nach
den Herrenchronisten den eigentlichen «Ausgang des Bauernkriegs»
bildete. Es kam schon mit der ersten Stunde des Ein greifens Sigmund
von Erlachs in Gang, wie wir bereits gesehen haben. «Kriegserfahren,
von vornehmer Herkunft und erfüllt vom göttlichen Recht der Obrigkeit»
— so glorifiziert ihn noch Rösli, im Namen der «Objektivität» der
Geschichtschreibung — «war er der gegebene Rächer und Führer gegen
die Rebellen. Um ihn scharten sich alle Anhänger einer radikalen,
rücksichtslosen Lösung, vor allem die Kriegsräte und ihr mächtiger
Anhang.»
Dieser rachsüchtige Junker war daher nicht zufällig der Erste, der
zum offenen, eigenmächtigen Blutgericht über die gefangenen «Rädelsführer»
griff, ohne sich darüber auch nur im geringsten mit den übrigen
Herren ins Benehmen zu setzen oder sich gar um solch überflüssige
Floskeln wie Recht und Gerechtigkeit zu scheren. Er war es ja,
der die Abstrafung der Rädelsführer «die importantiste Aktion von diesem
ganzen Werk» nannte; er war es, der davon sprach, dass «disem
ungeheuweren Thier der Rebellion syn Kopf abgeschlagen, hiemit syne
Kraft und Würkung benommen» werden müsse! Und das Kopfabschlagen
verstand er dabei ganz wörtlich...
Mit Recht stellt daher auch der sonst durchaus herrenfromme Aarwanger
Chronist Paul Kasser fest: «Die Verantwortung für die nun
folgenden zahlreichen Hinrichtungen trägt denn auch zum grossen Teil
General Sigmund von Erlach, der Mann, welcher drei Jahre später,
als er bei Villmergen einem entschlossenen, ebenbürtigen, aber an Zahl
schwächeren Gegner gegenüberstand, so kläglich versagte.» Schon am
4. hatte er ja vorsorglich das Standrecht für sich reklamiert, es auch
unverzüglich bewilligt erhalten: «...ist auch sonderlich unser Verstand»,
so hatten ihm die Herren unter dem 6. die Blanko-Vollmacht
erteilt, «dass inmittlest Ihr Euweren habenden Gwalt nach, gegen den
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 577 - arpa Themen Projekte
Verbrechens, mit der Abstraffung und Execution vorab für fahren söllind
und mögind», mit Ausnahme der zu Burgdorf Einzuliefernden.
«Fürfahren» soll er damit — also hatte er mit Abstrafungen und Exekutionen
schon vor dem 6. Juni begonnen! Er hatte sich ja auch gleich
beim Ausmarsch selbst ein nur zu williges Kriegsgericht — oder wie
es damals auch hiess, «Malefizgericht» — zugelegt, in der Person des
uns als Bauernschinder und Herrenspion im Emmental längst wohlbekannten
Samuel Frisching, sowie des Ratsherrn Anton von Graffenried.
«Am 12. Juni gab die Regierung», wie Kasser mitteilt, «schliesslich
den Kriegsräten den ausdrücklichen Auftrag, die Rebellen abzustrafen.»
So waren die Kriegsräte auch für die schlimmsten Folterungen
und leichtfertigsten Todesurteile von nun an nicht allein durch das dem
Herrn von Erlach verliehene Standrecht, sondern auch direkt durch die
Regierung gedeckt; und dies betraf nicht nur diese zwei, sondern sämtliche
Kriegsräte. Daher kommt es, dass Bögli schreiben kann: «Am
schnellsten (von allen übrigen, kantonalen oder eidgenössischen, Kriegsgerichten)
urteilte im Kanton Bern der Feld-Kriegsrat»; Rösli aber gar:
«Damit war das Schicksal des Landvolkes schlechthin in die Hände
des durch seine radikalen Methoden bekannten Generals gelegt.»
Das erste blutige «Malefizgericht» im Bauernkrieg fand daher im
Schloss zu Aarwangen statt, und zwar bereits am 21. Juni. Wieviele
Bauern Herr von Erlach schon vorher unter dem Vorwand des Standrechts
umgebracht hat, ist niemals zusammengestellt worden; es kann
nach den oben wiedergegebenen Berichten nur geahnt werden. Aber jedenfalls
ist das Aarwangener Blutgericht vom 21. Juni nichts als die
gerade Fortsetzung einer ohne «gerichtliche» Hemmung bereits in
Schwang befindlichen Uebung. Am Tag zuvor, «am 20. Juni, liess General
Sigmund von Erlach», wie Vock erzählt, «im Beisein des Landvogts
Willading von Aarwangen und der Ratsherren Venner Samuel Frisching
und Anton von Graffenried, vier an die Folter schlagen, nämlich Emanuel
Sägisser, Schulmeister von Aarwangen, Uli Flückiger von Rohrbach,
Bernhard Herzog von Langenthal und Christian Blaser von
Trub». Von letzterem werden beispielsweise (nach Markus Huber) folgende
todeswürdigen Verbrechen berichtet: «Welcher nach Bern Kommisbrod
geführt; auch den ersten Brügel aus dem Entlebuch ins Emmenthal
getragen; auch soll er gesagt haben: die Herren von Luzern
und Bern handeln diebisch mit ihren Unterthanen; — war auch zu
Herzogenbuchsee gefangen worden!» Vock berichtet weiter: «An der
Folter hängend, wurden sie examiniert und am Abende des nämlichen
Tages durch das versammelte Kriegsgericht zum Tode verurteilt, und
zwar die drei erstem zum Schwerte, der letztere zum Galgen. Am folgenden
Tage, den 21. Juni, wurden Sägisser, Flückiger, und Herzog enthauptet
und ihre Köpfe an den Galgen genagelt, an welchem Blaser
hing.» Alle sind natürlich, wie die namenlose Servilität der zeitgenössischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 578 - arpa Themen Projekte
Rüeren und Danksagung der gnädigen Urtheill abgestorben...»
Nicht genug damit — auch der Geiselmord an unschuldigen Zufallsgefangenen
war dem vornehmen Herrn von Erlach nichts Unbekanntes:
«Die 45 (nach Jost: mehr als 70) gefangenen Bauern, welche im
Kaufhause zu Langenthal eingesperrt waren, mussten infolge des vom
Kriegsgerichte zu Aarwangen gesprochenen Urteils unter sich das Los
ziehen, welche drei von ihnen um Galgen sterben sollten. Die drei durch
das Los bezeichneten wurden am 23. Juni zu Aarwangen gehängt.» Unter
den drei war Klaus Mann von Eggiwil, einer der treuesten Laufboten
Uli Gallis bei seinen Aufgeboten. Nach Jost von Brechershäusern
sollen es ihrer vier gewesen sein; einfältig setzt er hinzu: «das hat alle
Nachburschaft beduret; denn sonst noch viel gerichtet worden, welches
alles dem letzten und jüngsten Gericht anheimgestellt ist...»
Aber Sigmund von Erlach gab sich nicht damit zufrieden, in seinem
uneingeschränkten bernischen Machtbereich zu wüten, wie es ihm
beliebte. Er setzte vielmehr alle andern beteiligten Herrenregierungen
unter den Druck seiner fanatischen Blut- und Rachegier, um überall
ein möglichstes Maximum an Bluturteilen zu erzielen. Er schreckte
dabei nicht davor zurück, speziell wegen der nicht, oder seiner Meinung
nach viel zu wenig vorgesehenen Exekutionen an den Rädelsführern
sowohl gegen den Mellinger Traktat wie gegen den Stanser Spruch
Sturm zu laufen und deswegen die «Ruptur» mit den Regierungen von
Zürich, Luzern und Solothurn zu riskieren! In Basel allein, wo der moralische
Wettstein regierte, war man uneingeschränkt mit dem Blut-Terror
des Berner Junkers einverstanden — und darin wurde man in
Basel wie nirgend anderswo von der gesamten Geistlichkeit in wahrhaft
skandalöser Weise sekundiert. Da aber auch Zürich und Luzern, ja,
wenn auch ungern und tief seufzend, selbst das «milde» Solothurn,
dem Druck der Erlach'schen Klassenrache nachgaben, so wuchs Sigmund
von Erlach durch seine Haltung in dieser Frage zum wahren
Lehr- und Zuchtmeister der ganzen Schweizer Herrenklasse empor, der
dieser auf lange hinaus die Wege wies, wie sie ihre absolutistische
Herrschaft gegen jede demokratische Regung des Schweizer Volkes
durchzusetzen und zu sichern hatte.
Verträge zwischen Obrigkeiten und Untertanen waren diesem
totalitären Herrn überhaupt ein Greuel. Um beide ihm im Wege stehenden
Pakte dieser Art, den Mellinger und den Stanser, möglichst mit
einem Schlag zu torpedieren, «lud von Erlach», wie Rösti berichtet, «die
Generale Werdmüller und Zwyer für den 11. Juni zu einer Konferenz
nach Aarburg ein», wo Erlach tags zuvor das belagerte Schloss entsetzt
und die «Redlifürer», darunter den Untervogt Stephan Reinli,
verhaftet hatte; welch letzterer, obwohl für die Bauern ein Kapitulant,
für Erlach schon deshalb ein Verbrecher war, weil er seinen Namen
unter den Mellinger Traktat gesetzt hatte. Von dieser «Dreimächte-Konferenz»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 579 - arpa Themen Projekte
mit den Bauern geschlossene Vertrag als zu gelinde verworfen
und annulliert und hingegen beschlossen ward, es solle auf einer in
Zofingen zu eröffnenden Konferenz zwischen Deputierten des Standes
Zürich, des Generals Werdmüller und der Regierung von Bern über
die an die Stelle jenes Vertrags zu setzenden Bedingungen unterhandelt
werden.» Wenn es nun zwar auch nicht ganz so einfach war, wie Vock
dies darstellt, vielmehr noch ein langes, zähes Hin- und Her-Intrigieren
zwischen Bern und Zürich wegen des Mellinger Paktes stattfand, so ist
doch klar, dass von Erlach für den Augenblick den General Werdmüller
zur glatten Preisgabe seines wie seinen Augapfel gehüteten «geschichtlichen
Werkes» zu überreden vermochte. Ja, er brachte diesen
«gerechten und weisen Staatsmann» sogar dahin, an seiner Seite auch
gegen den Stanser Spruch Sturm zu laufen! Denn Vock berichtet weiter:
«Dem General Zwyer wurden von den beiden andern Feldherrn
Vorwürfe hinsichtlich des zu Stans am 7. Juni erlassenen rechtlichen
Spruchs gemacht, dass nämlich die Bestrafung der Luzerner, die vor
Bern und Mellingen gezogen waren, nicht darin vorbehalten wurde.
Sie boten ihm auch alle nötige Hilfe zur Bezwingung und Züchtigung
der immer noch aufrührerischen Entlebucher an.» Und dies bestätigt
auch Zwyer persönlich.
Denn der vereinte Druck von Erlachs und Werdmüllers auf die
auch in seinen Augen viel zu schwächliche Luzerner Regierung konnte
Zwyer nur recht sein. Zweifellos hat er ihn mit den beiden Herren
direkt verabredet; denn dieser Druck entsprach in beiden Hauptpunkten,
dem Strafvollzug und dem Feldzug gegen die Entlebucher, zu genau
den Zwyer'schen Wünschen. Er, der Urner, der ja von Luzern nur
beauftragt war, gierte schon lange genug vergeblich nach einer ähnlichen
Blanko-Vollmacht, wie sie Erlach von der Berner Regierung
hatte. Nicht dass die Luzerner Herren dazu zu gerecht und milde gewesen
wären, bewahre! Aber sie schreckten vor allzu umfassender Vollmachten
an Zwyer eben deshalb zurück, weil dieser nicht Luzerner
war; denn sie dachten noch nicht so hundertprozentig klassenmässig
wie Zwyer, Erlach und Werdmüller, sondern noch etwas retardiert
«alteidgenössisch» standesmässig, d. h. nach kleinbürgerlichen kantonalen
Bedürfnissen der einzelnen eidgenössischen Stände. Das liess sie
auch nie ganz begreifen, warum Zwyer, der Katholik, so zäh danach
trachtete, mit solchen protestantischen Herrengrössen wie Erlach,
Werdmüller, Waser und Wettstein zusammenzuspannen. Dies erweckte
vielmehr in den durchweg unglaublich beschränkten Luzerner Herren
einen stets wachsenden Verdacht, Zwyer könnte dadurch die katholische
Religion in Gefahr bringen, und darin wurden sie durch die steten
Interventionen des päpstlichen Nuntius und die religionshetzerischen
Wühlereien der gesamten Luzerner Klerisei fortwährend bestärkt.
Zwyer wandte sich also am 12. Juni aus Sursee, wo er sein Hauptquartier
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 580 - arpa Themen Projekte
oder vielmehr an den Schultheissen Fleckenstein selber, um in
der raffiniertesten Weise den von Erlach und Werdmüller ausgeübten
Druck in jeder Hinsicht zu verstärken. Darum lautet die Hauptstelle
dieses Briefes wie folgt: «Die Herren Generäle sind nicht wohl zufrieden
und verlangen, dass man ab Seite Luzerns die Huldigung und Abschwörung
des Bundes ehest und ernstlich vornehme, voraus aber und
zuvor, dass die 12 Rädelsführer geliefert werden. Und sollte herum
aus den Orten alles das, was nötig ist, unmöglich gemacht werden» (das
heisst sollten die vier Urkantone, die die Schiedsrichter in Stans geliefert
hatten, Widerspruch gegen die von den Generalen für «nötig» befundenen,
Gewalteingriffe in den Stanser Spruch erheben!), «haben ermeldete
Herren Generäle mit Hand und Siegel versprochen und mit mir
in Mehrerem abgeredet, dass sie, auf jede Notdurft und mein (!) Begehren
mit Reuterei und Fussvolk alle Aufrichtigkeit thun und assistieren
wollen; allein sie finden sich hoch offendiert, dass Luzernische
Unterthanen vor die Stadt Bern und Mellingen gezogen sind und solches
in dem Rechtsspruch übersehen und nichts darum erkennt wurde.
Sie begehren derowegen, man solle dieselbigen, beigelegtem Verzeichnisse
gemäss, zu strafen ihnen (!) überliefern.» Dann wird der Stadt
Luzern noch im Namen aller drei Generäle eingeschärft, «dass sie ihre
Autorität brauchen» solle; im eigenen Namen aber trägt Zwyer noch
zur Verwirklichung seines Lieblingsplans, der Niederschlagung der
Entlebucher, bei, indem er schliesst, er habe «unmaassgeblich weiter
nichts zu erinnern, als dass, weil alles Uebel seinen Ursprung vom Entlebuch
hat und weil man nun aller Hilfe versichert ist, daselbst aller
Ernst gebraucht werde». Und Zwyer unterschreibt als «Meines H G
Herrn williger Knecht». Wir sehen also den grossmächtigen Edelmann
Zwyer abermals — wie schon im März in Ruswil — dabei, aus einem
«Rechtlichen Spruch» ein «gefälschtes Machwerk» zu machen! Nur ist
der Dauererfolg ihm jetzt ganz anders gesichert — denn hinter ihm
stehen jetzt drei Herrenarmeen unter den mächtigsten Männern der
Herren-Eidgenossenschaft...
In der Tat ist diesem Schreiben, wie Zwyer darin erwähnt, ein
vom Junker Erlach aufgestelltes Verzeichnis der an ihn und die andern
beiden Generäle — als angemasste «eidgenössische» Exekutive —
auszuliefernden Luzerner Bauern beigelegt. Ueber diesem Verzeichnis
steht ausdrücklich: «Namen derjenigen Rädelsführer, deren Auslieferung
von Herrn General von Erlach begehrt wird»! Es führt (bei Vock)
nicht weniger als zweiunddreissig Namen auf (bei Liebenau sind es
35), darunter fast sämtliche irgend namhaften Führer, wie: Pannermeister
Hans Emmenegger, der Landeshauptmann Niklaus Portmann,
der Landessiegler Niklaus Binder; aber auch Christian Schybi und
sämtliche drei «Tellen», Käspi Unternährer, der Hinterueli und Hans
Stadelmann; ferner Jakob Stürmli und Hans Jakob Peyer, die beiden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 581 - arpa Themen Projekte
und so mancher andere mehr.
Kurzum, es wäre nicht leicht eine frechere Anmassung zu erfinden,
als sie diese Zumutung des Berner Generals von Erlach an die Luzerner
Regierung darstellt, ihm sogut wie sämtliche Luzerner Rebellenführer
zur Exekution auszuliefern! Er hat sie dann zwar nicht bekommen —
bis auf zwei: Jakob Stürmli und Hans Diener, die später, am 30. Juni,
von dem angeblichen «Eidgenössischen Kriegsgericht» in Zofingen zum
Tode verurteilt wurden. Aber viele von ihnen haben alsdann eben
deshalb mit umso grösserer Sicherheit ihr Leben verloren und umso
furchtbarere Qualen auszustehen gehabt, als sie durch diese Zumutung
zu Zankäpfeln des gegenseitigen Prestiges der verschiedenen Herrenregierungen
gemacht worden waren und als die Luzerner Regierung
in dem edlen Wettrennen um das Köpfen und Hängen der «Rädelsführer»
erst recht nicht mehr hinter den andern Obrigkeiten zurückbleiben
konnte und wollte. Ausserdem konnte sich Zwyer nun umso diktatorischer
des Blutgerichts in Sursee bemächtigten, als die Luzerner Regierung
seiner bedurfte, um die den Generalen Erlach und Werdmüller
verweigerte Judikatur nun wenigstens selber in «ansehnlicher » Weise
— d. h. auf dem gleichen Niveau militärischen Ansehens, wie es jene
beiden Generäle repräsentierten — durchzuführen.
Hierbei vergass Zwyer auch die primitivste Vorsicht und prahlte,
wie Liebenau berichtet, in einem Brief von Mitte .Juni an Bürgermeister
Waser — durchaus wahrheitswidrig —: «Der Rat von Luzern habe
ihm überlassen, das Gericht zu besetzen, die Verbrecher und Gefangenen
zu verurteilen oder zu begnadigen oder weitere Verhandlungen wegen
derselben anzuordnen.» Hieran wird völlig klar, in welchem Grad
Zwyer vom Neid auf Erlachs Vollmachten besessen und von Prestigesucht
zerfressen war! Denn, wie Liebenau sogar gegen seinen Liebling
Zwyer einwenden muss, «so weitgehende Vollmachten besass Zwyer
nicht, er war nur Instruktionsrichter und Präsident des Kriegsgerichtes
(des luzernischen zu Sursee); Bluturteile konnte nur der Rat aussprechen».
Es war übrigens das nach Ansicht Peters «milde und gerechte»
Zürich gewesen, das den Vorschlag gemacht hatte, «dass man die Bestrafung
der Hauptschuldigen und die weiteren Friedensverhandlungen
den drei Generalen samt einigen Vertretern der drei eidgenössischen
Armeen, gemeinsam mit einigen Abgeordneten der Räte von Zürich,
Bern und Basel... überlasse.» Was dann soviel wie ein «Eidgenössisches
Kriegsgericht» darstellen sollte, das am 15. Juni auf dem Rathaus
in Zofingen in der Tat konstituiert wurde und sich im Lauf der
folgenden Tage zu einer wilden «Tagsatzung» unter der völligen Diktatur
der drei Generäle auswuchs. Schon «in der folgenden Sitzung
vom 16. Juni teilte Oberst Zwyer (wie Rösli berichtet) mit, der Rat von
Luzern wolle die Bestrafung der von den Generalen Erlach und Werdmüller
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 582 - arpa Themen Projekte
im geringsten gegen die Errichtung oder das Vorgehen des Zofinger
Gerichts zu protestieren. Luzern errichtete einfach eine luzernische Filiale
desselben in Sursee und lieh seine Gefangenen nach Wunsch und
Bedarf auch nach Zofingen aus, z. B. Schybi.
Solothurn «stand im schlechten Kredit, weil es den Bauern den Ankauf
von Pulver und Lunten gestattet hatte»; hauptsächlich aber deshalb,
weil es sich vom ersten Auftreten Erlachs und seiner Plündererarmee
an gegen dessen ganze Gewaltpolitik empört hatte. Denn deren
Durchführung direkt an den Grenzen Solothurns drohte nicht nur wiederholt,
den Bauernaufstand noch einmal zu entfesseln und ganz allgemein
zu machen; vielmehr wurde der Besitzstand Solothurns durch
von Erlachs Machtsucht direkt bedroht, indem er das ganze Bucheggbergeramt
für den Kanton Bern reklamierte und die Bucheggberger
Bauern bereits als bernische Untertanen traktierte, was noch jahrelange
Händel zwischen Solothurn und Bern zur Folge hatte. Solothurn hatte
deshalb umso mehr Interesse daran, die rapid wachsende Macht der
drei Generäle und insbesondere Erlachs so viel wie nur möglich zu
hemmen, als es selber keine Armee und keinen General hatte!
Daraus nun ist es zu erklären, dass die solothurnische Regierung
von Anfang an gegen die Errichtung eines rein militärischen «eidgenössischen»
Standgerichts, sowie einer Räuber-«Tagsatzung» protestierte,
auf der sie nichts, die Generäle alles zu sagen hatten. Schon am
16. Juni protestierte darum der solothurnische Gesandte in Lenzburg,
Jakob vom Staal, gegen die Niedersetzung dieses angemasst «eidgenössischen»
Kriegsgerichts und schlug, nach Rösli, vor, «man solle überhaupt
niemand vor das eidg. Kriegsgericht ziehen, sondern das Strafverfahren
den Kantonen überlassen. Denn wenn Bern von Luzern die
Auslieferung der Rädelsführer verlange, so könnte Luzern mit demselben
Rechte das Gleiche von Bern, Basel, Solothurn usw. verlangen».
Diese Haltung Solothurns blieb sich — ausser dem sehr verhängnisvollen
Kompromiss, dass es dennoch Gefangene an dieses Gericht auslieferte
— gleich bis zum Schluss der Verhandlungen. Denn noch auf
deren Höhepunkt, am 30. Juni, hat der Venner Jakob vom Staal, wie
Vock erzählt, den Auftrag der solothurnischen Regierung vor dem
Plenum durchgeführt, «sowohl gegen die Aufstellung eines Kriegsgerichts,
als gegen die Befugnis desselben hinsichtlich der solothurnischen
Gefangenen feierlich zu protestieren und zu erklären, die Regierung
von Solothurn habe ihre Untertanen bloss in der Voraussetzung und
nach erhaltenem Versprechen (!) nach Zofingen geliefert, dass eine
Tagsatzung der XIII Orte, keineswegs aber ein Standgericht, in welchem
interessierte Richter sitzen, nämlich Feldherren und Offiziere,
gegen welche die Gefangenen im Felde standen, sie beurteilen und
abstrafen werde.» Diese tapfere Haltung der Solothurner Regierung
enthüllt die geradezu verbrecherischen Täuschungsmanöver, mit
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 583 - arpa Themen Projekte
brachten!
Welch ein Räuber-Gericht dies in der Tat war, geht aus der Rache
hervor, die die Herren Erlach und Werdmüller für dieses anständige
Verhalten Solothurns unverzüglich nehmen konnten. Schon seit Tagen
hatten sie, unterstützt u. a. von Waser und Hirzel, versucht, von Solothurn
eine grosse Summe als «Kriegskostenbeitrag» herauszupressen;
es sollte sich um etwa 30000 Gulden handeln. Unter fortgesetztem
Druck hatten sie es einstweilen so weit gebracht, dass die sich windenden
«Rath' und Burger» Solothurns nach mehrmaliger Sitzung 12000
Gulden anerboten. Jetzt, vom 30. Juni auf den 1. Juli, verabredeten Erlach
und Werdmüller einen richtigen Schurkenstreich, um die ganze
Summe zu erpressen. Darüber berichten Waser und Hirzel in einem Bericht
an den Zürcher Rat unter dem 1. Juli: «Wir beschwerten uns des
schimpflichen, grossen Abbruchs (12000 statt 30000 Gulden!); sie entschuldigten
sich mit der Unmöglichkeit, und dass sie keines Auszugs
begehrt haben. Nachdem aber Herr General von Erlach ihnen zu wissen
gemacht, ,es habe Herr Werdmüller den Pass über die Aare (ins
Solothurnische!) begehrt, welchen er nicht abschlagen könne, und sie
werden sich danach zu akkommodieren wissen'...», so sind endlich,
auf Vermittlung von «gedachtem Herrn von Erlach und Herrn Obrist
Zweger» — damit dieser dabei doch ja nicht fehle —, die Solothurner
darauf eingegangen, «eine Summe von 30000 Gulden, halb baar, zu
bezahlen, und die erste Halbe auf Michaelis, und halb Weihnacht...»
Das ist, was man als «treueidgenössischen Geist» in den Tagsatzungs-Abschieden
so viel berühmt... Nur über kurz übrigens — und ein ähnlich
«brüderlicher» Streit um den Mammon, um denselben Zweck des
Kriegskostenbeitrags, erhob sich zwischen den beiden grossmächtigen
Erpressern Solothurns, zwischen Bern und Zürich selber. Und der war
dann von noch ganz anderer Tragweite: er spaltete die beiden protestantischen
Vormachte der Eidgenossenschaft derart auseinander, dass
sie es noch im Villmerger Religionskrieg drei Jahre später nicht über
sich brachten, eine gemeinsame Strategie durchzuführen, sodass sie von
der katholischen Minderheit beide schmählich aufs Haupt geschlagen
wurden — was noch auf viele Jahrzehnte hinaus Folgen zeitigte...
Bevor wir nun die Liste der Opfer dieses wie der übrigen «Kriegsgerichte»
und damit das tragische Ende der hauptsächlichsten Führer
uns vor Augen führen, wollen wir doch hier noch nachholen, was sich
inzwischen auch die übrige Soldateska, ausser der bernischen, auf dem
niedergeknüppelten Buckel des Schweizer Volkes geleistet hat.
Wir sahen früher schon, dass sich die Werdmüller-Armee bereits
vor und während dem Gefecht bei Wohlenschwil ebenfalls als Plünderer-
und Brandstifter-Armee bewährte und dass darin der Generalmajor
Rudolf Werdmüller tonangebend war. Diese «Bewährung» ging
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 584 - arpa Themen Projekte
des geringsten Widerstandes weiter wie bei den Berner Herrentruppen.
«Die Bewohner der Dörfer, wo die Einquartierungen lagen», schreibt
der besonders herrenfromme Zürcher Peter, «hatten viel zu leiden. So
berichtet Basthardt, Hauptmann (!) Scherb von Weinfelden ,erbeutete'
zu Niederlenz sechs Pferde und erhob von den dortigen Einwohnern
100 Dukaten Brandschatzung, und in Zürich liefen ,grosse Klagen ein
von unerhörtem Plündern in der Grafschaft Lentzburg, im Schöftland
und dort herum...'»; «aber auch Generalmajor Werdmüller liess sich
solche ,Schädigungen der rebellischen Bauern und treulosen Underthanen'
zu schulden kommen.»
Mehr als diese halbe Entschuldigung allerdings erfahren wir bei
Peter nicht über die Plünderungen und Erpressungen des Generalmajors.
Darüber müssen wir beim Solothurner Domdekan Vock nachschlagen,
der, obwohl durchaus auch Herrenchronist, doch als Solothurner
und als Katholik ein Interesse daran hatte, das dem katholischen
Solothurner Volk durch die protestantischen Zürcher Herren angetane
Unrecht für einmal anzuprangern. Vock berichtet: «Am 12. Juni
ritt Generalmajor Werdmüller, von 30 Soldaten. begleitet, von Suhr
nach Schönenwerd.» (Basthardt allerdings sagt: «Am 12. hat die Generalität
150 Mann aus der ganzen Armee und zwei Cornett Reiter, gegen
das Dorf der rebellischen Bauern Werbt {Schönenwerd} marschieren
lassen», was die Aktion weit bedeutender und vor allem als offizielle
Strafexpedition der Armeeleitung selbst erscheinen lässt.) Vom
dortigen Kommandanten Altrat und Rittmeister Glutz, sowie vom
Hauptmann Urs Baumgartner um Schonung des Dorfes gebeten, gab
Werdmüller, wie Vock weiter berichtet, «gute Worte», versprach auch,
die Kirche zu schonen. «,Aber die Bauern', fuhr er zornig fort, ,diese
rebellischen und treulosen Bauern wird man zu züchtigen wissen; auch
den Kindern im Mutterleibe soll nicht verschont werden.' Kommandant
Glutz gab ihm zur Antwort, ,das sei nicht die Manier, wie man mit den
Leuten umzugehen und eidgenössische Regierungen zu behandeln habe,
und ein solches Verfahren sei dem Badischen Tagsatzungsabscheide
durchaus zuwider', — worauf Generalmajor Werdmüller erwiderte:
,die Landesobrigkeit habe nun hier nichts zu befehlen noch zu strafen;
dieses Recht stehe den eidgenössischen Befehlshabern zu (!). Wofern
sie, Kommandant Glut: und Hauptmann Baumgartner, versprechen,
die Bauern von Schönenwerd anzuhalten, dass sie jedem Soldaten eine
halbe Maass Wein und ihm, Werdmüller (!) sechs der schönsten
Pferde (!) geben, so sei es wohl und gut; wo nicht, würden sie was
anderes erfahren. Wenn nicht bis morgen mittags um 12 Uhr eine willfährige
Resolution erfolge, werde das ganze Dorf in Brand gesteckt
werden'...» Das ist das Benehmen eines richtigen Räuberhauptmanns.
Was aber dahinter steckt, ist dieselbe Klassenrache wie beim Junker
von Erlach, ist die Wut der Vergeltung der Herrenklasse an derjenigen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 585 - arpa Themen Projekte
Bedrücker vom Nacken zu schütteln!
Kein Wunder, dass noch als das «Eidgenössische Heer» unter dem
Oberbefehl Konrad Werdmüllers sich bereits auf dem Rückmarsch in
die Heimat befand, am 2. Juli, diese Vergeltungswut sich nochmals
über ebenso unschuldige wie wehrlose Bauern entlud. «Wegen eines
unbedeutenden Anlasses», berichtet Vock nach dem Regimentsschreiber
Scheuchzer, «gestattete der Generalmajor Rudolf Werdmüller den zürcherischen
Soldaten, das Dorf Entfelden, wo sie das erste Nachtquartier
hatten, zu plündern»! Der von Vock schamhaft verschwiegene «unbedeutende
Anlass» sowohl wie die Art der Plünderung geht aus des Zürcher
Herrenchronisten Peter anerkennenswert objektiver Darstellung
dieser Schandtat der Zürcher Armee hervor. Peter schreibt: «Generalmajor
Werdmüller verlangte nämlich vom Untervogt zu Entfelden
eine ,Leistung von vierzig Dublonen an die Offizierstafel' (!). Hauptmann
Dieteg Holzhalb hatte schon drei Tage vorher gedroht, falls die
Entfeldener der Forderung nicht nachkamen, würde das Dorf geplündert
werden. Da sich die Entfeldener weigerten, dem Befehle des Generalmajors
nachzukommen, plünderten die genannten Truppen des Generalmajors
das Dorf beinahe vollständig. Der Untervogt, der Pfarrer
und andere Personen wurden ,mit schändtlichen Reden tractiert'; wie
in Feindesland wurde das Vieh aus den Ställen getrieben; Hausgerät
ward geraubt und Geld erpresst.» Genau wie bei den Truppen des Generals
von Erlach oder bei denen des Zeugherrn Lerber... «Trotz des
(angeblichen) energischen Eingreifens des Bürgermeisters Waser und
des Generals Werdmüller rief die Nachricht von den Vorgängen zu Entfelden
(ausgerechnet!) in Bern gerechte, tiefe Entrüstung hervor...»
Aber selbst der «eidgenössische» Generalissimus Konrad Werdmüller
liess mit derselben Vergeltungswut alle vermeintlichen, bei ihm denunzierten
«Rädelsführer, die er vergeblich aufgefordert hatte, sich zur
Verantwortung zu stellen, eifrig verfolgen». Mit welchen Gewaltmitteln
das zuging, verrät der St. Galler Korporal Basthardt, der berichtet:
«Wir hatten expressen Befehl, einen, namens Schmid, herbeizuschaffen;
da er sich ,unsichtbar gemacht', wurde ihm eine Frist von einem
Tag angesetzt, sich zu stellen. Falls er nicht erschiene, wurde ihm angedroht,
man würde sein Haus in Brand stecken. ,Das Hauss den Soldaten
pryssgeben und ist auf den Boden nidergerissen und zerschleift
worden'». Noch am 17. Juni musste, wie derselbe Basthardt berichtet,
«von unsern hohen Offizieren durch Trommelschläger ausgerufen
werden, dass man den Bauern bei Lebensstrafe keinen Schaden mehr
zufügen solle». Auch dies waren bloss «gute Worte» — ihnen standen
die Taten derselben hohen Offiziere, Taten, wie wir sie eben vernahmen,
hoffnungslos im Wege!
Damit aber auch der dritte Werdmüller, der biderbe Generalfeldzeugmeister,
Artillerie- und Festungsspezialist Johann Georg Werdmüller,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 586 - arpa Themen Projekte
für das dieser Herr verantwortlich ist und das, neben derselben
Klassenwut, einen wahren Abgrund an krasser Unbildung und finsterem
Aberglauben der damaligen schweizerischen Herrenklasse aufdeckt.
Das Protokoll darüber füllt bei Vock fünf Seiten; wir geben nur wenige
wesentliche Punkte wieder.
«Es war nämlich am Tage nach der Schlacht bei Wohlenschwil,
den 4. Juni, einer namens Hans Boller ab dem Horgerberge (mithin ein
Zürcher) gebunden und gefesselt ins eidgenössische Hauptquartier
nach Mellingen gebracht und, weil er beschuldigt wurde, dass er die
Dörfer Wohlenschwil und Büblikon in Brand gesteckt habe, nach vorläufigem
Verhör als Gefangener der Armee nachgeführt worden. Zu
Suhr ward am 11. und 12. Juni Kriegsgericht über ihn gehalten.» Präsident
des offenbar als innerzürcherisches Disziplinargericht funktionierenden
Gerichtshofs war Johann Georg Werdmüller, die Mitglieder
waren lauter Zürcher Offiziere. Der Angeklagte gehörte offensichtlich
der Zürcher Armee an, nicht, wie Peter das erscheinen lassen möchte,
der Bauernarmee. Wohl aber geht aus dem Protokoll hervor, dass er
offensichtlich mit den Bauern sympathisierte und dass er darin nicht
allein stand! Auf die Frage nämlich: «Warum er gesagt, er sei ein
Rädelsführer wie der Leuenberger...», antwortete er: «Er bitte um
Verzeihung; andere haben es auch gesagt»! Es sollte also vermutlich
ein Exempel statuiert werden, um die Gefahr der Rebellion im eigenen
Lager im Keim zu ersticken! Gleichzeitig sollte in ihm ein Sündenbock
für des Generalmajors Rudolf Werdmüller Brandstiftung in Wohlenschwil
und Büblikon gefunden und damit die darüber erregte öffentliche
Meinung und die Zivilbehörden zuhause irregeführt werden! Um
die dem Boller im Protokoll untergeschobene Rolle glaubhaft zu machen,
werden ihm darin alle erdenklichen anderen Schurkereien, von
denen er, aus seinen Antworten zu schliessen, offensichtlich überhaupt
nichts weiss, in die Schuhe geschoben. Diese erfundenen und im Verhör
als völlig negativ erwiesenen Anklagen marschieren dann — nach
heute noch (auch hierzulande) bei Militärgerichten nicht aus der Uebung
gekommenem Muster — in der Urteilsbegründung sämtlich
stramm als Realgrunde für das Todesurteil auf! Selbst der Zürcher
Herrenchronist Peter muss zusammenfassen: «Obschon ihm nichts Bestimmtes
nachgewiesen werden konnte, ward er doch, weil er auch
,gotteslästerliche Redensarten' (!) brauchte und (angeblich) einen sehr
losen Lebenswandel (!) führte, zum Tode verurteilt, ,als ein Haupttrabant
(!) Leuenbergers und als gottloser, lasterhafter Mensch'»!
Was uns an diesem Urteil aber sittengeschichtlich besonders interessiert,
ist der Umstand, dass der erdrückende Teil des Protokolls, um
die Gemeingefährlichkeit des Angeklagten plausibel zu machen, mit
Unterschiebungen des denkbar stickigsten Aberglaubens angefüllt ist.
Da soll er, der angebliche Brandstifter, der Hexenkunst des Feuerlöschens
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 587 - arpa Themen Projekte
schoss! Da soll er sich stich- und kugelfest gemacht haben: man fragt
seine Frau, die man extra hat kommen lassen, «ob sie nicht ein Stämpel
und anderes gefunden, womit er sich fest gemacht?», worauf sie
antwortet: «sie wisse nichts, habe ganz nichts gesehen.» Und als man
sie fragt, welche Gotteslästerungen und Zauberschwüre er gebraucht
habe, da sind es nichts als die jedem Schweizer seit Entstehung der
Welt geläufigen Alltagsschwüre «Sackerment, Donnerhagel und anderes»!
Er selbst wird gefragt: «was für Segen (Zaubersprüche) in seinem
Lorgner (Zauber-) Büchli für das Bluten der Wunden und anderes gestanden?»;
worauf er antwortet: «Er wisse es nicht; er könne nicht
lesen (!); aber der Otti Bär zu Hauptikon bei Kappel habe sie ihm
darein geschrieben»! Dann: «was das für eine schwarze Katze gewesen
sei, die er auf eine Zeit bei sich im Sacke gehabt und die ihm nachgelaufen»?
«Es habe sie ihm ein Stallknecht zu Einsiedeln gegeben; sie
sei noch zu Hause und mause»! Schliesslich: «wie lange es sei, dass er
gesagt: wenn er sterbe, wolle er seine Seele auf einen Zaunstecken
stecken und Gott und den Teufel darum streiten lassen»; worauf er:
«vor achtzehn Jahren (!) hab' er es von einem Landstreicher in des
Lüers Haus zu Kappel gehört, hernach hab' er's auch einmal gesagt».
Und seine Frau, mit der er seit fünfeinhalb Jahren verheiratet ist, bezeugt
darüber: «von ihm habe sie es nie gehört, aber andere Leute haben
es ihr gesagt, worüber sie ihn abgemahnt und gesagt: wenn er solches
geredet, gedenke sie nicht, dass er selig werde».
«Auf diese (!) Geständnisse hin», schliesst Vock, «wurde Hans
Boller vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt und am folgenden Tage,
den 13. Juni morgens um 8 Uhr mitten im Dorfe Suhr, vor der Zehntenscheuer,
an einem Nussbaum aufgehängt, woran man ihn bis zum
15. Juni abends hängen liess, dann herabnahm und in der Stille begrub.»
Endlich kam auch die Armada Zwyers zum Zuge. Aber er begann
sehr schlecht: schon «der Marsch nach Sursee (am 9. Juni) wurde vom
Obersten Zwyer», wie Liebenau berichtet, «durch einen äusserst peinlichen
Auftritt verbittert, der sich unter den Truppen des Fürstabtes
von St. Gallen in Luzern ereignete». Es handelte sich um eine regelrechte
Meuterei der Toggenburger Truppen, die der Abt, gegen ihre
alten Volksfreiheiten, in den Dienst der Luzerner Herren gepresst
hatte und die zum Teil schon beim Ausmarsch aus St. Gallen rebelliert
hatten. «Als es sich nun um Vollziehung des Stanser Spruches und Entwaffnung
des Landvolks handelte, brach die der Regierung feindselige
Stimmung von neuem aus. Vergeblich mahnte Hauptmann Tschudi die
Leute von St. Gallen an ihren Eid, umsonst verwies er auf die Strafen,
die nicht ausbleiben könnten; selbst das Anerbieten des Soldes half
nichts. Die Leute sagten einfach: der Fürst gibt uns nichts; in eigenen
Kosten sind wir hergezogen; wir sind schon zu weit gezogen, wir wollen
heim.» Ein vornehmer Schwyzer Offizier, Leutnant Reding, wurde
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 588 - arpa Themen Projekte
rief die Menge: wir sch(m)eissen drauf. Ein kleines Männchen
stellte sich unter die Stiftslinde und rief: wer nicht nach Sursee will,
der komm her und halte die Hand empor. Und sofort lief der grosse
Haufen dem Kleinen zu. Die Offiziere und Fähnriche standen mit etwa
20 Mann allein, und als vom grossen Haufen noch einige Mann zur
Fahne stehen wollten, hinderten sie die Uebrigen und hielten sie mit
den Waffen zurück. Mit den Schwyzern sind wir hergekommen, mit
den Schwyzern wollen wir heim — rief die Menge.» Denn die Schwyzer
sollten eben entlassen werden, weil sie schlau genug waren, sich
ihre —durch bereits frühere Meuterei ausserdem sehr fragwürdigen —
«freundeidgenössischen» Dienste durch die Luzerner Herren teuer bezahlen
zu lassen! Kurzum, die Toggenburger zogen tatsächlich mit
den Schwyzern ab. Aber dabei hatten sie nicht mit den Schwyzer
Herren gerechnet: diese verweigerten ihnen nicht nur den Pass durch
ihren Kanton, «Landvogt Schorno warf die ärgsten Aufwiegler in
den Kerker, verwies die Rädelsführer des Landes und schickte am
18. Juni die Mannschaft nach Luzern zurück»! «Zum Glück für
die Regierung von Luzern», fügt Liebenau hinzu, «standen die zuverlässigen
Truppen von Zürich und Bern in der Nähe und die Bauern von
Luzern waren ganz mutlos...»
Trotz diesem unglückseligen Start also sandte die Luzerner Regierung
«General Zwyer auf dessen dringendes Verlangen zum Schutze
und zur Beruhigung des Landes mit 7 Kompanien nach Sursee und
Wykon, da dieser der Ansicht war, nur auf diese Art könne man der
Untertanen Meister werden». Am Tag dieses Ausmarsches selbst, am
9. Juni, setzte der Luzerner Rat «das Verzeichnis der zwölf Männer
fest, deren Auslieferung man begehren wollte». Denn «da Zwyer bei
der bevorstehenden Huldigung die Verhaftung der Rädelsführer ausführen
wollte, war Eile notwendig».
Mit gebührendem Interesse entnehmen wir übrigens dem Bericht
über diesen Auszug der etwa 2000 Mann Zwyer'scher «Ordnungstruppen»
zur Entwaffnung und Niederschlagung der Bauern den Satz:
«Eine dieser Kompanien führte Anton Marzell von Luzern, ein Rädelsführer
im Bürgerhandel.» So also konnten die Bauern damals in der
Schweiz sich auf die Bürger verlassen! Und das war ein Bürger, der
«bereits lange Kerkerstrafen und mehrfach Folterqualen erlitten«
hatte! Dabei hat ihn diese Henkerstat gegen seine früheren Bundesgenossen.
die Bauern, zwar vielleicht vor dem Schafott gerettet, auf
dem eine Reihe seiner Bürgerkollegen nicht lang danach den Kopf
verloren; denn tatsächlich hat in dem grausamen Prozess gegen die
Bürger zu Beginn des August «die gesamte Geistlichkeit um Begnadigung
des Kupferschmiedes Anton Marzell» gebeten. Dennoch ist dieser
immerhin «auf 6 Jahre aus der Eidgenossenschaft verbannt» und
ausserdem um 500 Gulden gebüsst worden...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 589 - arpa Themen Projekte
So «ganz mutlos», wie Liebenau meint, waren übrigens die Luzerner
Bauern doch nicht. Kurz nachdem Zwyers Armee in Willisau durchmarschiert
war, hatte dort der Luzerner Schultheiss Fleckenstein zwar
am 12. Juni den Stanser Spruch verlesen, die aus ihren Aemtern vertriebenen
Herrendiener wiedereinsetzen und die neue Huldigung vornehmen
können. «Als aber der Schultheiss das Städtchen verlassen
hatte, wollten Stadtrat und Sechser wieder eine neue Aemterbesetzung
vornehmen, und es bedurfte der ganzen Energie des dortigen Schultheissen,
dieses Beginnen zu verhindern.»
«Am 13. Juni setzte der Rat von Luzern», wie Liebenau erzählt,
«fest, zur Vollziehung des Stanser Spruches, Ablieferung der Waffen
und Kanonen sei in Schüpfheim eine nochmalige Gemeindeversammlung
am 14. Juni einzuberufen. Allein an diesem Tage war aus den Gemeinden
Escholzmatt und Marbach kein Mann zu finden, angeblich
wegen der Wachen an der Berner Grenze. Die Ablieferung der Waffen
wurde verweigert, die einen wollten die Knüttel in Kriens zurückgelassen
haben, die andern bemerkten, man brauche die Waffen noch gegen
die Berner und werde selbe später, abliefern. Trotzig erklärten die
Geschworenen: die verlangten Rädelsführer stelle man nur unter der
Bedingung, dass man sie an Leib und Leben sichere und wieder auf
freien Fuss stelle (!) Der Schulmeister von Entlebuch, der die Willisauer
mit einem Schreiben zur Fortsetzung der Rebellion ermuntert
habe, sei mit andern nach Unterwalden geflohen.»
In der Tat — «trotzig schrieben Landespannermeister, Landesfähnrich
und Geschworene von Entlebuch» schon unterm 10. an Stadt
und Amt Willisau: «Die Berner seien bis Lützelflüh vorgerückt und
wollen ins Land einfallen; wir haben deshalb nach Luzern geschrieben:
wenn ihr unsere Obern sein wollt, so seid uns behelfen und schirmt
uns.» (Da die Entlebucher natürlich wussten, dass die Berner Herren
die Bundesgenossen der Luzerner Herren waren, so bedeutet diese Zumutung
an die letzteren: entweder gebt das Bündnis mit den fremden
Herren auf und kämpft an unserer Seite gegen die fremden Truppen
— oder ihr seid Landesverräter und habt abermals alles Herrschaftsrecht
über uns verwirkt!) «Vergeblich haben wir die Obrigkeit ersucht,
auf die Auslieferung der 12 Rädelsführer zu verzichten. Wir fürchten,
sie wollen diese Männer selbst abholen. Thun sie das, so wollen wir
alle zusammen lieber sterben, ehe wir einen der Unsern hergeben...»
Das ist Geist von Hans Emmeneggers Geist! Solch eherne Solidarität
unter solchen Umständen zeigte sich jetzt nur noch bei den Entlebuchern.
Und nicht nur unter sich — sie feuerten auch «Willisau und
die andern Aemter» dazu an. Und nicht nur in den Grenzen Luzerns
wollten sie diesen Geist der Solidarität auch jetzt üben — vielmehr melden
sie Willisau und den andern Aemtern selbst jetzt noch: «Die
Bauern im Gebiet von Bern bitten um Hilfe und anerbieten Gegendienste»!
Und die Entlebucher wollten sich mit den übrigen Aemtern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 590 - arpa Themen Projekte
grossen Bauernbund selbst in dieser tragischen Stunde nicht nur treu
halten, sondern durch die Tat besiegeln!
Wahrlich — wie Liebenau formuliert — «die Hoffnung Zwyers,
das Vorgehen Berns gegen die Rebellen werde auch auf das Entlebuch
deprimierend wirken, war nicht in Erfüllung gegangen»! Darum beschloss
der Luzerner Kriegsrat bereits am 12. Juni: «da die Entlebucher
die Kanonen von Sursee und Wykon in ihr Land geschleppt und weder
diese, noch den Bundesbrief, noch die Rädelsführer ausliefern wollen,
so soll Zwyer mit 2000 Mann ins Entlebuch ziehen und auch die Züricher
und Berner um Hilfe mahnen. Zwyer hatte diesen Zug ins Entlebuch
als absolut erforderlich erachtet». «In der Nacht vom 12. Juni
hatten die Entlebucher zwar durch Verbaue sich gegen das Einrücken
der Truppen aus Luzern zu sichern gesucht; aber trotzdem war Zwyer
nach einer Besprechung mit Oberst-Wachtmeister Sonnenberg fest entschlossen,
einen der vier Pässe sofort zum Einmarsch ins Entlebuch
zu benützen, um dem ganzen Lande endlich die Ruhe zu verschaffen,
da es ihm nicht passend schien, die Unterwerfung des Entlebuchs erst
zur Zeit der im September üblichen Huldigung vorzunehmen. Er ersuchte
deshalb am 13. Juni General von Erlach, im Emmental gegen
das Entlebuch vorzurücken, damit der Widerstand rasch gebrochen
werden könne... Schon hatten die Entlebucher auch an der Berner
Grenze Schanzen aufgeworfen, um sich gegen einen angeblich (?) bevorstehenden
Einfall des Oberst von Diessbach sicherzustellen», das
heisst gegen Freiburger Truppen!
Denn auch die Freiburger Herrentruppen griffen jetzt ein, obschon
auch sie bereits, wie früher berichtet, durch Meuterei dezimiert,
inzwischen aber wieder aufgefüllt worden waren. Der freiburgische
Oberbefehlshaber Reynold hatte auf dem Murifeld Lager bezogen und
der Regierung von Bern das Anerbieten gemacht, «durch das Emmental
ins Entlebuch einzufallen». Denn er und seine Truppen waren katholisch,
und er mochte sich einbilden, deshalb leichter mit den Entlebuchern
fertig zu werden als General von Erlach. Dieser jedoch, der
sich solchen Ruhm nicht von Oberst Reynold wegschnappen lassen
wollte, schickte ihn «auf Befehl der Regierung von Bern, nach Steffisburg
und, den Thunersee entlang nach Oberhofen bis hinauf nach
Brienz, wo er überall die Rädelsführer verhaften und die Waffen sich
ausliefern liess», wie Vock berichtet. Reynold leistete also den bernischen
Henkern Handlangerdienste. Es blieb aber nicht dabei, wie wir
gleich sehen werden.
Inzwischen nämlich war Zwyer, wie es scheint mit beträchtlichen
Schwierigkeiten, ins Entlebuch eingerückt. Er «hatte schon am 14. Juni
eine Abteilung seiner Truppen mit mehreren Feldstücken von Sursee
nach Wolhusen vorrücken und dieses Dorf... besetzen lassen». Am
gleichen Tag erliessen die drei Generäle von Zofingen aus ein Manifest,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 591 - arpa Themen Projekte
falls diese nicht innerhalb zweier Tage die Waffen niederlegten» (nach
Peter). Am 17., eben von Zofingen zurückgekehrt, marschierte Zwyer
selber (nach Vock) von Sursee «sogleich mit 1400 Mann über Wolhusen
und Entlebuch nach Schüpfheim, wo er am 20. Juni eintraf und
auf der Stelle den Befehl erliess, dass alle Waffen bei hoher Strafe in
Zeit von 24 Stunden ausgeliefert werden sollen».
Die Entlebucher aber leisteten hartnäckigen passiven Widerstand!
Z. B. berichtet Liebenau: «In Schüpfheim wollten die Leute die Truppen
nicht bewirten, weswegen diese in die Häuser und Keller eindrangen
und Speise und Trank forderten», d. h. einfach plünderten, — obschon
dies Zwyer, nach Liebenau, «bei Strafe an Leib und Leben untersagte».
Denn auch Liebenau muss von «seinen unzuverlässigen Truppen»
sprechen, mit denen Zwyer das Entlebuch besetzte. Obschon also
dieser sich äusserst beeilt hatte, den Ruhm eines Bezwingers der Entlebucher
allein zu erobern, wurde er ihrer doch nicht allein Meister,
sondern musste schon während des Einmarsches selbst die fremden
Herrentruppen zu Hilfe rufen! Liebenau schreibt ausdrücklich: «Um
den Widerstand der Entlebucher zu brechen, rückten sowohl die Truppen
von Bern als von Freiburg ins Entlebuch ein.»
Was die Freiburger Truppen betrifft, so befanden sie sich eben
«auf der Rückkehr von Thun, wo sie das Volk entwaffnet und 18 Rädelsführer
gefangen hatten». Den Befehl, ins Entlebuch einzufallen,
«erhielten die Truppen vom Kriegsrat der 3 Städte», d. h. von den
Generälen Erlach, Werdmüller und Zwyer. Die Freiburger «besetzten
Schüpfheim» (! wo sie also Zwyer zu Hilfe kommen mussten) «und
Marbach, wurden aber von ihrer Regierung (am 22. Juni) heimgemahnt
und verliessen am 23. Juni das Entlebuch. Auch unter den Truppen
von Glarus, Appenzell und Thurgau wurde nach Berichten vom 24. Juni
der Wunsch nach der Heimkehr laut...»
Die «Heeresmacht» Zwyers drohte also am Unwillen der Soldaten
schmählich auseinanderzufallen. Dazu kamen Streitigkeiten zwischen
den Führern über die Einbringung der Rädelsführer. Rittmeister
Pfyffer verlangte die Stellung der 200 (oder mehr) Mann, «die von
Entlebuch nach Bern marschiert seien»; die Berner Befehlshaber verlangten
die 400 Berner heraus, «die ins Entlebuch aus dem Berner
Gebiet geflohen seien». «General Zwyer erklärte aber: da in den
Spruchbriefen hievon nichts zu finden sei, so verlange er nur 10 Entlebucher
und 20 Berner heraus, die sich vor die Obrigkeit zu stellen und
zu entschuldigen hätten. Allein diese Leute stellten sich nicht»! Auch
die Waffen lieferten sie nicht ab, oder nur altes, schlechtes Zeug: «Am
21. Juni wurden endlich die allerschlechtesten (!) Waffen abgeliefert,
und zwar in Entlebuch 230 Stück, in Schüpfheim 157 und in Escholzmatt
von 400 Waffenfähigen gar nur 136 Stück. Auf 4 Wagen wurden
diese ,Ueberwehren' nach Luzern geführt.»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 592 - arpa Themen Projekte
Ein einziger Rädelsführer fiel in Zwyers Hände, allerdings ein
kapitaler: Christian Schybi! «Am 21. Juni gelang die Gefangennahme
Schybis durch Hauptmann Keller; allein Zwyer kam dadurch in grosse
Verlegenheit (!) er fürchtete, der Gefangene werde ihm entwischen»!
So unsicher war der Herr General sogar seiner Wachmannschaft. Immerhin
«gelang» ihm auch die Ueberführung des schwer gefesselten
Schybi nach Sursee. Als es mit der Stellung der übrigen Rädelsführer
nicht vorwärts gehen wollte, «publizierte Zwyer am 23. Juni in
Schüpfheim folgenden Ruf: werden bis am Morgen Caspar Undernährer,
genannt Cäspi, der lange Zemp und Hinteruli — die drei
Tellen — (denn bald spielte der lange Zemp, bald der junge Stadelmann
den «Erni von Melchthal» unter den Tellen) — nicht ausgeliefert,
so erhalten die Gemeinden Schüpfheim und Escholzmatt eine
Einquartierung von je 300 Mann, deren jedem täglich ein Pfund
Fleisch, eineinhalb Pfund Brot und eine halbe Maass Wein verabfolgt
werden muss.» Jedoch auch diese Erpressung führte zu nichts. Denn
«durch zahlreiche Streifzüge durch das ganze Land hatte Zwyer die
versteckten Rädelsführer zur Flucht genötigt». Darum trat er «am 27.
den Rückmarsch nach Sursee an, nachdem er sich überzeugt hatte, dass
die Flüchtlinge nicht eingebracht werden können». Ein besonderes
Ehrenmal für die gesamte Entlebucher Bevölkerung, die ihre Führer
in abgelegenen Hütten versteckte, schützte, warnte und verproviantierte
und keinen einzigen verriet! Denn auch Schybi ist ganz gewiss
keinem Verrat — eher seinem bramarbasierenden Selbstbewusstsein —
zum Opfer gefallen; sonst wäre dies bestimmt von den Herrenchronisten
mit Pauken und Trompeten verkündet worden.
Der Misserfolg Zwyers war so eklatant, dass er sofort «mit der
Beendigung der Expedition ins Entlebuch sein Kommando niederlegen»
wollte, «zumal seine Wirksamkeit von mehreren Seiten scharfen
Tadel erfuhr». Doch liess er sich «auf inständiges Anhalten des
Rates von Luzern» umso schneller wieder herbei, sich noch für einige
Zeit «dem arg zerrütteten Vororte der katholischen Eidgenossenschaft
zu widmen», als «gerade während der Entwaffnung der Entlebucher
die Rothenburger mit den Rebellen im Kanton Bern zu Hüswil geheime
Besprechungen hielten und insgeheim gegen die gewalttätigen
Massregeln des Rates von Luzern in Zug, Schwyz und Unterwalden
durch Abgeordnete Klage führen liessen». Zwar war das Amt Rothenburg
in sich gespalten, sodass die Kapitulantenpartei sogar einen Rädelsführer,
unbekannt welchen, an Luzern ausliefern konnte; «aber
daneben bestand noch ein eigener Kriegsrat, der die Agitation leitete».
Darum drängte Zwyer sofort nach Wiederübernahme seines Amtes,
noch am 28. in Sursee, «auf die Verhaftung dieses Kriegsrates». Auch
diese scheint ihm aber missglückt zu sein.
Darum führte er nur noch das Blut gericht in Sursee zuende und
demissionierte dann endgültig: «Nachdem das Blutgericht in Sursee
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 593 - arpa Themen Projekte
nieder.» Das Einzige, dessen er sich dabei als Bilanz seiner Feldherrn-
Tätigkeit zu rühmen vermochte, war dies: «dass die Generale
Erlach und Werdmüller ins Gebiet von Luzern eingerückt wären,
wenn er (Zwyer) nicht die Truppen nach Sursee verlegt hätte»! Als
hätte er die Truppen Erlachs, aber auch die andern, nicht selber ins
Land gerufen! Und als wären die Erlach und Werdmüller Erbfeinde
nicht Bundesgenossen der Luzerner Herren gewesen! Aber sie waren
Protestanten — und so konnte Zwyer, dieser angeblich aufgeklärte
Katholik und Busenfreund des Basler Bürgermeisters Wettstein, hoffen,
sich durch diesen letzten demagogischen Kniff wenigstens bei den
ganz Schwarzen in Luzern ins Licht hohen geschichtlichen Verdienstes
zu rücken, das ihn der Nachwelt überliefern würde.
Vorläufig wurde ihm vom Luzerner Rat nur «das Bürgerrecht der
Stadt Luzern,... überdies noch eine goldene Kette samt goldener
Schaumünze geschenkt und ihm das während dieses Aufruhrs ausgelegte
Geld vergütet». Ein bisschen mehr ist es zwar gewiss gewesen.
Denn immerhin berichtet Liebenau: «Als Gratifikation wurden dem
Retter des Staates 100 Dukaten ...zuerkannt.» Ausserdem «wurde
Zwyer auf Betrieb Dullikers zum ,Stand- und Kriegsrat' ernannt, der,
wenn einberufen, nach dem Schultheissen Sitz und Stimme haben
sollte». Die Luzerner Aristokratie wusste also sehr wohl, wen sie an
Sebastian Bilgerim Zwyer von Evibach hatte, und sie beschloss daher
am 12. Juli in feierlicher Sitzung, es «zu ewigem Gedächtnis einzuschreiben»,
dass er «der selbigen zu Boden gesunkenen stand mit
sinem flyss, mühe, arbeit und grossen Industria auch fürsichtigen geschwindigkeiten
widerum ufgericht und in den alten löblichen vigor
gebracht»! Woran das Verdienst allerdings weniger den in jeder Hinsicht
verunglückten Feldherrnkünsten Zwyers, als vielmehr seinen
schon bis nach Ruswil zurückreichenden Uebertölpelungs- und Fälscherkünsten
den Bauern gegenüber zugeschrieben werden muss,
deren Früchte nun dank dem allgemeinen Umsturz der Verhältnisse
zugunsten der Herren heranreiften.
Auch viele andere, die den Herren gedient und die Bauern verraten
hatten, wurden nach und nach mit dem Luzerner Bürgerrecht
belohnt: so, um von zwei Dutzend nur ihrer drei zu nennen, die ach
so «neutralen Schiedsrichter» und «eidgenössischen Ehrengesandten»
von Ruswil und Stans, Martin Belmont, Landammann, und Michael
Schorno, Statthalter von Schwyz, sowie natürlich «die Säule des Vaterlandes»,
der Zuger Landammann und Landschreiber Beat Zurlauben,
der als «Gerichtsschreiber» jener falschen Richter die ständige
rechte Hand Zwyers bei dessen Uebertölpelungen der Bauern war.
«Andern bezeugte man», wie Liebenau naiv offen berichtet, «den Dank
dadurch, dass man ihnen zu einträglichen Stellen in italienischen
Vogteien verhalf, wie dem Landschreiber Carl Conrad von Beroldingen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 594 - arpa Themen Projekte
ausserdem, selbst nach Liebenau, «in ziemlich willkürlicher Weise, mit
Ausserachtsetzung der bisherigen Sitten und Gewohnheiten, die Aushebung
der Truppen in den ennetbirgischen Vogteien bewerkstelligt»
hatte. «Auch dem Landschreiber Zurlauben gab der Rat von Luzern
die Zusicherung, dass man einem seiner•Söhne die Landschreiberei in
den Freien Aemtern verschaffen wolle.» Kurzum, die Handlanger der
Herrengewalt, die am unbedenklichsten zur Ausschaltung des Volkes
beigetragen hatten, wurden honoriert. «Im grossen und ganzen aber
war man (in Luzern) sehr ungehalten über die kleinen Kantone, weil
dieselben auch für die bundesgemässe Hilfeleistung sich mehr als gut
bezahlen liessen. Man nannte sie deshalb in Regierungskreisen unersättliche
Harpyen. Und Schultheiss Dulliker trug erbittert in sein
Tagebuch ein: «Hätten wir dem Wasserturm (wo der Staatsschatz lag)
die Kappe nicht geschüttelt, so hätten wir Bündnis halber drauf gehen
können...»
Die Ehrung Zwyers war zugleich ein Triumph desselben, sowie
seines Freundes Dulliker, über den heimlichen Todfeind Zwyers, den
andern Schultheissen Fleckenstein. Der alte Raubgeier nämlich konnte
es Zwyer nie vergessen, dass dieser ihm einmal ein saftiges Werbegeschäft
über die Lieferung von viertausend Schweizersöldnern für den
Kaiser abgetrieben hatte. Andererseits konnte Dulliker es dem Fleckenstein
nie verzeihen, dass dieser ihn durch geheime Intrigen wiederholt
loszuwerden versucht hatte. Aber Dullikers und Zwyers Triumph
dauerte nicht lange. Als drei Jahre später Zwyer als Feldherr eines
katholischen Sonderbunds — im ersten Villmergerkrieg — gegen die
protestantischen Vormachte Bern und Zürich ins Feld zog, da tuschelte
es in seinem Rücken von Luzern aus in geheimnisvoller Weise in die
ganze Innerschweiz: Zwyer greife in landesverräterischer Absicht die
Zürcher gar nicht im Ernste an, und umgekehrt schonten die Berner
Zwyers Schloss Hilfikon, das in der Nähe des Schlachtfeldes lag, dafür
zum Danke. Und im Nu war der «Retter des Vaterlandes» — wie
der Geschichtschreiber Luzerns Kasimir Pfyffer schreibt — «von den
Kanzeln und öffentlichen Plätzen zu Luzern, Schwyz, Unterwalden
und Zug als ein Vaterlandsverräter und für vogelfrei erklärt, sogar
eine Belohnung von hundert Dukaten demjenigen versprochen, welcher
Zwyer tot oder lebendig einliefere.. Schultheiss Dulliker in Luzern
(aber) war von der Verrufung und Achtserklärung des Landammann
Zwyer so erschüttert und so sehr überzeugt, man habe ihm
Unrecht getan, dass er darüber krank wurde und starb.»
So überlebte der alte fromme Raubgeier Heinrich Ritter von
Fleckenstein Alle und Alles — als das versteinerte Symbol des Herren-Sieges
über die Bauern. Die mörderische Seele des aristokratischen
Molochs aber, der das beste Mark des Landes, seine Bauern- und Bürgerkraft,
frass, verrät uns niemand besser als der erzkatholische, erzreaktionäre
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 595 - arpa Themen Projekte
von Liebenau, der Luzerner Staatsarchivar Fürst Fürstenbergischer
Abstammung, selber, wenn er den vierundneunzigjährigen Fleckenstein
— den «liederlichen Beschützer aller heillosen Leute», wie ihn
sein Zeitgenosse, der Abt von St. Urban, nennt — mit den folgenden,
beinah revolutionären Worten schliesslich zu Grabe trägt: «Gelderwerb
war sein Hauptziel, obwohl er keinen Sohn hinterliess und Geld
im Ueberfluss besass. Er nannte diese unsaubern Erwerbsarten ,Nüsse
mit den Beinen herunterschlagen'. Wir begreifen (plötzlich!), dass zu
Stadt und Land sich die Opposition gegen eine Obrigkeit regen musste,
die von einem solchen Mann geleitet wurde. Aber unbegreiflich ist es
uns, dass sich Fleckenstein bis an sein seliges Ende 1664 in Aemtern
und Ehren behaupten konnte. Hier manifestierte sich die Macht der
Gewohnheit, des Geldes und der Einfluss, den die spanisch-kaiserliche
Partei in Verbindung mit der Nuntiatur und den Jesuiten ausübte...»
Doch nun müssen wir uns zum Schluss der blutigen Ernte zuwenden,
die alle Herren, treu vereint, unter den Bauern hielten, kaum
dass diese die Waffen niedergelegt hatten. Es handelt sich dabei um
einen reihum im gegenseitigen Wettbewerb geübten behördlichen
Massen mord an den besten Eidgenossen. Denn was da als «Justiz» aufgeboten
wurde, sei es in den kantonalen Kriegsgerichten in Sursee, im
Bernbiet und in Basel, oder sei es in den «eidgenössischen» in Zofingen
und Mellingen, das reichte, trotz zusätzlichen Aufgebots eines schmählichen
geistlichen Beistands, nur gerade zum Justizmord hin. Das war
nur noch das jämmerlich zerschlissene und zerfetzte Gewand des
Rechts, aus dem uns an allen Ecken und Enden geil und frech die
nackte Gewalt triumphierend anbleckt. Dies mit dem berühmten «Geist
der Zeit» beschönigen zu wollen, das hiesse nur «der Herren eignem
Geist», der zu keiner Zeit ein andrer ist, Henkersdienste zu leisten...
In der Abstrafung der «Rädelsführer» herrschte völlige Willkür
nach Masstab der Gewalt, die die Herren jedes einzelnen Kantons dafür
einzusetzen hatten. Das schwächste Regime und daher die «mildeste»
Abstrafung wies Solothurn auf. Es erhob nur saftige Bussengelder
von den Landleuten aller Amteien, so dass die Bussensumme
schliesslich die Kriegskosten fast doppelt einbrachte und die Regierung
mit dem Krieg also ein glänzendes Geschäft machte. Selbst Vock muss
zugeben, dass die «durch den Aufstand verursachten Kosten reichlich
gedeckt und ersetzt wurden» (49730 Kr. Einnahmen aus den Strafgeldern,
26000 Kr. wirklich bezahlten Kriegskosten). Dennoch müssen
wir anerkennen, dass Solothurn weder die Folter anwandte, noch Bluturteile
sprach und dass es sich auch gegen die Bluturteile der Zofinger
Henker-«Tagsatzung» aussprach. Aber die drei Generäle in Zofingen
liessen sich selbstverständlich von dem schwachen Solothurn
— das sie deshalb beschimpften, im Einverständnis mit den Bauern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 596 - arpa Themen Projekte
sowohl die gemeinsame eidgenössische Abschlachtung derjenigen Opfer,
über die sie sich in dieser Hinsicht einig werden konnten, wie auch
die kantonale Abschlachtung derjenigen Prachtsexemplare von Rädelsführern,
deren die einzelnen Obrigkeiten auf ihrem eigenen Gebiet
habhaft zu werden vermochten und von deren öffentlicher und möglichst
grausamer Hinrichtung sie sich den grössten Abschreckungseffekt
versprachen. Bern ging darin so weit, dass es sich vom «eidgenössischen
Recht» durch Barzahlung loskaufen wollte, um der
Rachegier hemmungslos frönen zu können! Tatsächlich machten in
Zofingen General Erlach und Generalauditor von Graffenried «den
Vorschlag, jene 50000 Pfund, die Bern im Murifelder Vertrage den
Bauern zu zahlen versprochen, den interessierten Regierungen anweisen
zu lassen». Dafür aber nahm der Berner Rat «die Rechtsprechung
über alle bernischen Rädelsführer, namentlich Leuenberger, für sich
in Anspruch und wollte ,den Mellinger Friedens-Tractat für einmal an
syn orth gestellt' wissen, das heisst ihn nicht anerkennen». (Peter.)
Sofort, am 19. Juni, waren daraufhin Waser und Hirzel, an der
Spitze einer hochansehnlichen Delegation, nach Bern geeilt, um den
dicken Happen von 50000 Pfund einzukassieren. Inzwischen aber
hatte es den Berner Rat bereits gereut, das Angebot gemacht zu haben;
denn die Berner Herren sahen, dass sie die Abschlachtung der
Bauern unter Ausschaltung des «eidgenössischen Rechts» auch gratis
hätten haben können. Der Berner Rat stellte sich also jetzt «auf den
Standpunkt, die hilfeleistenden Orte hätten nur ihre Bundespflicht
erfüllt» und erklärte, «unter keinen Umständen könnte sich der Berner
Rat dazu verstehen, der zürcherisch-ostschweizerischen Armee jene
50000 Pfund auszubezahlen, die Bern im Murifelder Frieden den
Bauern zu versprechen gezwungen war».
Da verfiel der schlaue Waser auf folgende Idee, wie er seinen
Herren ein Pfand für die entgangene Kontribution verschaffen könnte:
Er wand den Berner Herren das für diese scheinbar kostenlose «idealistische»
Versprechen ab, «dass Bern wenigstens den Lenzburgern,
da sich diese am frühesten zum Gehorsam erklärt hätten, die ,Concessionsartikel'
garantiere». Waser wahrte damit aber nicht nur das
moralische Prestige Zürichs, indem er wenigstens ein — wenn auch
jämmerlich (nur auf die Lenzburger) beschränktes — Stück des Werdmüllerschen
Mellinger Friedens rettete. Vielmehr wollte er sich diese
«Wohltat» von den Lenzburgern bar bezahlen lassen: «Er war entschlossen»,
berichtet Peter, «sich alsdann um Zahlung einer ,Kriegsanlage'
zugunsten der hilfeleistenden Orte an die Lenzburger zu halten...»
Was dann später auch weidlich geschah, unter immer neuer
Erpressung der armen Lenzburger und unter ständigen Versuchen,
aus Bern noch mehr herauszupressen, was zu endlosen Händeln
führte...
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 597 - arpa Themen Projekte
Doch wir wollen hier nicht die endlose Krämergeschichte der
Herren-«Eidgenossen» schreiben, die sich aus der Niederschlagung
des Volkes und besonders aus der Stickluft der Zofinger Henker-«Tagsatzung»
als Pestsaat erhob. Vielmehr haben wir hier nur noch
den dicken, roten —blutigen — Strich unter die Tragödie des schweizerischen
Bauerntums zu ziehen.
Den Anfang mit der langen Kette der Bluturteile hatte, wie wir
sahen, der Berner Junkergeneral von Erlach bereits während der
Kämpfe, zu Beginn des Juni, mit den wilden Exekutionen im Oberaargau
gemacht und sie dann in den Bluturteilen vom 20. Juni in Aarwangen
fortgesetzt; wozu er Vollmacht vom Berner Rat besass. Die
weitere Fortsetzung der blutigen Rache hatte inzwischen bereits auch
General Werdmüller, kurz nach der Waffenniederlegung der Bauern
aufgenommen, und zwar durch die mittelalterlich-abergläubische kantonal-zürcherische
Kriegsgerichtssitzung gegen die Mitte des Monats
in Suhr. In lückenlosem Anschluss war dann seit Mitte Juni von den.
beiden Generalen, unter Zuzug des dritten, Zwyers, die gänzlich von
ihnen beherrschte Henker-«Tagsatzung» in Zofingen aufgezogen worden,
die nur «eidgenössisches Recht» —blutiges Herrenrecht — sprach
und an die kantonalen Blutgerichte in Luzern, Bern und schliesslich
auch noch nach Basel weiterdelegierte. Der französische Gesandte in
Solothurn hatte also vollkommen Recht, wenn er über diese seltsamste
aller «Tagsatzungen» ironisch bemerkte: in Zofingen hätten nicht die
13 eidgenössischen Orte, «sonder 3 oder 4 Profosen (d. h. Henker)
sentenziert und gericht». Das von dieser «Tagsatzung», d. h. von den
drei Obergenerälen, eingesetzte Malefizgericht wurde präsidiert von
dem sehr ehrenwerten Spiesser unter den Werdmüllern, dem Generalfeldzeugmeister
Johann Georg Werdmüller, der soeben auch die Spiritistensitzung
des Suhrer Kriegsgerichts präsidiert hatte.
Am 1. Juli fielen, auf die Sentenz dieses «Gerichts», die Häupter
des wichtigsten bürgerlichen Rebellenführers Jakob Stürmli, des tapferen
Metzgermeisters von Willisau, sowie des feurigen Verkünders
des erweiterten Bauernbundes Hans Diener aus Nebikon. Sehen wir
uns die Urteilsbegründung an, wie sie der Herrenchronist Liebenau zusammenfasst:
«Metzger Stürmli und Diener waren beschuldigt, sie haben
am 21. Mai die Rothenburger zur Empörung verleitet durch das
unwahre Ausschreiben, die Berner hatten 10000 Mann in die Stadt
genommen; sie haben Leuenberger durch die Entlebucher ersucht, mit
ganzer Macht in Unterwaiden einzufallen; sie haben am 27. April die
10 Aemter ersucht, vom Wolhuser- und Sumiswalder-Bund nicht abzustehen;
sie haben mit (Fridli) Bucher und (dem Schulmeister) Müller
das Strafgericht aufgerichtet und harte Bussen ausgefällt; sie wurden
überhaupt als die bösesten Aufwiegler neben Bucher und Heller
(gemeint ist der Däywiler Bauer), als Teilnehmer an allen Bundesverhandlungen,
als Aufreizer an den Versammlungen in Schötz bezeichnet.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 598 - arpa Themen Projekte
die Kanonen herausverlangt, den Befehl zur Zerstörung von Kasteien
gegeben, Anordnung zum Bartscheren gegeben und das Geld in Empfang
genommen, das die Bartscherer erpresst hatten.» Liebenau fügt
hinzu: «Mehrere dieser Klagen konnten allerdings nicht bewiesen werden;
aber Personen, denen man Kenntnis der Vorgänge zutraute (!)
und mehrere Gefangene (!) brachten solche Beschuldigungen (!) vor.»
Kommentar überflüssig.
Jedenfalls aber war Jakob Stürmli in den Augen der Herren der
Mann, der (wie es bei Cysat-Wagenmann heisst) «alle Gewalt und
das oberste dominium in der Grafschaft Willisau an sich brachte».
Hans Diener war in ihren Augen ein «fanatischer Prophet» des
Bauernbundes. Das genügte. Ausserdem stand Jakob Stürmli in den
martervollen Verhören glänzend seinen Mann. Er leugnete nichts und
sagte den Herren trotzig ins Gesicht: jawohl er sei es gewesen, der mit
den Willisauern und den Entlebuchern «sich entschlossen, den Kleinen
Räthen (der Regierung) weder Zinns noch Zahlung ze geben,
sonder, wo sy in die Statt (Luzern) kommen mögen..., alle die Kleinen
Rath umb das laben bringen, us der Statt ein Flecken machen und die
vier Ort (die 4 bäuerlichen Urkantone) zu schirmbherren nemen wollen...»
Item, so berichtet Vock: «Am 1. Juli nachmittags zwischen 1 und
2 Uhr wurden Jakob Stürmli und Hans Diener von Zofingen auf die
Grenze des Kantons Luzern geführt und dort enthauptet und begraben.»
Dies, wie Liebenau bezeugt, «auf Wunsch der Delegierten von
Luzern», aus purem «christlichen» Mitgefühl, damit sie auf katholischer
Erde sterben und in ihr ruhen konnten. «Ihre Köpfe aber wurden
auf dem Hochgericht zu Sursee aufgesteckt.» Gleichzeitig wurde
Jakob Sinner von Richenthal, dem tapferen Bauernführer des Bürener
und Trienger Amtes, die Zunge geschlitzt...
Am 2. Juli kam der solothurnische Untervogt Adam Zeltner von
der Schälismühle unters Richtschwert, und das hatte eine besondere
Bewandtnis. Wir wissen ja, welch ein treuer Diener seiner Herren
zu Solothurn der Schälismüller war; wie er schon auf und seit der
grossen Sumiswalder Landsgemeinde alles getan hat, um die Solothurner,
ja die allgemein schweizerische Rebellion zu verhindern, wie
er sie als Kapitulant, ja als Vertrauensmann der Regierung selbst,
ständig an diese verriet. Kein Wunder, dass die Solothurner Herren
sich mit Händen und Füssen für ihn wehrten und sogar den französischen
Gesandten zur Intervention zu seinen Gunsten bewogen.
Schliesslich haben sie aber doch den Drohungen der Berner und Zürcher
Henker in Zofingen — «etwas Unliebs mit seinem Unwillen vorzunemmen»,
drohte beispielsweise der General von Erlach nachgegeben,
ihn dorthin ausgeliefert und die Hände in Unschuld gewaschen.
Die Solidarität der Herrenklasse war doch zu stark, und diese erforderte
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 599 - arpa Themen Projekte
eines Einverständnisses mit den Bauern bezichtigten Solothurner Regierung.
So ist der arme Teufel Adam Zeltner als Opfer — als auch
im strengsten damaligen Herrensinn unschuldiges Opfer — der puren
Rache seitens der stärkeren Herren an den schwächeren gefallen. Eine
andere Begründung des Todesurteils ist nirgends zu finden, (ausser
dass Zeltner im Jahre 1632! mitschuldig gewesen sein soll an einem
Ueberfall auf Berner Soldaten in der Klus, wobei ihrer zwei getötet
worden waren). Johann Georg Werdmüller entschied — bei Stimmengleichheit
— persönlich für den Tod Adam Zeltners.
Nichts vermochte die «eidgenössischen Gesandten» in Zofingen,
die wirklichen Führer der damaligen schweizerischen Herrenklasse,
zu erweichen, wo es galt, einen vermeintlich abtrünnigen Teil dieser
Klasse einzuschüchtern und zur Klassensolidarität zu zwingen. Am
Nachmittag des Vortages «lief die hochschwangere Frau des Untervogts
Adam Zeltner mit ihren 6 Kindern bei den Eidgenössischen Gesandten
herum, flehte kniefällig und unter heissen Tränen um die Rettung
ihres Mannes und anerbot dafür Hab und Gut; sie fand aber kein
Gehör». So berichtet Vock. «Am 2. Juli morgens um 6 Uhr ward Adam
Zeltner auf die 'Wiese oberhalb des Hochgerichts bei Zofingen hinausgeführt
und daselbst enthauptet.» Diesem Katholiken glaubte man
nicht einmal die Rücksicht schuldig zu sein, die man gegenüber den
beiden Luzernern, bezw. gegenüber der Luzerner Regierung, walten
liess: auf katholischem Boden zu sterben; denn er war der Diener einer
schwachen Regierung. Gleichzeitig wurde dem Jakob von Arx von
Niederbuchsiten wie nachher noch so vielen andern, die Zunge geschlitzt...
«Viele andere Luzerner, Solothurner und Aargauer Bauern» wurden
in Zofingen, wie Vock berichtet, «zum Zungen- oder Ohrenschlitzen,
zu lebenslänglicher oder mehrjähriger Verbannung aus der
Eidgenossenschaft, zum Auspeitschen» und natürlich zugleich immer
zu hohen Geldbussen verurteilt, die die Herrenklasse bereichern, die
Bauernklasse in deren ewige Fron bringen sollten. Zahlreiche Bauern
wurden von den Zofinger «Richtern» «peinlich» verhört, d. h. in unmenschlicher
Weise gemartert, um ihnen Aussagen zu erpressen. Dies
diente den «Ehrengesandten » der verschiedenen Kantone hauptsächlich
dazu, Anhaltspunkte für die Verfolgung, Verhaftung, Marterung
und Hinrichtung der Bauernführer in ihren eigenen Kantonen zu gewinnen.
Darum, einzig darum, hielten sie auch mit der «Lieferung»
ihrer eigenen Rebellen an das Zofinger Malefizgericht zurück — sonst
wäre dessen blutige Ernte eine noch ganz andere gewesen. Luzern
beispielsweise verhinderte die Auslieferung zahlreicher Bauern nach
Zofingen deshalb, «um die Schuld der 13 Bürger (Luzerner Stadtbürger)
zu ermitteln, die mit den Bauern konspiriert hatten», und die sie
auf diese Weise, d. h. durch eigene Aussagenerpressung mittels endloser
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 600 - arpa Themen Projekte
lieferte überhaupt keinen einzigen Berner Bauern aus dem Altbernbiet
nach Zofingen aus, weil es vorhalte: 1. seine alle andern überragende
«Souveränität» und seine Wurstigkeit gegenüber dem «eidgenössischen
Recht» knüppeldick zu demonstrieren; 2. im Wettbewerb um die Zahl,
die Grausamkeit und die finanzielle Ergiebigkeit der «exemplarischen»
Abstrafungen unbedingt den Vogel abzuschiessen.
Gleichzeitig amtete übrigens auch in Mellin gen, und anschliessend
in Bremgarten, wo 24 Freiämtler Bauern abgestraft wurden, ein «eidgenössisches
Blutgericht, beidesmal präsidiert vom Zürcher Bürgermeister
Waser und dem Zürcher Obersten Ulrich. Auch Zürich setzte
also sein eigenes Blutgericht durch. Ihm fielen am 7. Juli der Fähnrich
Hans Rast von Rothenburg, als ein «Sonderbarer Uffwigler», sowie
zwei ungenannte Freiämtler Bauernführer zum Opfer. Sie wurden
alle drei gehängt. Hans Rast hatte die Dummheit begangen,
auf die Aufforderung des Generals Werdmüller an die Bauern nach
dem «Sieg» bei Wohlenschwil (sich wohlzuverhalten und heimzuziehn
und dadurch sich seinen Schutz zu verdienen) mit soldatischer
Offenheit und mit voller Unterschrift dem General zu melden,
die Rothenburger seien dessen Aufforderung nachgekommen und erwarteten
nun die Erfüllung seiner Zusage. Also wurde Hans Rast auf
Befehl Werdmüllers sofort verhaftet, nach Mellingen geführt und dort
um seinen aufrechten, aber zu treugläubigen Kopf kürzer gemacht.
«Viele andere wurden», nach Vock, auch in Mellingen «mit grossen
Geldbussen oder mit körperlicher Züchtigung bestraft, einige zu weitern
Verhören nach Baden ins Gefängnis geschickt.»
Unter den «körperlichen Züchtigungen» figurierten das «mit Ruten
streichen», das «Zungenschlitzen» etc. Unter den Gezüchtigten war
auch Georg Lüthi, der harmlose Zuschauer beim Auszug der Zürcher
Armee auf der Schlierer Allmend, der zum «Bauernspion» erklärt worden
war.
Doch nun zu den Hauptführern der Bauernbewegung! Sie sind —
mit Ausnahme Jakob Stürmlis — in fast ununterbrochener Reihe die
Opfer der kantonalen Blutgerichte geworden, sofern sie nicht zu flüchten
vermochten. Aber selbst die Geflüchteten sind, nach vielen Monaten
des Verborgenseins in den Wäldern und Bergen oder des Herumirrens
in fremden Ländern, infolge der unausgesetzten Fahndung
und des innigen Zusammenspiels der Herrenklasse von Land zu Land,
schliesslich doch fast ausnahmslos dem Schwert oder dem Strang der
heimischen Herren zum Opfer gefallen.
Für Luzern tagte ein besonderes Kriegsgericht in Sursee, zuerst
unter der Oberleitung Zwyers, nach dessen Demission, d. h. seit der
Hinrichtung Schybis am 7. Juli, unter dem Präsidium Kaspar Pfyffers
(der aber auch vorher, unter Zwyer, amtete), Landvogt und Kleinrat,
Mitglied der Luzerner Regierung, der dabei, ausser von einigen anderen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 601 - arpa Themen Projekte
wurde. Dieses «Gericht» war also ein ausgesprochenes Privileg
einer der mächtigsten Luzerner Patrizierfamilien. Dass Zwyer abdankte,
hat seine Grunde — ausser in den militärischen Misserfolgen —
auch einerseits in der Eifersucht der Luzerner Herren auf die Macht
und den «Ruhm» des Urner Gewaltigen, andererseits in Zwyers Unzufriedenheit,
dass der Luzerner Rat ihm den Blutbann für dieses Gericht
nicht anvertrauen wollte. Zwyer schüttete seine Enttäuschung darüber,
dass auf diese Weise nach seiner Ansicht alles zu «milde» ablaufen
werde, in für ihn höchst charakteristischer Weise in einem
Brief an den Zürcher Bürgermeister Waser bereits am 18. Juni aus:
«...wenn man in den Städten das verrückte nicht wieder einrichtet,
so ist alles umsonst. Ich besorge übel, übel, es sei nicht allein in der
Stadt Luzern, sondern es sei auch in der Stadt Bern nicht alles richtig
und gesund...» Da der Brief nach Bern gerichtet ist, wo sich damals
Waser aufhielt, kann er nur den Sinn gehabt haben, ausser Zürich
auch Bern (als ob das vonnöten gewesen wäre!) im Scharfmacherkurs
aufzufeuern und auf diesem Umweg Zwyers eigene Stellung dem Luzerner
Rat gegenüber zu stärken.
Aber auch in Luzern war Zwyers Scharfmacherei völlig überflüssig;
es fragte sich nur, wer sie hier ausüben sollte. Und das war der
Luzerner Rat selbst, der seine Strafgewalt auf die allerextensivste Weise
auslegte: «Der Rat von Luzern», sagt der Herrenchronist Liebenau,
«war fest entschlossen, nicht nur die 12 Rädelsführer zu strafen, sondern
auch diejenigen, die nach dem Spruche von Ruswil und nach
dem Stanser Frieden Exzesse begangen und das Volk aufgewiegelt
hatten. Nach dem Beschlusse des Kriegsgerichts in Zofingen musste er
zudem diejenigen ausliefern, die in Bern geplündert, Schlösser zerstört
und den Zug nach Mellingen mitgemacht hatten.» Zwar «geplündert»
und «Schlösser zerstört» hatte in Bern überhaupt niemand; aber das
gehörte zu den Greuellügen der Herren aller Kantone, die sie vielen
Hunderten von gequälten Gefangenen durch unablässig angewandte
Martern aufsuggerierten, bis diese selbst sie, um nur der Qual ein Ende
zu machen, «zu Protokoll» gaben: und das wurden dann die «geschichtlichen
Quellen» für unsere modernen Herrenchronisten.
«Die Verhöre», berichtet Liebenau, «begannen in Sursee am 14. .Juni
und wurden dort bis zum 12. Juli fortgesetzt. Vor diesem Gerichte erschienen
fast alle Delegierten der 10 Aemter, diejenigen, die vor Räten
und Landsgemeinden die Sache der Bauern vertreten hatten» (denn
schon das war in den Augen der Herren ein «Verbrechen»!), «die
Hauptleute, Leutenants und Fenner der Bauern-Horden (!!), die nach
Bern und Mellingen gezogen waren, die berüchtigten Bartscherer und
die Exekutoren des Kriegsrats der Bauern.» Das Kriegsgericht in Sursee
war nach Liebenau in allen schweren Fällen «nur Untersuchungsbehörde,
wendete aber nach damaliger Sitte (!) auch die Folter zur Ermitteilung
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 602 - arpa Themen Projekte
nun Liebenau eine ausgedehnte Rechtfertigung dieser von seinem
Heros umso ausgiebiger angewandten Brutalitäten: «Von der
Folter wurde in allen Kriminalprozessen seit Jahrhunderten der ausgiebigste
Gebrauch gemacht; sie diente nicht nur der Erpressung
sondern auch (!) zur Bestätigung der freiwilligen (!) Geständnisse und
wurde» (welche faustdicke Lüge unseres Herrenchronisten!) «ohne
Ansehen der Person gehandhabt... Die Anwendung der Folter gegen
die Rädelsführer der Bauern war also durchaus keine exceptionelle
Massregel...» Nein, das war sie wirklich nicht! Dabei ist es für Herrn
von Liebenau ein Trost, dass «über 10 Verhöre... nicht vorgenommen»
wurden, bei jedem einzelnen Bauern, von «gegen 300 zeitweise in Gefangenschaft»
Liegenden; darunter auch «76 Mann aus der Grafschaft
Lenzburg, die am Treffen von Gisikon teilgenommen hatten».
«Von den 32 Bartscherern wurden die meisten auf 2 Jahre ehr- und
wehrlos erklärt; hablichere wurden um 200 bis 800 Gulden gestraft;
der Henker musste ihnen den Bart scheren und die Wehre abbrechen;
dazu mussten sie die Turmkosten bezahlen.» Vier oder fünf Bartscherer
wurden «auf die Galeeren verurteilt», von denen es gewöhnlich
keine Heimkehr mehr gab, «andere mit dem aufgebrannten L
an der Stirne gezeichnet, andere mit Halseisen und Bartscheren bestraft».
Liebenau muss jedoch hinzufügen: «Allein als der Henker gegen
die Bartscherer vorgehen wollte, wurde er von ,grossem Concours
des Volkes attaquiert'.» Auch die «Anführer beim Zuge nach Bern und
Mellingen wurden mit Galeerenstrafen auf 4 bis 6 Jahre bestraft»; so
sollten beispielsweise der Weibe! Hans Emmenegger von Schüpfheim,
ein Vetter des grossen Bauernführers, Boley Christen von Hasle,
Josef Portmann, der Weibel von Escholzmatt, Hans Ackermann, ebenfalls
Weibe! von Schüpfheim, «6 Jahre gegen die Türken kriegen».
Einer, Hans Wendeler, genannt «Fürabend», «wurde 4 Jahre nach
Dalmatien geschickt, weil er dem Landvogt Moor und Weibel Wüest
die Fäuste unter die Nase gehalten hatte»! Andere wurden wegen «Bedrohung
des Landammanns Zwyer» (!) verurteilt. «Michael Müller
von Altbüron, Kommandant beim Zuge nach Bern, sollte, die Hände
auf den Rücken gebunden, der Exekution gegen Schybi zusehen (!)
und auf Zwyers Gnade oder Ungnade (!) auf die Galeeren geschickt
werden» usw. usw.
Vor allem auch mussten sämtliche Verurteilten ausserdem selbst
für die geringsten Vergehen (wie auch nur passive Teilnahme an einer
Bauernversammlung) Bussen über Bussen bezahlen, 200 Gulden, 300,
600, 1000, 3000, 4000 Gulden, so viel eben in jedem einzelnen Fall
mit Aussicht auf Erfolg zu erpressen war. Den «Lästermäulern» wurde
«die Zunge geschlitzt oder ein Nagel durch die Zunge geschlagen»,
weil — wie es in mehreren Urteilen steht — «die Empörung der Regierung
zu Luzern» darüber sehr gross war, dass diese «Lästermäuler»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 603 - arpa Themen Projekte
Augen «von ganz Europa» geschadet hätten! Ja, man ging so weit —
wie Zwyer am 10. Juli zynisch offen an Waser berichtete —, auch ganz
unschuldige Leute «nur des Schreckens halber» vor das Kriegsgericht
in Sursee zu zitieren und dort gefangen zu setzen. Mithin reiner Terror.
Uebrigens — eine Milderung, ja oft gänzliche Aussetzung des Urteils
oder des Strafvollzugs gab es: die Bestechung! Man nannte das
beschönigend «Empfehlungen». Gewiss, es gab auch viele ehrliche
Empfehlungen, d. h. oft rührende Bemühungen Einzelner, z. B. der
Nidwaldner Regierung (Bittschreiben vom 16. Juni an den Luzerner
Rat zugunsten aller 12 inkriminierten «Rädelsführer»), beim Luzerner
Rat oder beim Kriegsgericht in Sursee Fürbitte einzulegen, entweder
für Einzelne oder auch für alle Angeklagten insgesamt. Ein Beispiel
für diese letztere Art, und vielleicht das bemerkenswerteste, ist die Eingabe
des Zuger Landammanns Peter Trinkler vom 5. Juli, zu deren Unterstützung
er auch den Schwyzer Reding und den Urner Arnold zu
bewegen vermochte und die er durch den Schwyzer Landschreiber
Ceberg beim Luzerner Rat einreichen liess. Bemerkenswert daran ist,
dass es lauter Vertreter von Bauernkantonen waren, die die angeklagten
Luzerner Bauernführer vor Richtschwert und Galgen oder vor
ihrer wirtschaftlichen Vernichtung zu retten versucht haben. Nimmt
man die Bittschrift der Nidwaldner Regierung hinzu, so sind sämtliche
vier urschweizerischen Bauernkantone bei diesem edlen Bemühen vertreten
gewesen! Peter Trinkler war, wie wir früher sahen, schon während
der Rebellion selbst stets der mutigste Anwalt der Bauernsache
und der einzige Regierungsmann gewesen, der die bauernfreundliche
Bewegung in den Urkantonen anführte. Er war darum damals der in
der ganzen schweizerischen Herrenklasse bestgehasste und vom schweizerischen
Herrenklub in Baden, der Tagsatzung, am gehässigsten verleumdete
und verfolgte Mann, und er ist deshalb auch bis auf den
heutigen Tag der von den Herrenchronisten meistgeschmähte Mann
geblieben. Umso ehrenvoller für Trinkler und umso verpflichtender für
uns, festzustellen, dass dieser aufrechte Volkstribun auch nach dem
Zusammenbruch der Bauernsache, als jede Spekulation auf ihren Sieg
auf Menschengedenken ausgeschlossen war, den Bauern die Treue hielt!
Solche ehrlichen Empfehlungen aber waren bei den Luzerner
Herren — und ganz gleich bei allen andern Schweizer Herren — völlig
in den Wind gesprochen. Nur solche «Empfehlungen», denen dicke
Geldpakete oder Gültenverschreibungen beigefügt waren, konnten, sogar
in «schweren» Fällen, auf Erfolg rechnen. Selbst Liebenau muss
schreiben: «Die Räte von Luzern waren jetzt für die Empfehlungen
durchaus nicht unzugänglich; es hiess auch später, der und jener habe
durch ein schönes Geschenk an einflussreiche Ratsherren sich vor einer
strengen Strafe bewahrt. Selbst gegen sehr kompromittierte Personen
übte man Gnade.» Liebenau gibt eine ganze Reihe von Beispielen. «So
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 604 - arpa Themen Projekte
Land als sehr reicher und sehr ehrgeiziger Bauer bekannter Mann, der
auf eine führende Rolle bei einem Umsturz spekuliert hatte und deshalb
in Herrenspottliedern verhöhnt worden war, ein Mann, der auf
der Liste der 12 zum Tode zu verurteilenden Bauernführer gestanden
hatte — «als Freund der Kapuziner begnadigt und um 4000 Gulden
gestraft; auch ehr- und wehrlos erklärt.» Als am 5. Juli Hans Amrein,
«der reiche Bauer von Holdern» — ebenfalls ein Mann, der auf der
Todesliste gestanden hatte — «vor Gericht stand, wurde geltend gemacht,
dieser habe sich nur gezwungen dem Aufstande angeschlossen,
habe früher einen ,feinen', redlichen, unklagbaren und ehrbaren Wandel
geführt...» Auch er wurde zu der saftigen Busse von 4000 Gulden
und dann immerhin noch zu 10 Jahren Kriegsdienst verurteilt. Auch
der Sternenwirt von Willisau, Hans Ulrich Amstein, der, ungleich
Stürmli, zum Kapitulanten geworden war, wurde auf Grund von solchen
«Verehrungen» an «hohe Standespersonen» am 5. Juli «für zehn
Jahre auf die Galeeren» «begnadigt», «wo er auch starb». «Rätselhaft
bleibt uns», so meint Liebenau über einen andern Fall, «wie Ammann
Gassman von Eich, der zuerst» (und zwar anstelle des vorerwähnten
Hans Amrein) «als einer der zwölf an den Rat auszuliefernden Rädelsführer
bezeichnet war, nicht nur ungestraft, sondern auch im Besitz
von Amt und. Würden, ja selbst im Genusse eines vom Staate abhängigen
Mannlehengutes verblieb. Ein Rechnungs buch des Schultheissen
Fleckenstein hätte vielleicht dieses Geheimnis offenbaren können»!
Man muss fast auf den Gedanken kommen, dass solche reichen Bauern
von Anbeginn an nur zu dem Zweck auf die Todesliste gesetzt wurden,
um sie bis zum Höchstmass erpressen zu können! Regierte doch der
krasseste Geiz und die schamloseste Habgier in Person — nämlich in
der Person desjenigen, von dem Liebenau nur wenig später feststellt:
«In dieser Zeit mag der reiche Schultheiss Fleckenstein seine verborgenen
Schätze und Gelder wieder ausgegraben haben. Dabei war ihm
sein Privatsekretär Franz Pfleger behülflich, der bei diesem Anlass
8000 Gulden in Gold unterschlug.»
Inzwischen schritten die Luzerner Herren zum Hängen und Köpfen
aller wirklichen Bauern führer, deren sie hatten habhaft werden können.
Der erste war Hans Krummenacher, der Weibe! des Dorfes Entlebuch,
der am 3. Juli in Luzern geköpft wurde. Dieser, der den Spitznamen
«Grosshans» trug, ist nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter
Hans Krummenacher dem «Fuchs», Weibe! von Schüpfheim.
Nicht jener, sondern dieser war der weitherum berühmte «stärkste Eidgenoss»,
der erste Schwinger und Steinstosser an den St. Michelsfesten.
Nicht der «Grosshans», sondern der «Fuchs» stand auf der Todesliste
— und möglicherweise ist der «Grosshans» nur als Opfer einer Verwechslung
geköpft worden. Denn selbst der Luzerner Lokalhistoriker
Liebenau, der auch das winzigste Detail, das ihm in den Weg lief, aufzeichnete,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 605 - arpa Themen Projekte
er sei «wegen seiner Drohworte und beständigen Volksaufreizung hingerichtet»
worden.
Dem bedeutenderen, Hans Krummenacher dem «Fuchs», einem
der «drei Teilen», gelang es, seinem Spitznamen Ehre machend, zu
flüchten; und er sandte von der Flucht bereits am 16. Juni einen wohlgesetzten
Brief an seine Richter nach Luzern, d. h. an diejenigen von
ihnen, die er allein als solche anerkannte, nämlich an die «Herren
Ehrensätze aus den IV alten katholischen Orten löblicher Eidgenossenschaft»,
worin er ihnen mitteilte, dass er es, von Freunden gewarnt,
vorgezogen habe, dem Befehl der Herren in Luzern, sich zur Abstrafung
zu stellen, nicht zu gehorchen, «sondern, zu Vermeidung solcher
Drangsal und Strafe, mich auf eine Wallfahrt begeben und die Herren
schriftlich berichten wollen...». Er floh zuerst nach Rheinfelden; im
Herbst, als infolge des neuen Aufstandes im Entlebuch nach ihm gefahndet
wurde, ins Ausland. Trotz immer erneuter Auslieferungsverlangen
der Luzerner Regierung bei den Reichsbehörden, lebte Hans
Krummenacher lange Zeit unbehelligt in der Reichsstadt Colmar. Keine
«Ediktalladung», noch auch ein Kopfpreis von 400 Gulden fruchteten,
kein Spitzel spürte ihn auf, sodass die Herren ihn noch im Jahr 1661
in contumaciam «zum Vierteilen» verurteilen mussten... Bis der Siebzigjährige
im Jahr 1682, von Heimweh getrieben, nach dem Entlebuch
zurückkehrte und von der Regierung, auf flehentliches Bitten
des gesamten Entlebuchs und der Geistlichkeit, wenigstens von der
Todesstrafe begnadigt wurde. «Krummenacher sollte aber, als ein
ehr- und wehrloser Mann erklärt, zeitlebens in dem Hause seiner Frau
bleiben, dasselbe nur zum Besuche des Gottesdienstes verlassen, mit
niemandem irgendwelche Korrespondenz unterhalten und kniefällig
die Regierung um Verzeihung bitten...» So lebte der letzte der «drei
Teilen» als ein Schatten seiner selbst und des längst versunkenen
letzten Bauernkriegs der Geschichte noch bis ins nächste Jahrhundert
hinein: «Dreiundneunzig Jahre alt starb der alte Verschwörer Krummenacher
im Jahre 1705 in seinem Hause beim Kapuzinerkloster
Schüpfheim als der letzte der einst so gefürchteten Demagogen des
Entlebuchs...»
Am 5. Juli 1653 wurde in Luzern Fridolin Bucher, der Bauer auf
Steinern zu Hilferdingen im Amte Willisau, zum Strang verurteilt und
noch am selben Tag gehängt. Er hat vom 12. Juni bis zum 5. Juli im
Wasserturm zu Luzern gesessen; «für seine Verköstigung wurden täglich
1 Gulden 6 Schillinge bezahlt». Er scheint die letzten Tage also
nicht ganz übel gelebt zu haben, vorausgesetzt, dass das gute Geld
wirklich für sein Essen ausgegeben wurde. Fridli Bucher war überhaupt
ein sanguinischer Lebensgeniesser; wie das in der Sprache der
damaligen Herren (nach Cysat-Wagenmann) heisst: «ein junger, frecher,
ehrgeiziger Mann», «ein sonderbarer Huorenbuob und Tröler»,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 606 - arpa Themen Projekte
lebte gerade er «im Volksliede lange noch fort»; ja er wurde «später
vom Volke als ein Heiliger verehrt», wie Liebenau bezeugt. Noch im 19.
Jahrhundert ging, aller historischen Wahrscheinlichkeit zum Trotz,
eine «alte Volkssage, nach welcher die Kapelle Philipp Neri bei der
Emmenbrücke die Stelle des alten Hochgerichtes einnimmt, wo Fridolin
Bucher ,unschuldig' hingerichtet wurde». Zwar soll es — wie
Liebenau zitiert und kommentiert — gerade Fridli Bucher gewesen
sein, «der zuerst bei der Bestrafung der Rädelsführer leer ausging ,wegen
seiner Verehrungen so er einer Standesperson (offenbar Schultheiss
Fleckenstein) thate'...». Dem widerspricht allerdings schnurstracks
ein zeitgenössisches Herrenspottlied des Luzerner Patriziers
Konrad von Sonnenberg auf Fridli Bucher:
«Dem Schultheiss gab er bösen Bscheid,
Ganz frech, ganz unbesunnen.
Der Galgen ist dir schon bereit,
Die Schuld gib diner Zungen.»
Vielleicht löst sich der Widerspruch aber, wenn man annimmt, der
Schultheiss habe das Weggli und den Fünfer gewollt, der Fridli Bucher
sei darüber aufgebraust — und habe dann dafür den Tod erlitten!
Dem Herrenstil von damals, insbesondere dem Luzerner Stil des
Ritters Heinrich von Fleckenstein, würde diese Darstellung jedenfalls
vollkommen entsprechen. Dem zwiespältigen Charakterbild Fridolin
Büchers übrigens ganz ebenso...
Am 7. Juli rollte in Sursee der Kopf eines ganz Populären in den
Staub, Christian Schybis, der vom Volk bis auf den heutigen Tag als
einer der drei grossen Führer im Bauernkrieg verehrt wird und dessen
Bild man daher noch heute in Dorfwirtschaften des Entlebuchs und des
Emmentals antreffen kann. Am 21. Juni war er durch einen Haupt
mann Zwyers im Entlebuch verhaftet und alsdann unter äusserst
starkem Geleit nach Zofingen gebracht worden, wo er am 26. Juni
eintraf. Er wurde jedoch bereits am 28. Juni, «nach einigen Verhören,
nach Sursee geführt, um auf Luzernischem Boden abgestraft zu werden».
Denn diesen kapitalen Hirsch wollten sich weder Zwyer, noch
der Rat von Luzern entgehen lassen. Sie beeilten sich umsomehr, ihn
wieder in die Hand zu bekommen, als plötzlich Bern mit dem Verlangen
auftrat, Schybi zur Konfrontierung mit dem gefangenen Leuenberger
nach Bern ausgeliefert zu bekommen!
«Zu Sursee», erzählt Vock, «wo nebst Schybi noch viele andere
Luzerner Bauern im Gefängnisse lagen, setzte das dort unter Ratsherrn
Kaspar Pfyffers Vorsitz aufgestellte Standgericht die Verhöre
mit den Gefangenen tätig fort.» Sehr tätig in der Tat! «Der grosse,
starke Mann», sagt Liebenau, «wurde am 4. und 5. Juli gefoltert und
mit den kleinen und grossen Sternen ausgezogen.» Was heisst das?
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 607 - arpa Themen Projekte
an den Armen aufgehängt und durch eine Winde hochgezogen,
wobei das ganze Körpergewicht an den Händen hing; nicht genug damit,
wurden dem freischwebenden Leib zuerst kleinere, dann grössere,
mithin immer schwerere Steinklötze an die Beine gehängt; nicht genug
damit, lief der nackte Rücken beim Rauf- und Runterziehen über
eine dicke Holzwalze die über und über mit massiven Eisenspitzen
—rostigen «Stäfzgen» —gespickt war, wobei diese Eisenspitzen sich
jedesmal zu Dutzenden tief ins Fleisch des Rückens bohrten, je
schwerer der Stein, desto tiefer ins Fleisch! Und dieser wahrhaft unmenschlichen
Prozedur schauten die Kulturträger der damaligen Herrenklasse
wie der Ritter und Ratsherr Kaspar Pfyffer und seine Gerichtsherren
Tag für Tag von morgens bis abends mit kanibalischem
Vergnügen zu!
Damit man nicht meine, ich übertreibe, sei hier — nach dem Abdruck
bei Vock — ein wörtlicher Auszug aus einem Brief des hochedlen
Ritters Kaspar Pfyffer an den wohledlen Schultheissen Ritter von
Fleckenstein mitgeteilt, den jener exakt an dem Tag, am 5. Juli 1653,
schrieb, an dem er den armen Schybi zum zweitenmal stundenlang vor
seinen eigenen Augen hatte martern lassen. Hören wir:
|
«Hoch- und Wohledelgeborener Herr Schultheiss! |
Des Herrn an mich abgegangenes Schreiben hätte nicht glücklicher
anlangen können; denn (!), indem der Schnider von Rothenburg
an der Tortur war und der andere in Bereitschaft und ohne Zweifel
diesen schreien hörte (!), war mir im selben Moment das Schreiben
in den Thurm gebracht worden... wann Hr. Obrist Zweyer kommt
und man die Sachen abmachen wird, er soll» (ein gewisser Egli, für
den oder von dem Fleckenstein offenbar eine «Empfehlung» erhalten
hatte) «so viel als möglich Herrn Obrist, wie auch den übrigen Herren,
rekommandirt werden... Es ist gar viel hier zu schaffen. Diesen Morgen
haben wir früh angefangen und 12 Stunden examinirt. Der Schybi
hält sich fest und ist mächtig stark. Ihm sind kleine und grosse Steine,
auch andere Sachen (!) aufgelegt worden; doch hat er wegen nigromantiam»
(d. h. wegen Zauberkunst! «Schybi galt nämlich allgemein
für einen Schwarzkünstler und Hexenmeister», wie Vock hier anmerkt)
«nichts bekennen wollen, obwohl er heftig geschwitzt und dazu
geweint hatte. Wir vermeinen also nicht und können nicht finden
noch gespüren, dass etwas weiteres aus diesem zu bringen sei. Meinem
Herrn Schwager (d. h. Fleckenstein) weiters und mehreres zu dienen,
bin ich von Herzen jederzeit bereit.
|
Sursee, den 5. Juli 1653. |
|
(Unterzeichnet): Kaspar Pfyffer.» |
Wahrlich, während sich das Verhalten und die Gesinnung der «gebildeten»
Herren in diesem Schreiben von selbst als gemein, feige und
niedrig brandmarkt, dürfen wir mit Vock von dem «ungebildeten»
Schybi mit Recht sagen: «Schybi zeigte sich in den Verhören und auf
der Folter sehr männlich»! Muss doch selbst Liebenau zugestehen:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 608 - arpa Themen Projekte
kennzeichnet dieses Schreiben auch den Abgrund von Unbildung der
«gebildeten» Herren, die steif und fest an Schybis «Hexerei» glaubten
und ihn mit aus dem Grunde so unmenschlich folterten, um von ihm
die «Geheimnisse» seiner Zauberkunst zu erpressen! (Es ist genau
derselbe Abgrund von Aberglauben, wie ihn uns schon das Kriegsgericht
in Suhr auch bei den Zürcher Herren enthüllt hat.) Selbst der
moderne katholische Herrenchronist jener Luzerner Herren, Herr von
Liebenau, wirft Schybi noch vor: «Dagegen gab er zu, er habe das
Volk im Wahne gelassen, er werde dafür sorgen, dass die Geschütze
den Bauern nichts schaden.» Dabei ist das nur eine Unterschiebung
des Herrn von Liebenau. Denn im Originalprotokoll von Schybis Verhör
am 5. Juli steht wörtlich nur: «An die Marter geschlagen, 5 mal
lähr, 2 mal mit dem kleinen und 1 mal mit dem grossen Stein gebrucht,
hat bekent, dass die soldaten gesagt, der Schybi werde schon machen,
dass Inen die stück geschütz inen nichts schaden, er habe nichts davon
gesagt»! «Die Hexenkünste, welche er nach der Volkssage in Küssnacht
und Kriens sollte verübt haben, erklärte Schybi», wie auch Liebenau
zugeben muss, «als blosse Geschwindigkeit», und die ist bekanntlich
keine Hexerei. So nüchtern und klar blieb Schybi trotz der fürchterlichen
Tortur.
Als besondere Niedrigkeit der Herren muss noch hervorgehoben
werden, dass das Todesurteil über Schybi durch Ratsbeschluss vom
4. Juli bereits gefällt war, als man den ganzen nächsten Tag, wie oben
dargetan, fortfuhr, Schybi zu martern! Dieses ganze Verhör vom 5. Juli
diente mithin ausschliesslich zur Befriedigung der abergläubischen Neugier
der Herren! Es ist Liebenau, der in seiner Sonderschrift ...über
Schybi — die zum Zweck der Herabsetzung Schybis und der Zerstörung
seiner Popularität abgefasst zu sein scheint — dies unfreiwillig
enthüllt, wenn ihm bei der Behandlung der Surseer Verhöre der Satz
entschlüpft: «Allein, ehe das Resultat der Untersuchung bekannt war,
hatte der Grosse Rat schon das Todesurteil gesprochen»! Ja, Liebenau
gibt auch den Zweck der Forderung zynisch zu, indem er schreibt:
«Der Hauptzweck der Folterung bestand nun aber darin, dass Schybi
auch als Negromantiker überwiesen werden sollte»!
Es gehört nur zu der gewohnten religiösen Heuchelei der barbarischen
Herrenkultur, wenn der Ritter Kaspar Pfyffer am 7. Juli,
nach der Hinrichtung Schybis, an den Luzerner Rat schreibt: «Der hut
Justifizierte Schybi, deine Gott gnädig syn wolle, hat noch höchlich
einer hohen Obrigkeit danken lassen, der Ime ertheilten Gnad, dass er
an Catholischem Ort mit sinem guoten Trost sterben können...»
So endete der von allen Herren — sicherlich hauptsächlich wegen
seiner vermeintlichen «Hexerei» — am meisten gefürchtete «Kriegsheld»
des schweizerischen Bauernkrieges, der von ihnen ganz fälschlicherweise
als ein «Hauptursächer des Krieges» bezeichnet wurde.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 609 - arpa Themen Projekte
wenigstens im Luzernischen, besonders natürlich im Entlebuch. «Noch
zeigt man — schrieb Liebenau in den Neunzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts — in Wissemmen zu Escholzmatt das sogenannte Moosheirihaus
als das Geburtshaus Schybis.» 1903 hat dann allerdings ein
Märzsturm das Häuschen umgeweht —gerade während man sich über
das Denkmal stritt, das dann vom Luzerner Volk seinem Helden Schybi
errichtet worden ist.
Arm hat Schybi gelebt, arm ist er gestorben. «Der Nachlass Schybis
reichte nicht einmal zur Zahlung des restlichen Bussengeldes von
5 Gulden 25 Schillingen aus.» Die Luzerner Regierung musste noch die
Prozesskosten und seine «Turmkost» bezahlen. Und auch die Kosten
für seine Hinrichtung: der Scharfrichter Hans Mengis forderte dafür
2 Gulden 20 Schilling... Schybis einziger Sohn, ebenfalls ein Christian,
ist im Jahr 1696 als Soldat der päpstlichen Garde in Bologna gestorben,
als letzter seines Geschlechts. Er habe die Heimat nicht mehr sehen
wollen...
Am 19. Juli 1653 fielen in Luzern die Häupter des feurigen Revolutionärs
Stephan Lötscher, des Wirts zu Schüpfheim, der von Anbeginn
an einer der eifrigsten Baumeister des Wolhuserbundes war, und
des Rudi Stürmli, eines der drei Hauptführer des Rothenburger Amtes.
Dies geschah, nachdem sie beide, natürlich nach entsprechenden «Verhören»,
angeblich — nach Liebenau — genau dasselbe eingestanden
hatten, das seinerseits sich wiederum in auffälliger Weise mit den von
Liebenau für Jakob Stürmli von Willisau und Hans Diener von Nebikon,
die beiden ersten Opfer des Zofinger Gerichtes, angegebenen Urteilsgründen
deckt: «ihre Umtriebe in den Urkantonen, die Verleumdungen
gegen die Regierung, die Tätigkeit als Kriegskommissärs und
Kommandanten, die Pläne betreffend Zerstörung des Schlosses Castelen,
Wegnahme der Kanonen in Sempach, Eintreibung von Bussengeldern
von den Anhängern der Regierung». Mit andern Worten: es
wurde so ziemlich allen Rädelsführern einfach schematisch die Beteiligung
an den oder jenen historischen Ereignissen der ganzen Epoche
als Todes gründe untergelegt, ohne dass man sich lang bemüht hätte,
ihnen individuell todeswürdige Verbrechen nachzuweisen. Auf diese
Weise konnte jeder Beliebige oder vielmehr Missliebige aus dem Wege
geräumt werden — und nichts könnte deutlicher diesen Massenmord
zum rein politischen stempeln. Stephan Lötscher und Rudi Stürmlis
Köpfe wurden beide «auf das Hochgericht gesteckt», d. h. Lötschers
Kopf an «die linke Säule», Stürmlis Kopf an «die rechte Säule des
Galgens» genagelt...
Nur wenige Tage — und diese Köpfe bekamen illustre Gesellschaft!
Nicht andre Köpfe bloss, sondern ganze Leiber. Denn nun wurde, wie
bei Fridli Bucher, wieder gehängt. Und zwar, wie Sonne und Mond,
wie Tag und Nacht, am gleichen Galgen nebeneinander: der Treue und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 610 - arpa Themen Projekte
und Kasper Steiner! Das war am 23. Juli 1653.
Hängen — das war die entehrendere, die schändlichere Strafe.
Darum entspann sich ein Kampf unter den Herren um die Todesart,
die auf die beiden ungleichen Opfer anzuwenden sei. «Schultheiss Dulliker
beantragte, Emmenegger mit dem Schwerte hinzurichten» — das
war gewissermassen eine Ehrenbezeugung! Hut ab vor Dulliker! Aber
er unterlag: «dieser Antrag vereinigte 29 Stimmen auf sich, Statthalter
Pfyffers Antrag — Hinrichtung mittels Strang — siegte mit 31
Stimmen». Umgekehrt beantragte. ein anderer Pfyffer, der Landvogt
Leodegar, für Steiner «Hinrichtung durch Schwert und Aufstecken des
Hauptes auf den Galgen». Wiederum war es Dulliker, der wenigstens
einen Anflug von Anstand, von Verständnis für den Qualitätsunterschied
zwischen den beiden Opfern verriet, dass der eine ein Ehrenmann,
der andere ein Schuft war. «Schultheiss Dulliker will Steiner
auf einem Schleipfling zur Richtstätte führen, dort aufs Rad flechten
und erwürgen lassen»! Dann erst soll Steiners Haupt auf das Hochgericht
gesteckt werden. Dulliker «zieht aber seinen Antrag zurück und
stimmt mit Schultheiss Fleckenstein zur Hinrichtung mit dem Strang».
Also wurden schliesslich beide gehängt!
Wir wissen weder von Steiner, noch von Emmenegger, wie sie in
die Gewalt der Herren gelangt sind. Es steht nur fest, dass Hans Emmenegger
sich nicht freiwillig gestellt hat. Denn in seinem Verhörprotokoll
steht ausdrücklich — und zwar zweimal, die Entlebucher «wellent
ire abgeforderte fit stellen»; das zweitemal wird das als Inhalt
eines Briefes an die Willisauer festgestellt, und Hans Emmenegger unterstreicht
das, indem er seinen Richtern ins Gesicht sagt: «Dess Briefs
sye er zufrieden!» Bei Steiner ist das durchaus keine ausgemachte
Sache. Denn Kaspar Steiner scheint sich im Wahne befunden zu haben,
dass die von ihm den Herren durch seine wiederholten Verrätereien
geleisteten Dienste ihm jetzt mindestens das Leben retten, wenn nicht
gar noch einen Lohn einbringen würden. Jedenfalls bringt er in seinem
Verhör diese Dienste den Herren in Erinnerung, nämlich «dasjenige
was er nach dem ersten Ufbruch (das heisst nach dem 19. März, dem
«Friedensschluss» auf dem Krienserfeld) Minem Gnädigen Herrn dem
Herrn Schultheissen an Eydstatt angelobt», um allerdings gleich nachher
zugeben zu müssen, dass er dies «angehnts Daheim wiederum gebrochen»
habe. Auch streicht er heraus, er habe «den Amptslüthen zugesprochen,
dass man die Obrigkeit fit könne der Empterbesatzung
halber von Ihrem habenden Sigel und Brief stossen...» Aber er muss
zugeben, «er sye an der obrikeit 2 mahl meyneid worden». Damit ist
dieser ehemalige Jesuitenschüler mit seinem Latein zuende, sackt elend
in sich zusammen und «Pittet M. G. H. flehentlich mit gebogenen
Knien umb gnad»! Liebenau — der, wie alle Herrenchronisten, dem
Kaspar Steiner wegen seiner Dienste an den Herren nicht gänzlich
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 611 - arpa Themen Projekte
berichten zu dürfen: «Steiner bekannte vor dem Tode eine Reihe
von Gewalttaten, die er im Rausche vollbracht hatte, wie eine Reihe
kleinerer Diebstähle.» Wahrlich ein trauriges Ende für — wie Liebenau
meint — «die interessanteste Persönlichkeit im Rothenburger
Amte»; für den, der einstmals, auf dem geduldigen Buckel des endlich
zum Freiheitskampf aufgestandenen Volkes, nach Cysat-Wagenmann,
«vermeinte, glichsam Graf zu Rothenburg zu werden».
Dagegen ist es wirklich erhebend, wie Hans Emmenegger sich
und der Bauernsache bis zum letzten Atemzuge treu blieb! Selbst seine
erklärtesten Feinde, die damaligen Herren wie alle seitherigen Herrenchronisten,
müssen «dem allerärgsten, bösesten Rädelsführer» doch
schliesslich diese Ehre lassen. Selbst Liebenau muss berichten: «Allein
die Seele der Bewegung war Pannerherr Hans Emmenegger von
Schüpfheim. Durch körperliche Schönheit, Reichtum und aussergewöhnliche
natürliche Beredsamkeit, verbunden mit einem gewissen
Anstande, ragte dieser einem alten, angesehenen Bauerngeschlechte angehörige
Mann, der vom Landweibel angefangen, alle Ehrenämter des
Landes bekleidete, über alle seine Standesgenossen weit hervor...
Seine Freunde nannten ihn den ,Edelstein der Bauern'...» Dann hebt
Liebenau hervor, dass Emmenegger in den Verhören «seine Mitgenossen
so weit wie möglich schonte und über die Ziele der Revolution nicht
unwahre Angaben machte».
In der Tat: Hans Emmenegger stellte sich noch vor dem Malefizgericht
und unter der Marter schützend vor den Bauernbund! Das geht
selbst aus den jämmerlich verlogenen und verschnittenen Herren. protokollen.
hervor. Danach sagte Hans Emmenegger: «Den ersten rath habe
er zum Wolhuser pundt geben, und solcher sye zwo dem Ende geschehen,
dass sie desto stärker werent, ire sachen zuo behaupten. item,
dass sie mit wyb, haab, guodt wider die oberkeit bi einanderen zwo
verblieben. Item, sye ihr, der Entlibuocher jederzyt will und meinung'
gesyn, dass die Embter styf und stät den Pundt halten sollen... Alle
9 Embter habend den reiht geben, dass die Entlibucher M. G. H. nit
mehr für ein Oberkeit zu erkennen, sintewylen sie (Mine Gnädigen
Herren!) dem raub syent verzeigt (nämlich des Raubes der Entlebuchischen
Freiheitsbriefe!) ... Sie habent begehrt gehalten zu werden wie
die im Hassli (d. h. die Haslitaler im Berner Oberland, die die grössten
bäuerlichen Freiheiten aus der schweizerischen Vorzeit herüberzuretten
vermocht hatten), als einen Statthalter, der sarnbt den 40 (Geschworenen)
richte und abstrafe... Für die Statt (vor die Stadt Luzern) habe
man wellen mit aller macht ziehn, belagern, kein spyss und trank
mehr inlassen... Den burgern» (ihnen habe der «pundt gefallen») «hab
man schüben ellen, dass man mit der Oberkeit und bürgerschaft den
friden machen, und begehret nit als das göttliche recht...»
Wahrlich, dieser Mann war erfüllt von seiner politischen Sendung!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 612 - arpa Themen Projekte
hatte, und zwar das Entscheidende gelernt: dass es ein Klassenkrieg
war, ein Krieg der Aristokratenklasse, der Trägerin des Absolutismus,
gegen die Bauernklasse, die einzige damals in der Schweiz
vorhandene Trägerin der demokratischen Volksrechte, des «göttlichen
Rechts>). Er hatte sogar begriffen, dass die Bürgerklasse zur Mitträgerin
der Volksrechte gemacht werden muss, wenn der Sieg des
«göttlichen Rechts» erfochten werden sollte! Darum war er noch vor
seinen Todesrichtern stolz auch auf seinen Bund mit den Bürgern. Er
scheiterte nur daran, dass die Bürgerklasse selbst wirtschaftlich noch
nicht reif für diese Einsicht, sondern noch zu abhängig von den Aristokraten
war. Aber selbst als die Bürger ihn deshalb in letzter Stunde
verrieten, bewies er das, was der Verfasser der «Historia Societatis
Jesu Lucernae» (nach Liebenau), und dies gewiss nicht ohne Grund,
an Hans Emmenegger rühmt: den «nicht gewöhnlichen Geist und
Scharfsinn»: indem er die nächstfolgende Klasse, die Hintersassen im
ganzen Land, die völlig Rechtlosen, zum Kampf für das «göttliche
Recht» aufrief und ihnen dafür im voraus das Recht schenkte, über
das er als Haupt der Entlebucher verfügte, das entlebuchische Landrecht,
d. h. die völlige Gleichberechtigung mit den Entlebuchern selbst!
Aber das war nur acht Tage vor dem Ende, dem Ende in Wohlenschwil,
auf das Emmenegger keinen Einfluss mehr hatte. Das kam,
wie Alles in diesem Krieg, tragisch zu spät — und die individuelle Genialität
Hans Emmeneggers konnte den Mangel an Klassenbewusstsein
sowohl bei den übrigen Bauern führern wie bei den Bürgern — die Ursache
des tragischen Endes — unmöglich ersetzen...
Aber ein Mann, der so erfüllt war von seiner Sendung, konnte
ruhigen Gewissens sterben. Darum ist er — wie der Geschichtschreiber
der Luzerner Jesuiten sagt — «als guter Christ freudig in den Tod
gegangen»! Auch Liebenau schreibt: Mit grösster Gemütsruhe vernahm
Emmenegger das Todesurteil. Selbst Ratsherren weinten, als
sie Emmenegger mutig und ruhig auf dem Weg zur Richtstätte sahen.
Noch bestimmte er 6 Gulden zur Lesung von Messen für seine arme
Seele. »
Sein Knabe Melchior aber, der 1653 zwölfjährig war und den die
«drei Teilen» an den hohen Festtagen des letzten Freiheitskampfes der
Bauern als «Knaben Teils» auf ihren Schultern herumgetragen hatten,
sagte im Jahr 1657: «Ich habe Tag und Stunde aufgeschrieben, wo
mein Vater hingerichtet wurde; nie werde ich die Obrigkeit anschauen,
die es meinem Vater, dem Schybi und dem grossen Hans Krummenacher
so stark und streng gemacht.. gemacht...»
Zuletzt in dieser blutigen Reihe kam in Luzern der Untervogt
Hans Spengler von Kriens dran. Er wurde am 4. August enthauptet, auf
Antrag des Statthalters Ludwig Meyer, des steinreichen Ratsherrn und
Ritters, der von seinen Schmeichlern als «deutscher Plato» beweihräuchert
wurde, der jedoch trotz alledem — so bunt trieb er es — nur
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 613 - arpa Themen Projekte
einem Gülthandel » bestraft werden musste und ausserdem abermals
«wegen Uebervorteilung bei einer Gant von zwei Höfen» angeklagt
wurde... Hans Spengler war — wie Liebenau glaubt — das pure Opfer
der «Tatsache, dass zahlreiche Rädelsführer behaupteten, die
Krienser und Horwer haben die erste Belagerung von Luzern verursacht».
«Man behauptete, Spengler, der 10 Jahre lang mit Revolutionsplänen
sich trug, halte sich für einen Propheten»! Das waren Todesgründe...!
Man behauptete noch Vieles; z. B., nach Vock, war Hans
Spengler «unter anderem auch angeklagt, den Bauern den Rat gegeben
zu haben, dass, sobald sie die Stadt Luzern eingenommen haben, sie
alle Knäblein verschneiden sollen., damit so die stadtbürgerlichen Geschlechter
in Abgang kommen und aussterben». Eine typische Greuellüge,
die aus der Angstpsychose der Luzerner Junker stammt, als sie
vor den Bauern zitterten, und für die selbst nach Liebenau «die Verhörprotokolle
keinen Anhaltspunkt bieten». Und derselbe meldet über
Spengler: «Die Leute von Kriens waren ihm sehr anhänglich und versicherten,
Spengler sei von jeher der friedlichste Mann gewesen, der
niemals irgend jemanden ein Härchen gekrümmt hätte...»
So ist es nun wieder nicht ganz — den Frieden mit den Herren
wollte Hans Spengler nicht! Denn er ist immer der treuste Kampfgenosse
des feurigen Revolutionärs Stephan Lötscher gewesen und ist
mit diesem gar an die Landsgemeinden der Urkantone gezogen, um die
Bauern der Innerschweiz an die Seite der Luzerner Bauern zu bringen.
Und ihm ist es zum grössten Teil mit zuzuschreiben, wenn die unter
Zwyers Oberbefehl zum Herrendienst nach Luzern aufgebotenen Innerschweizer
Bauern gegen diesen Dienst aufmuckten bis zur Meuterei...
So ist es immerhin vom Standpunkt der Luzerner Herren
nicht ganz unbegreiflich, wenn sie an Hans Spengler ihr Mütchen
kühlten und seinen abgeschlagenen Kopf nicht einfach neben den Stephan
Lötschers und Rudi Stürmlis an den Galgen nagelten — an dem
noch die Leichen Fridli Büchers, Hans Krummenachers, Kaspar Steiners
und Hans Emmeneggers hingen —, sondern ihn vielmehr zur
noch grösseren Abschreckung «zur rechten Seite des Haberturms beim
unteren Tore auf eine eiserne Stange hinpflanzten»...
Damit war zwar die blutige Reihe der Luzerner Hinrichtungen
noch nicht zuende, aber für eine ziemlich lange Zeit trat eine Pause
ein. Sie wurde ausgefüllt durch eifrige Fahndungen der Luzerner Herren
im In- und Ausland nach den geflüchteten Bauernführern. «Jene
Rädelsführer, die sich geflüchtet hatten, wie Hans Höher, der Däywiler
Bauer, Hans Krummenacher, Weibel von Schüpfheim, wurden
auf ewig verbannt. Andere, wie z. B. Lehrer Müller, den Schriftführer
der Entlebucher, suchte man auf verschiedene Weise einzubringen und
scheute deshalb auch nicht die einlässlichsten Nachforschungen und
Verhandlungen mit den deutschen Reichsfürsten», schreibt Liebenau.
Der Schulmeister Hans Jakob Müller, der ehemalige «Kanzler»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 614 - arpa Themen Projekte
Man fand in der Schüpfheimer Schmiede, wo er gewohnt hatte, zwar
«die alten Urkunden des Landes Entlebuch wohlbehalten vor... und
neben den Urkunden in dem gleichen Kästchen auch ein altes weisses
und rotes Fähnlein»: das Panner der Markgrafen Otto von Hochberg,
eine Siegesbeute der Entlebucher aus der Schlacht bei Sempach. Dies
alles verschwand nun natürlich in Luzern hinter Schloss und Riegel
— und damit die Freiheit des Landes Entlebuch. Aber der Schulmeister
selbst, der ja nicht ein Entlebucher war, sondern von Rapperswil
stammte, und der schon zu Beginn des Aufruhrs nur schweren
Herzens um dessetwillen auf eine Lehrstelle in Mülheim an der Donau
verzichtet hatte, verschwand nun für immer jenseits des Rheins und
«fand im Hohenzollerischen ein Asyl als Lehrer». Der Fürst Meinrad
von Hohenzollern nahm ihn gegen die Verfolgung seitens der Luzerner
Herren persönlich in Schutz.
Was den trotzigen und willensstarken Däywiler Bauer Hans Höher
betrifft, der «seit 1648 der Regierung Schwierigkeiten bereitet» hatte,
so rettete auch er zwar sein Leben durch die Flucht, «wagte aber später
wieder die Viehmärkte im Amte Willisau zu besuchen und nochmals
eine Revolution anzustiften». Liebenau, der dies berichtet, sagt
von ihm weiter: «Er ist der intellektuelle Urheber des Attentates beim
Büggenschachen im Entlebuch, wie er auch schon vorher die Korrespondenz
mit dem Entlebuch besorgte.» Darum werden wir ihn dort
bald, schon im Herbst dieses Jahres 1653, sehr tätig wieder antreffen,
im letzten Akt dieses Bauernkriegs und im letzten Kapitel dieses Buchs.
Um ihn geschart alle übrigen einheimischen Rebellen, die zähesten, die
tätigsten von denen allen, die ihr Leben einstweilen durch Flucht zu
retten verstanden. Denn diese alle waren bis dahin noch nicht ausser
Landes geflohen, sondern, vom eigenen Volk geschützt und genährt,
als Partisanen in die heimischen Berge: allen voran der eigentlichste
«Ursächer», der tollkühne Käspi Unternährer, der «Tell». mit ihm zusammen
die beiden andern «Tellen», der Hinteruli und der Hans Stadelmann,
auch «Städeli» genannt, und auch Hans Krummenacher der
«Fuchs» war jetzt noch mit ihnen im Land, der Stellvertreter jedes
der drei Tellen war. Ebenso noch viele andere, darunter der besonders
zähe und entschlossene Jost Marbacher, als Führer einer ganzen Schar
neuer Rebellen, die die Rebellion heimlich noch durch viele Jahre weitertrugen.
Denn sie alle konnten und wollten nicht glauben, dass der
grosse Kampf um die Freiheit des Volkes schon zuende sei...
«Wir wollen aber» — mit Herrn von Liebenau — «auch nicht verschweigen,
dass die frommen Luzerner» (d. h. die Herren, und zwar
etwas voreilig!) «Gott dankten für die glückliche Beendigung des
Bauernkriegs, und dass sie zum Zeichen des Dankes am 28. August
1653 beschlossen, eine silberne Ampel und ein ewiges Licht nach Einsiedeln
zu stiften, mit Bitte, Maria wolle die Stadt ferner beschirmen
und alles Unheil vom Vaterlande» (vom Vaterland der Herren!) «abwenden
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 615 - arpa Themen Projekte
der jungen Töchtern' eine Wallfahrt nach Einsiedeln veranstaltet...»
«Damit auch Stadt und Land in Frieden erhalten bleiben, wurde»
(zwar etwas später, im März des nachfolgenden Jahres) «der grosse
Heidenapostel (!) Franciscus Xaverius zum Schutzpatron von Luzern
erwählt... und eine Denkmünze mit den Initialen der Schultheissen
Fleckenstein und Dulliker auf dieses Ereignis geschlagen...»
Denn «Stadt und Land», das war in den Augen der Herren nun
wie «Glaube und Unglaube», wie «Christen und Heiden» — und die
Heiden musste man mit Himmelsgewalt bekehren, wenn man in alle
Zukunft ruhig schlafen wollte!
«Die Grausamkeiten, die sich die Bauern hatten zuschulden kommen
lassen, stehen in keinem Verhältnis zu der wilden Rache, welche
die Herren nahmen, die noch vor kurzem vor den Bauernscharen gezittert
hatten. Ein Hängen, Rädern, Köpfen hob an, wie es in der
Schweizergeschichte einzig dasteht; eine so barbarische Strafjustiz, wie
sie wohl nur das vielverschriene Mittelalter gekannt hat.» So schreibt
ein populärer Darsteller des Bauernkriegs, Gottfried Guggenbühl. Er
muss dabei vor allem die Berner Exekution vor Augen gehabt haben.
Im Kanton Bern sind in der Tat zweiundzwanzig Bauernführer
hingerichtet worden, darunter 8 Emmentaler, 5 Oberaargauer, 3 Seeländer,
2 Aargauer, 1 Oberländer, 1 Sternenberger und 2 Luzerner, die
von der Luzerner Regierung an die Berner Regierung ausgeliefert wut
den. Mindestens 3 Steffisburger Führer und vielleicht noch 1-2 Dutzend
andere wären hinzugekommen, wenn sie nicht durch die Flucht
dem Henkertod zu entrinnen vermocht hätten. Dabei sind die nach
Dutzenden zu zählenden wilden Exekutionen nicht mitgezählt, die der
Junkergeneral ohne Gericht, aber mit ausdrücklicher Vollmacht seiner
Berner Mitherren, anfangs Juni, während seines Feldzugs in den Oberaargau,
in Wiedlisbach, Herzogenbuchsee und anderen Orten, drauflos
vollzogen hat.
Rösli, der neueste Berner Spezialist des Bauernkriegs, speziell für
die Abstrafung der Berner Bauern, hebt ausserdem aber besonders hervor:
«Im Vordergrund standen die Geldbussen, bei deren Ausfällung
die Regierung ebenfalls mit aller Strenge vorging. » In der Tat ist die
Bereicherungssucht der Berner Herren, auf dem Buckel eines niedergeworfenen
Volkes, vielleicht das Widerwärtigste an der Berner Strafaktion.
«Reiche Bauern wurden in der Regel finanziell härter gebüsst
als wenig bemittelte», stellt Rösli fest. Er ist dabei aber so naiv oder
vielmehr so herrenfromm, dass er dies dem «Streben nach möglichster
Gerechtigkeit» der Berner Herren zuschreibt. Das ist natürlich Unsinn.
Vielmehr wurden die reichen Bauern auch dann vielfach höher gebüsst,
wenn ihnen weitaus geringere oder gar nur angedichtete Vergehen
zu Lasten gelegt werden konnten. Das Prinzip der Herren war
dabei — genau wie bei den Luzerner Herren — einfach das der grösseren
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 616 - arpa Themen Projekte
Raubzug auf den Beute! der reichen Bauern! Und nur darum
stimmt die weitere Feststellung Röslis: «Die grosse Mehrzahl der Verurteilten
gehörte vielmehr zur Klasse der Gutsbesitzer, zur ländlichen
Oberschicht.» Und trotzdem muss Rösli feststellen: «Alles in allem
wurden dem Landvolks Summen auferlegt, die bei der herrschenden
Geldnot nur selten aufgebracht werden konnten»! Daher «die häufig
vorkommenden Geltstage» — d. h. die Auspowerung und Entmachtung
der Bauernklasse zugunsten der Herrenklasse, die auf dieser «wirtschaftlichen
» Basis ihren Absolutismus nun wirklich hundertprozentig
ausbauen konnte. Ausserdem stellt schon Bögli fest: «Als allgemeine
Strafen legte die Regierung den einzelnen Aemtern und Gemeinden
hohe Summen an Kriegskosten auf», was auch nicht wenig zur Befestigung
der Position der Herren beitrug.
Eine besondere Berner Spezialität ist die Rolle der Geistlichen
bei der Eintreibung der Bussen, ja auch schon bei der Verurteilung
zu ihnen. «Schwer ins Gewicht fielen endlich», sagt Rösli, «die Berichte,
Anklagen oder Fürsprachen besonders der Geistlichen, die ja
die einzigen Vertrauensmänner der Regierung in den Landgemeinden
waren, ferner der Landvögte und sonstigen hohen Standespersonen.
Unter ihrem Einfluss dürfte manches Urteil verschärft oder gemildert,
besonders aber auch manche Zahlungsfrist gewährt oder verlängert
worden sein; denn beim Durchgehen des Verzeichnisses fällt
auf, wie einzelne, selbst stark begüterte Bestrafte jahrelang unbehelligt
nicht bezahlten, während andere gemahnt und bedroht ihre Schuldigkeit
rasch entrichteten.» Mit andern Worten: Der Korruption war
bei diesem System Tür und Tor geöffnet —genau wie in Luzern; nur
dass es in Bern «besonders die Geistlichen» waren, die Tür und Tor
zur Volksausplünderung öffneten oder schlossen, während in Luzern
diese «christliche» Rolle von den Landvögten und den Ratsherren selbst
und ausschliesslich beansprucht wurde und in Luzern der Schacher
um Leben oder Tod das Haupterpressungsmittel gegenüber den reichen
Bauern war, wofür wir in Bern keinen Anhaltspunkt finden. Aber hier
wurden die «bösisten Rädliführer», deren man habhaft werden konnte,
ausnahmslos gehängt oder geköpft, wobei man ohnehin all ihr Hab
und Gut — wenn auch manchmal unter Abzug von Frauen- oder Kindergut
— als «dem Fiskus verfallen» einzog! «Die Güter aller Hingerichteten
wurden konfisziert», sagt Bögli. «Auch die Güter Verstorbener
(nicht Hingerichteter!) wurden eingezogen»; dies wieder ganz wie in
Luzern. Man bestrafte ja an beiden Orten «nicht nur die Lebendigen,
sondern auch noch tote Leiber...»
Ein klassisches Beispiel für die Verbindung von Hinrichtung und
Ausplünderung ist schon das Schicksal eines der bereits am 20. Juni
in Aarwangen Hingerichteten, des Uli Flückiger, aus Flückigen im
Rohrbachgraben: «Er hinterliess keine Kinder, weshalb sein ganzer
grosser Besitz dem Fiskus verfiel», berichtet Rösli. Dies geschah ausschliesslich
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 617 - arpa Themen Projekte
bei Herzogenbuchsee teilnahm» — andere Gründe werden nicht
angegeben. Auch seine Schicksalsgenossen, Bernhart Herzog von Langenthal,
«der fürnemsten einer», und der Schulmeister Emanuel Sägisser
von Aarwangen, wurden lediglich als «des Löwenberger Gespannen
und Bruder» zugleich geköpft und schwer gebüsst. Mit ihnen zusammen
wurde, wie wir bereits wissen, auch der tapfere Fuhrmann
von Trub Christen Blaser gehängt, der die ersten Knüppel nach dem
Entlebuch getragen und angesichts der entrüsteten Regierungsgesandten
in Langnau die Schuldenboten «gewidlet» hatte und der «zu Herzogenbuchsee
gefangen genommen» worden war, «als er den Bauern
Munition zuführte». Und am 22. Juni waren dann, als weitere Opfer
des von Herrn von Erlach eingesetzten und vom Landvogt Willading
präsidierten Blutgerichts zu Aarwangen die beiden Geiseln gehängt
worden, die diese Herren aus den 70 Gefangenen im Kaufhaus zu Langenthal
dazu hatten auslosen lassen: Damian Leibundgut von Melchnau,
der das Haus des Prädikanten von Melchnau. eines Regierungsspions,
stürmen half und ebenfalls bei Herzogenbuchsee mitkämpfte,
sowie Klaus Mann von Eggiwil, der vertraute Laufbote Uli Gallis aus
den ersten Tagen des Aufstands.
Aber nun ging in der Stadt Bern selbst der Blutrausch erst an, der
den Hauptführern des Berner Aufstandes die Köpfe kostete. Am 8. Juli
rollten auf dem Berner Hochgericht gleich drei Köpfe in den Sand.
Der erste war Lienhart Glanzmann, der Wirt von Ranflüh, der
immer an der Seite Leuenbergers als einer seiner Hauptkriegsräte und
als sein revolutionäres Gewissen aufgetaucht war, ein Haupt der Uli
Galli-Partei und ein kommandierender Hauptmann bei der Belagerung
Berns, besonders als Anführer der hitzgen Bauerngruppe, die den Angriff
an der Neubrücke gemacht hatte, wobei er verwundet, nämlich
«in den rechten Arm geschossen» worden war. Deshalb hatte er auch
nicht am Gefecht zu Herzogenbuchsee teilnehmen können. Trotzdem
wurde er beim Verhör gemartert. Wir hören merkwürdigerweise von
einer «Fürsprache des Landvogts Tribolet» für ihn. Was dazu geführt
hat, wissen wir nicht. «Eine klingende Empfehlung» kann es aber nicht
gut gewesen sein. Denn wir hören durch Rösli: «er hinterliess elf Kinder,
sieben Söhne und vier Töchter. Die Schulden überwogen das Guthaben
um 600 Kronen, so dass viele Gläubiger leer ausgingen und
die Obrigkeit nichts erhielt.» Sein Kopf wurde an den Galgen genagelt.
Sein Schicksalsgenosse am gleichen Tag war der andere Hauptführer
der Uli Galli-Partei, d. h. des revolutionären linken Flügels der
Berner Bewegung, Daniel Küpfer aus dem Pfaffenbach bei Langnau,
der frühere berühmte «Schmied von Grosshöchstetten», einer der Führer
des Thuner Handels von 1641. Auch er war ein Hauptkriegsrat
Leuenbergers und Hauptmann in der Bauernarmee vor Bern. Ihm war
es zunächst gelungen, zu flüchten; aber er wurde wieder eingefangen.
Rösli berichtet über sein Verhör und sein Ende: «Oftmals gefoltert,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 618 - arpa Themen Projekte
vor Bern gerückt, und, nachdem Lienhart Glanzmann, der die Neubrücke
sperrte, verwundet worden war, dort das Kommando geführt
zu haben. Der Obrigkeit schrieb er, dass die Huldigung verweigert
werde, bis der Friedensvertrag ausgehändigt und die 50000 Pfund
bezahlt seien. Am 2. Juni unterzeichnete er ein Schreiben» (das vermutlich
von Uli Galli stammte), «worin die gnädigen Herren ,gottlose
Pharaoni' genannt und als ,hochbrächtige und gewalttätige' vor das
jüngste Gericht geladen wurden.» Daniel Küpfer war also ein ausserordentlich
mutiger und konsequenter Kämpfer bis zur letzten Stunde!
Er wurde von den Gnädigen Herren auch danach eingeschätzt. Denn
über sein Ende lesen wir: «Am 8. Juli wurde er enthauptet, sein Leib
gevierteilt, ein Teil auf dem Hoch gericht, die übrigen drei Viertel in
Signau, Ranflüh und Huttwil aufgehängt.» Besser hätten diese Herren
die Landesbedeutung dieses Führers nicht bekunden können! Wir
wollen auch das Detail nicht vernachlässigen, das uns das Tagebuch
des Berner Griechischprofessors Haller unter dem Datum dieses Tages
verrät. Danach nämlich ist Daniel Küpfer «by dem underen Galgen
enthauptet und syn Haupt auf den Galgen genaglet, der Lyb geviertheilt
und syn rechte Hand an einer Ketten neben dem Haupt gehencket
worden...» Den Viertel mit der rechten Hand also behielten die
Berner Herren sich vor — und nur die abgehauene Rechte des trotzigen
Freiheitskämpfers vermochten sie in Ketten zu legen! Wahrlich
ein grausiges Symbol für das Schicksal des ganzen Schweizervolkes
in diesem Krieg...
Aber diese nicht gerade zart besaiteten Träger der Berner Herrenkultur
hatten sich für den nämlichen Tag noch ein besonderes Gaudi
ausgedacht. Da war nämlich unter den «bösisten Uffwickleren» auch
Christian Wienistorf, «der Ammann von Oberburg, ein 80jähriger
Mann», eingebracht worden. Er «befand sich an den meisten Landsgemeinden,
beschwor den Bauernbund, war Kriegsrat, hielt zu Oberburg
und anderswo ,Gemeinden' ab, wo er die Bauern zum Aufstand
ermunterte, organisierte den Nachrichtendienst, stellte Wachen auf
usw.». Eine wahre Heldenleistung im Dienste des Freiheitskampfes
seines Volkes hat dieser 80jährige Mann mithin vollbracht, umsomehr
als er im höchsten Grade gebrechlich war. Denn «wegen syner Lybs
Indisposition » blieb er «von der Folter verschont». Ihm gebührte ein
Denkmal als Symbol der sterbenden altschweizerischen Bauernfreiheit!
Das Denkmal haben ihm die Berner Herren gesetzt: mit der Art
nämlich, wie sie diesen gebrechlichen Greis durch die Stadt Bern zum
Hochgericht schleiften! Mit Wonne trägt der Herrenbildungsdiener
Haller es in sein Tagebuch ein: man habe Christen Wienistorf «wägen
Uebelmögenheit synes Lybs uf einem holzinen Sessel, so uf einer
Schleipfen gestanden, hinuss geführt...» — um ihn dort zu köpfen
und seinen Kopf an den Galgen zu nageln... Zum Trost merkt der
Herausgeber dieses Tagebuchs hier an: «Vom 22. Juni an durften
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 619 - arpa Themen Projekte
Massen mit Trost zusprechen'; doch mussten stets ausser der Wache
noch zwei Mitglieder des Grossen Rates diesen Besuchen beiwohnen.»
Die wirkliche Rolle der bernischen Geistlichen — und vermutlich gar
in einem Sinne, der dem armen Ammann von Oberburg das Leben
kostete —geht aber besser aus einer Feststellung Böglis hervor: «Schon
lange vor dem Bauernkriege war der Pfarrer von Oberburg, Ludwig
Zeerleder, dem Ammann Christen Wienistorf, der dann am 8. Juli hingerichtet
wurde, sehr aufsässig gewesen...»
Am 19. Juli kamen wieder zwei dran, und keine schlechteren!
Denn auch Hans Rüegsegger, der Weibel von Röthenbach, war, wie
Daniel Küpfer, bereits ein Führer im Thuner Handel gewesen und war
auch jetzt stets sein engster Freund und stand mit ihm an der Seite
Uli Gallis. Auch Hans Rüegsegger hatte zuerst flüchten können und
war dann durch die Spürhunde Berns — wahrscheinlich durch den
Fryburger Oberst Reynold, auf dessen «Pacificationstour» ins Oberland
— wieder eingebracht worden. «Auch 1653 stand er in vorderster
Linie», sagt Rösli, «besuchte die meisten Landsgemeinden, beschwor
den Bund, zog mit den Emmentalern nach Ostermundigen,
wurde Kriegsrat, kämpfte bei Herzogenbuchsee», und was dergleichen
todeswürdige Verbrechen mehr waren. Um aber sein schlimmstes Verbrechen
nicht zu vergessen, das ihm für sich allein den Tod einbrachte:
er schrieb aus Herzogenbuchsee die Wahrheit über das dortige Wüten
des Junkergenerals von Erlach! Er schrieb es an den Statthalter Berger
von Steffisburg, den er für einen echten Revolutionär halten musste,
der sich jedoch als ein falscher Radikalinski erwies und ihn — wie
dann noch viele andere — an die Berner Herren verriet. Hans Rüegsegger
schrieb in seinem Brief, «wie der Herr Meyer (das war der General
von Erlach) so grusamlich» hause, wie er «das Dorf in Brand
gesteckt» «und der schwangeren Frawen nit verschonet» habe... Das
genügte. Und so «wurde er, trotz der Fürsprache des Prädikanten von
Diessbach, enthauptet und sein Haupt an das Hochgericht genagelt.»
Geschichtlich noch bedeutender war das andere Opfer dieses Tages
— desselben Tages, an dem in Luzern Stephan Lötschers und
Rudi Stürmlis Häupter fielen. Das andere Opfer war Hans Rieser aus
Oberried bei Brienz, der grosse Organisator des Aufstandes im ganzen
Berner Oberhand, — wohl ebenfalls eine Beute des Henkerknechtes
Reynold. Hans Rieser war der, der den Sumiswalder Bundesbrief wie
ein feuriger Apostel im Oberland verbreitete und darüber in allen
Hauptorten «Gemeinden» abhalten und den Brief beschwören liess.
Er war es auch, der das ganze Oberland gegen die welschen Truppen
an der Gümmenenbrücke alarmierte und mobilisierte, Truppen,
die die Berner Herren gegen das Berner Volk aufgeboten hatten. Aber
er hatte vor allem die zwei Ratsherren Huser und Bourgeois vor offener
Gemeinde beleidigt, und war also des Todes. Nachdem er genügend
gefoltert worden war, um ihm Aussagen zu erpressen — aber
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 620 - arpa Themen Projekte
und auch sein Haupt «schlug der Henker an den Galgen», der schliesslich
über und über mit abgeschlagenen Köpfen bedeckt sein musste.
Am 2. August kam noch das Haupt des Statthalters von Neuenegg,
des Peter Freiburghaus, hinzu, bevor das Haupt aller Häupter, dasjenige
Leuenbergers, fiel. Peter Freiburghaus war möglicherweise das
Opfer des nachbarlichen Hasses der Freiburger Herren. Er selbst jedenfalls
gab in seinem Verhör diese Deutung, nämlich, «dass er sich
durch Wahrung der obrigkeitlichen Rechte die Feindschaft Freiburgs
zugezogen habe und dies nun entgehen müsse». Er hatte nämlich
strenge Wacht an der Gümmenenbrücke gehalten und freiburgischen
Meldereitern Briefe abgenommen, die offensichtlich die geheimen
Rüstungen der Herren enthüllten. Es war wohl sein Verhängnis, dass
er, was im lebenswichtigsten Interesse des Berner Volkes war — sich
vor dem Einfall fremder Truppen zu schützen —, auch für seine
«obrigkeitliche» Pflicht hielt! Da hatte er jedoch mit dem über alle
Grenzen hinweg geltenden «Herrenrecht» nicht gerechnet! Denn als
sein schwerstes Vergehen wurde ihm angerechnet, «auf die Meldung,
dass im Freiburgergebiet einige tausend Reiter zum Einmarsch bereit
seien, die bereits geöffnete Brücke zu Gümmenen wieder gesperrt zu
haben». Da er ausserdem als aufrechter Mann die wirkliche, geschichtlich
erhärtete Falschmünzerei der Berner Herren offen anprangerte
— «dass die faltschen Müntzer und Batzenschlacher nit all ussert
Landts und in Frankreich, sondern auch deren allhie in der Statt sigindt,
die man wol wüsse, doch aber nit abstraffe» —, so war sein
Leben ohnehin verwirkt, und sein abgeschlagenes Haupt musste ebenfalls
an den Berner Galgen kommen...
So wurde vom Berner Malefizgericht — das einfach der Berner
Rat war — geköpft und geköpft, und diese blutige Reihe ist noch
lange nicht zu Ende. Was inzwischen an «geringeren» Strafen an Hunderte
und aber Hunderte ausgefällt wurde, die bei Rösli in schier endloser
Reihe aufgezählt sind, das wollen wir hier nach Bögli nur zusammenfassend
andeuten. «Von den sehr mannigfaltigen Strafarten»,
sagt Bögli, «wurden oft mehrere dem nämlichen auferlegt.» So beispielsweise
Geldstrafe plus «Abtrag Kostens», plus «Abschwörung des
Bundes», plus «Ehr- und Wehrloserklärung», plus «mit Ruten geschmitzt
werden», plus so und so viel Monate «Schellenwerk» (das
heisst Zwangsarbeit), plus «Deprekation» vor der Gemeinde unter Beistand
des Prädikanten in der Kirche, oder öffentlich ans Halseisen geschmiedet
werden! Alle mussten zugleich schwören, dass sie bei Wiederergreifung
der Waffen «Leib- und Lebensstrafe» verwirkt haben
sollen... Viele mussten die Prädikanten vor versammelter Gemeinde
oder vor Chorgericht unter demütigenden Formeln um Entschuldigung
bitten, weil der Hass der Bauern gegen die Prädikanten
wegen deren Angebereien ganz allgemein in offenes Schimpfen ausgebrochen
war. Ein Beispiel für viele, welches die Rolle der Prädikanten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 621 - arpa Themen Projekte
den Peter Wiedmer auszufragen, ob er der sei, so die Lästerworte
wider die Obrigkeit geredet habe.» Woraus Bögli die richtige Schlussfolgerung
zieht: «Die Geistlichen wurden also von der Regierung als
Ausspäher benutzt»!...
Endlich, endlich kam am 6. September, nach langen, fürchterlichen
Verhören, das Haupt aller Häupter, Niklaus Leuenberger, «der
Obmann der Bauern der Kantone Bern, Luzern, Solothurn und Basel»,
unters Richtschwert. Gefangen hatte man ihn schon am 9. Juni, am
Tag nach Herzogenbuchsee, und wir werden seine Geschichte seit diesem
Schicksalstag jetzt erzählen müssen. Aber dass man seine Qual
so lange hinauszog, hatte seinen Grund in dem Bedürfnis der Herren,
ihn mit andern «Rädelsführern» zu konfrontieren, die geflüchtet waren
und die man zuerst, unter Aufwand eines ausgedehnten Polizeiapparates
— bis weit ins Deutsche Reich hinein —, wieder einbringen
musste.
Niklaus Leuenberger fiel in die Hände des Landvogts Samuel
Tribolet von Trachselwald, genau wie Christus in die Hände des Statthalters
Pilatus: Durch Verrat eines «Jüngers» und Vertrauten! Und
wie jener Judas dreissig Silberlinge, so erhielt dieser von der Regierung
«als Belohnung für diese Tat... einen silbernen Becher»!
Der Judas hiess Hans Bieri und war der nächste Nachbar Leuenbergers
in Schönholz. Dieser Bieri war mit Leuenberger an die Landsgemeinde
in Sumiswald gezogen und dort in die Bauernausschüsse gewählt
worden. Jetzt, am Tage nach dem unglücklichen Ausgang des
letzten Kampfes der Bauern in Herzogenbuchsee, packte ihn die blasse
Angst vor den Folgen seiner Beteiligung an der Sache Leuenbergers.
An diesem Tage nämlich — es war der 9., nicht der 12. Juni, wie Vock
irrtümlich berichtet — «begegnete der Landvogt Samuel Tribolet, auf
der Rückreise von Bern in seine Landvogtei Trachselwald, dem Hans
Bieri, Leuenbergers Nachbarn und Vertrauten; dieser bat den Landvogt
für alle begangenen Fehler demütig um Verzeihung und gab ihm,
auf dessen Anfrage, den Bericht, dass Leuenberger wirklich noch immer
zu Schönholz in seiner Wohnung sich befinde...» Darin irrte
zwar Bieri. Denn obwohl Leuenberger nach dem Gefecht von Herzogenbuchsee
zunächst höchst wahrscheinlich direkt nachhause geeilt
ist, so steht doch, wie das nachfolgende erweist, fest, dass er noch
am selben Tag sein Haus wieder verlassen und sich auf die Flucht
begeben haben muss. Item, Vock fährt fort: «...worauf ihm (dem
Bieri) der Landvogt die oberkeitliche Verzeihung und Gnade unter der
Bedingung zusicherte, dass er sein Möglichstes zu Leuenbergers Verhaftung
beitrage, was hier sogleich versprach.»
Noch am selben Tag traf Tribolet fieberhafte Anstalten, um den
kapitalen Fang zu tun, bei dem es für ihn selbst zweifellos nicht weniger
um seinen eigenen Kopf als um den Leuenbergers ging. Denn
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 622 - arpa Themen Projekte
seiner Herren durchzustehen gehabt, und er wusste, dass er bei seinem
jähzornigen Naturell ein nächstes nicht durchzustehen vermöchte,
ohne den Zorn seiner Herren vernichtend auf sich herabzuziehn. Jetzt
nämlich, wo die Herren ihre ganze Wut über den Bauernkrieg ungehemmt
loslassen konnten, drohte sich diese auch gegen ihn als den
in den Augen der Herren — schon weil das für sie einen Sündenbock
schuf —vermeintlich hauptsächlichen «Ursächer» dieses Kriegs zu entladen.
Und wenn sich das Gewitter im Jahr darauf dennoch schliesslich
über ihn entlud, so ist doch sicher, dass er sich durch die Gefangennahme
des Hauptes der ganzen Rebellion wenigstens einen Aufschub
von vielen Monaten verdient hat. Denn es ging schon um des Prestiges
der Regierung willen nicht wohl an, dass man dieses «Verdienst»
um die Staatsautorität unverzüglich mit seiner Ausstossung, Verbannung
oder — wer weiss (er kannte seine Pappenheimer!) — sogar mit
seiner Enthauptung «belohnt» hätte...
Kurzum, wie Bögli berichtet: «Der Landvogt beauftragte nun den
Bieri mit der Verfolgung (Leuenbergers) und gab ihm zu diesem
Zwecke noch einige andere Männer mit, nämlich den Seckelmeister im
Adelboden (bei Sumiswald), den Hans, Ludi (Ludwig) und Niklaus
Dubach, den Landschreiber und dessen Statthalter Daniel Schwarz
und seinen eigenen Hausknecht. Diese waren», sagt Bögli, «zum Teil
Leuenbergers persönliche Feinde. Wenigstens sollte einmal Leuenberger
den Seckelmeister im Adelboden zu Sumiswald (wahrscheinlich
an der grossen Landsgemeinde vom 23. April) aus dem Ring der
Bauern gewiesen haben mit den Worten: ,Thund mir diesen gottlosen
Mann ushin'...» Hingegen der Daniel Schwarz und der Niklaus Dubach,
beide von Lützelflüh, waren früher, wie Bieri, ebenfalls Mitglieder
der Bauernausschüsse Leuenbergers, mithin nicht weniger Verräter
an ihm als Bieri. Und wenigstens Niklaus Dubach hat daher
später «von der Obrigkeit ,ebenfalls einen silbernen Becher' als
gebührenden Lohn für seinen Verrat erhalten...» Sie alle mussten sich
dem Landvogt Tribolet gegenüber, wie Vock weiter berichtet, «zur
treuen Erfüllung dieses Auftrags mit einem Eide verpflichten. Vergebens
aber suchten sie den Leuenberger in seiner Wohnung; er hatte
sich denselben Tag von Haus entfernt und, wie sie vernahmen, nach
Signau begeben. Sie liefen ihm nach, erwischten ihn zwischen Siegenthal
und Ezlischwand und führten ihn spät in der Nacht nach Trachselwald.
Der Landvogt liess ihn nach kurzem Verhör in den Turm
werfen und mit Ketten beladen...» Von hier wurde Leuenberger
nun am nächsten Tag, mithin am 10. Juni, nicht wie Vock meinte,
direkt nach Bern, sondern, wie Bögli korrigiert, «nach Burgdorf geliefert
und dann am 12. Juni unter starker Bedeckung nach Bern geführt».
Nach Vock soll es der Zeugherr Samuel Lerber selber gewesen
sein, der Leuenberger nach Bern holte und die Bedeckung befahl;
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 623 - arpa Themen Projekte
Verhafteten aus Langnau, Signau und Höchstetten» nach Bern geführt
worden.
Leuenbergers «Einzug» in Bern am 12. Juni muss nach Vock
(der sich dabei auf einen Bericht des Zeitgenossen Hans Kaspar
Scheuchzer, des Regimentsschreibers im Zürcher Heer, beruft) ein
Spiessrutenlaufen in echt bernischem Herrenstil gewesen sein: «Vor
dem Eintritt in die Stadt Bern ward ihm ein hölzerner Degen und
eine aus Stroh geflochtene Schärpe angelegt, und es wurde sonst
noch allerlei Spott mit ihm getrieben. Mitten durch die dichten Reihen
einer grossen Volksmenge, deren beissende Spottreden er anhören
musste, wanderte der gewesene Obmann ins Gefängnis.» Nach der Eintragung
des servilen Griechischprofessors Haller in sein Tagebuch
unter diesem Datum kann man sich ungefähr einen Begriff machen
von der Gesinnung der verhetzten Spiessbürger, die die Berner Gassen
säumten; und nach derselben Quelle hat der arme Leuenberger das
Spiessrutenlaufen sogar zweimal an demselben Tage über sich ergehen
lassen müssen. Die Eintragung lautet: «2. (12.) hat man Niclauss Löwenberger
den Erzrebellen und Landtshauptmann mit noch 37 anderen
Rebellen gfängklich allher, durch 100 Musquetirer gebracht, Löwenberger
ward an einer Kette angefesslet, die anderen alle an einem
Seil an einanderen gebunden, in die Gefangenschaft by dem oberen
Spital, Titligers Thurm genampt, gelegt worden. Löwenberger hat man
von dem Thurm wider die Statt hinab zu dem Statschlosser gefürt, der
ihm beide Armen halt zusamen verschlossen.» So wurde er dann in
den sogenannten «Mörderkasten» gelegt. «Die Schlüssel dazu», berichtet
Bögli, «wurden dem Kriegsrat übergeben, als der Schultheiss Dachselhofer
sich wegen eines allfälligen Entweichens des Gefangenen verwahrte,
weil man die Türe zu dem Kasten offen gefunden habe.» Aber
der gottergebene Sektierer Leuenberger war gewiss nicht der, der gewaltsam
einen Ausbruch versucht hätte. Dazu war er auch jetzt noch zu
vertrauensselig, baute auf sein «gutes Recht» und auf die Gnade Gottes
und sogar auf die der Gnädigen Herren...
Das will jedoch nicht heissen, dass der Obmann der Bauernsache
dieser letzteren — wie er sie verstand -—- nicht bis zuletzt treu geblieben
wäre. Im Gegenteil bezeugt Bögli: «Leuenberger blieb bis zu seinem
Tode standhaft»! Aber er «berief sich fortwährend auf seine guten und
friedlichen Absichten bei der Leitung des Aufstandes, wie das aus seinem
Vergicht (Verhör) und seinem Gnadengesuch (es waren ihrer
zwei) zu ersehen ist... Uebrigens ist in diesem Gesuch geistlicher Einfluss
(!) und eine durch das Unglück und die Haft entstandene Niedergedrücktheit
nicht zu verkennen. Auch ist das daherige Reuebekenntnis
nur ein religiöses»! Die durch die «Haft» im «Mörderkasten» entstandene
«Niedergedrücktheit» ist nur zu begreiflich. Denn Rösli sagt: «Er
wurde lange gefangen gehalten, fleissig mit und ohne Folter verhört
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 624 - arpa Themen Projekte
noch glaubte, mit dem Leben davonzukommen?» Nach den zwei Gnadengesuchen
zu schliessen, scheint es so. Mit vollem Recht betonte
Leuenberger unermüdlich, «dass er im Bauernheere stets gute Disziplin
gehalten hatte». Wir brauchen uns nur zu erinnern, was darüber
Vock festgestellt hat: «Zu Ende Mai und mit Anfang Juni standen in
allen Gegenden bei 40000 Bauern unter den Waffen; dass, ausser in
ordentlichen Gefechten, als der Bürgerkrieg begonnen hatte, von ihnen
kein Mensch des Lebens beraubt wurde, darüber haben sich schon
die Zeitgenossen verwundert.» Wenn aber Leuenberger glaubte, sich
dadurch das Leben zu retten, so hatte er auch jetzt noch nicht die
Realität der Berner Herren erkannt. «Allein», schreibt Rösli, «der Regierung
kam es nicht darauf an, der Obmann der Bauern war für den
ganzen Krieg verantwortlich, er musste sterben.» Klarer kann nicht gesagt
werden, dass Leuenberger ein bloss politisches Opfer, das Opfer
der Berner Machtpolitik, war. Dies umsomehr, als Rösli — und fast
mit denselben Worten auch Bögli — feststellen muss: «Persönliche
Vergehen konnten ihm nicht zur Last gelegt werden.»
Endlich konnte wenigstens einer von den kapitalen Flüchtlingen
wieder eingebracht werden, deren Konfrontierung mit Leuenberger
den, Berner Herren besonders am Herzen lag. Es war Hans Konrad
Brönner, der Bundeskanzler des Huttwilerbundes. Er «konnte nach
dem Gefecht von Herzogenbuchsee nach seiner Heimat entfliehen»,
d. h. nach Badenweiler in der Markgrafschaft Baden. Auf Begehren
Berns aber wurde er ausgeliefert und über Solothurn nach Bern gebracht.
Vom 29. August datiert die solothurnische Bewilligung, «dass
der gefangene Schreiber Brönner, der sich in der Rebellion gebrauchen
lassen, durchgeführt werde». Am gleichen Tag noch kam er in Bern
an und wurde sofort mit Leuenberger konfrontiert. Ebenso nocheinmal
am 4. September, als er, wie nachher noch öfters, «mit und ohne
Folter verhört» wurde. Auch ihm war natürlich zum vornherein der
Henkertod gewiss. Aber er sollte noch mit Uli Galli konfrontiert werden,
der jedoch noch nicht wieder hatte eingebracht werden können,
und darum auch erst mit diesem sterben. Brönner scheint nichts zuungunsten
Leuenbergers ausgesagt zu haben, sonst stände das gewiss
in Leuenbergers Todesurteil. Dieses wurde endlich am 6. September
gefällt; sein Schluss hat folgenden Wortlaut (nach Vock):
«Und dieweil er, Leuenberger, in jetztangehörten, vielfältigen
Misshandlungen, als ein Haupt und Führer aller Rebellanten, seine
natürliche, von Gott eingesetzte Oberkeit im höchsten Grade beleidigt,
auch zu allen Mitteln verholfen, dieselbe auszurotten, so haben MGH
Herren Räth' und Burger, damit (liess gräuliche Laster der verfluchten
Rebellion, andern zum Exempel, gestraft werde, bei ihrem Eide zu
Recht erkennt und gesprochen: dass er dem Nachrichter anbefohlen
werde, der ihn, unten aus, auf die gewöhnliche Richtstätte führen, ihm
daselbst mit dem Schwerte das Haupt abschlagen, dasselbige mit dem
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 625 - arpa Themen Projekte
heften, den Leib aber in vier Stücke und Theile zerhauen, und an allen
vier Hauptstrassen aufhängen, und hiemit nach dieser löbl. Stadt Bern
Rechten vom Leben zum Tode hinrichten solle.»
Und so geschah es, nachdem ihm schon seit dem 3. September
Geistliche beigegeben worden waren, «welche ihn trösten und auf den
Tod vorbereiten sollten». Das Tagebuch unseres herrenfrommen Griechischprofessors
Haller, der alles dies bis in alle Kleinigkeiten ebenfalls
aufzeichnete, gibt noch das Detail, dass an dem «Bundtsbrief»,
der mit Leuenbergers Haupt an den Galgen «genagelt» worden ist,
auch «sechs Sigel von 6 Gemeinden gehänget» haben. Er fährt dann
fort: «Mit disem ist auch hingerichtet worden Bendicht Spring, der
Meyer von Schöpfen, ein rycher und ansehnlicher Landtmann, welchem
das Haupt abgeschlagen worden und selbiges mit sampt dem
corpore under dem Galgen begraben worden.» Es ist derselbe, der die
Bauerntruppen im Tiergarten bei Aarberg organisiert und kommandiert
hatte und überhaupt der bedeutendste Organisator des Widerstands
im Seeland war — neben Daniel Schluep von Rüti bei Büren,
der am 23. September enthauptet wurde, einem besonders feurigen
Volksmann, der das grosse Wort prägte: «Gott syge ihr Redliführer,
die Obrigkeit habe den Krieg angefangen...»
So hingen viele Wochen lang die vier Stücke dessen, der für
wenige Monate in den Augen des gesamten Schweizervolkes die strahlende
Verkörperung der wiederauferstandenen Volksfreiheit war, an
den vier Hauptstrassen der löblichen Stadt Bern, dort, wo diese Strassen
aus der Stadt ins Land ausfallen, und verkündeten mit den stummen
Schreien ihrer grässlich blutenden und faulenden Wunden dem
ganzen Schweizerland, dass seine Freiheit nun und für undenkliche
Zeiten in Stücke gerissen sei...
Inzwischen war auch das Basellandschäftler Volk durch Soldateska,
durch Marterverhöre und Schreckbussen und schliesslich auch
durch Köpfen und Hängen schmählich niedergeworfen worden, wobei
sich unter Wettsteins streng «religiösem» Sittenregiment die Geistlichkeit
als Aufhetzerin zum gnadenlosesten Blutgericht besonders abscheulich
hervortat.
Am 9. Juni, als die Bauernsame allüberall in der Schweiz bereits
am Boden lag, rückte der Hasenheld vom Aarauerzug, der Basler
Stadtoberst Zörnlin, mit einem Kriegsrat von drei Ratsmitgliedern,
einem Gemusaeus, einem Munzinger und einem Burckhardt, und «mit
200 Reitern und 500 Mann zu Fuss zur Besetzung des Kantons aus,
welche auch ohne allen Widerstand erfolgte», wie Heusler berichtet.
Unter der Soldateska, die in den folgenden Tagen noch vielfach vermehrt
wurde, waren viel ausländische Truppen aus Mülhausen und
Colmar und gewordene Landsknechte; aber auch 2 Kompanien «freiwilliger
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 626 - arpa Themen Projekte
man kann sich leicht denken, welche: nur die des geflüchteten Herrendieners
und künftigen Diktators Liestals, des Schultheissen Imhoff.
«Die Gemeinden wurden zu Ausstellung von Unterwerfungserklärungen
veranlasst (!)... Einige Teilnehmer an der Bewegung ergriffen die
Flucht, namentlich Is. Bowe und Hs. B. Roth.» Aber «der Empfang des
Militärs in Liestal war keineswegs freundlich, nicht nur waren alle
Läden geschlossen, alle Arbeit eingestellt, der Bürger nur wenige hier
und da zu erblicken, es wurden auch die Befehlshaber verschiedentlich
gewarnt, sich vorzusehen, die Bürgerschaft sei noch nicht ,just', sie
laufe hin und wieder, freilich ohne Seitenwehre, zusammen, da Schultheiss
Imhoff gewarnt habe, wer sich bewehrt erblicken lasse, werde
ohne weiteres niedergemacht werden...» Natürlich folgte nun der
Beschluss der «Herren XIII», «die Liestaler, weil ihnen nicht zu trauen,
zu entwaffnen, später auch die übrigen Aemter».
Jetzt ging die Jagd auf die «Rädelsführer» an. Auf Befehl des
Basler Rates musste sich beispielsweise die Liestaler Bürgerschaft am
15. Juni in der Kirche versammeln; ihr wurde eröffnet: «der Rat wolle
nicht die Unschuldigen mit den Schuldigen bestrafen, sie sollten daher
die Haupträdelsführer selber bezeichnen; Schultheiss Imhoff (!)
machte mit Nennung von 2 oder 3 den Anfang, worauf dann einer
den andern angab, so dass sofort 23 in den Freihof gebracht wurden,
die hier noch 7 andere angaben...» Ein erschreckendes Bild des Terrors!
«Hier blieben sie übernacht, in einem engen Gemach, so dass sie
fast vor Hitze erstickten; tags darauf wurden sie zu je 3 und 3 gefesselt
nach Basel gebracht... Der achtzigjährige Schultheiss Gysin» — der
der Sache der Freiheit treugebliebene — «wohnte der Gemeinde nicht
bei, weil er aber sonst ,das Maul gewaltig brauchte' und seinen Sohn
verteidigte, ja mit seinem alten Kopfe für dessen Unschuld einstehen
wollte, so wurde er in seinem Hause bewacht und später in einer
Kutsche nach Basel abgeführt. Auch in den übrigen Aemtern wurden
Verhaftungen vorgenommen, in Waldenburg 12, in Homburg 9, in
Farnsburg 8, im Ganzen also 59, wozu später noch mehrere kamen, so
dass am 16. Juni die Verhöre mit 78 Gefangenen beginnen konnten.»
Die historisch bedeutsamste Strafaktion in Basel war jedoch die
Entmachtung der alten freien Stadt Liestal. Am 16. Juni beschloss der
Basler Rat «auf Wettsteins Antrag (!) Abführung der Liestaler Geschütze,
Wegschaffung der Fallbrücken und Schutzgatter und die Errichtung
einer festen Brücke in Liestal, später wurde auch noch befohlen,
das Silbergeschirr und das Siegel der Stadt nach Basel zu schicken...»
Das war der Beginn der nun rapid fortschreitenden «Deprekation»
der alten, freien Stadt Liestal, ihrer Demütigung und schliesslich
vollständigen Beraubung um alle ihre Güter und Freiheiten. Denn
gerade dass es sich als freie Stadt in freier Selbstbestimmung auf die
Seite der Bauern gestellt hatte, «das gerade erschien besonders strafbar:
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 627 - arpa Themen Projekte
auf dieselben berufen hatte, Liestal, weil es trotz denselben sich auf
gleiche Linie mit den Bauern gestellt hatte. Es wurde daher die unabhängige
Stadtverfassung aufgehoben, der Schultheissentitel aber beibehalten.
Imhoff wurde Bürger zu Basel und blieb auf Lebenszeit im
Amt (!), ihm folgte 1658 Oberst Zörnlin (!) und dann andere Ratsglieder
von Basel. Der Rat wurde aufgehoben, es sollte nur noch Beisitzer
des Schultheissen geben, die vom Rat zu Basel aus dreifachem Vorschlage
gewählt werden. Das Geschütz wurde in Basel behalten, das
Siegel zerschlagen, das Silbergeschirr an die Kriegskosten genommen...»
Ein wahrhaft klassisches Beispiel für das freiheitvernichtende
Wüten des autoritären Absolutismus in der Schweiz — ein würdiges
Denkmal für den «grossen Eidgenossen» Wettstein, vor dem noch heute
unsere «demokratischen» Geschichtsschreiber auf den Knien liegen...
Aber die Liestaler haben den Basler Herren diese Demütigung und
Beraubung nie vergessen. Durch solche Aeusserungen, wie sie der Basler
Rat am 17. September 1653 ins Ratsprotokoll eintrug, wurde der
Zorn der Liestaler immer neu angefacht: «Der Liestaler eingebildete
Präsumption, Hochmut und Vermessenheit, sind die Ursache alles Uebels
und Unraths, ja, die rechte Wurzel und Ursprung der Rebellion...»!
Und der Zorn der Liestaler hat sich noch im Jahr 1798 als
revolutionäre Kraft erwiesen, da, wie Vock berichtet, «die Liestaler
in einem Volksauflauf am 11. Januar 1798 den Grabstein eines Abkömmlings»
des Herrendieners und «Schultheissen Imhoff zertrümmerten»
Auf die Henker-«Tagsatzung» in Zofingen hatten die «Herren XIII»
den Ratsherrn Benedikt Socin geschickt, mit der Instruktion, «wenn
man bei der Bestrafung der Rädelsführer zu mild verfahren wollte, so
soll er zu verstehen geben, wie schwer sich die Basler Untertanen verfehlt,
namentlich als sie schon Kenntnis vom Mellinger Vertrag hatten,
man solle daher Basel in der Bestrafung nicht hindern, und der Gesandte
solle Zürich an seine eigene Strenge bei den Wädenswiler Unruhen
erinnern»! «Die in Zofingen beobachtete Milde» (!!) wurde denn
auch «in Basel lebhaft getadelt», berichtet Heusler und fährt ehrenwerterweise
fort: «und dagegen (in Basel) ein Verfahren eingeschlagen,
das nicht nur den Begriffen unserer Zeit zuwiderläuft, sondern auch
damals schon vielfach übermässig hart gefunden wurde». Alle Bittschriften,
die von zahlreichen hochherrschaftlichen Kreisen einliefen,
würden vom Regiment Wettstein unnachsichtlich in den Wind geschlagen.
«Zu dieser Strenge wirkten», nach Heusler, «drei Kräfte zusammen...:
die politische, die kirchliche und die wissenschaftliche Autorität»!
Heusler führt dabei «die höchste politische Autorität» ausdrücklich
auf Wettstein zurück: «War er auch bei Führung des Prozesses
nicht unmittelbar tätig, so sind! doch die Strafurteils schwerlich ohne
seine Zustimmung erfolgt.» Er war speziell auch der Urheber und hartnäckige
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 628 - arpa Themen Projekte
«Denn Wettstein war eine strenge Herrschernatur und hatte von der
obrigkeitlichen wie von der vaterländischen Gewalt sehr hohe Begriffe»
— so nennt das, wieder in seinen «Schweizerkönig» verliebt,
der konservative Herrenchronist Heusler.
Aber auch was die kirchliche Autorität betrifft, gibt uns Heusler
sehr «zuständigen» Aufschluss: «Dieser politischen Autorität des grossen
Bürgermeisters stand die gesamte Geistlichkeit zur Seite. Die reformierte
Kirche lehrte das göttliche Recht der Obrigkeit, in der Schweiz
bestand sie in dem Staate und durch den Staat, die katholische dagegen
vor dem Staate und neben dem Staat.» Mit andern Worten: die
protestantische Kirche war wirklich nichts anderes als die gänzlich
dem Machtwillen der absolutistischen Herren unterworfene Sklavin;
und weil die katholische Geistlichkeit — vor allein die niedere im Kanton
Luzern — dem Bauerntum viel volksverbundener, weil freier vom
Willen der Lokalherren, gegenüberstand und «keineswegs der Bewegung
unbedingt feindselig» war, deshalb «klebte in den Vorstellungen
von Regierungen und Volk (?) der reformierten Kantone... fortwährend
der Bewegung etwas Papistisches an».
Tatsächlich finden wir bei Liebenau beispielsweise einen Erlass
der Berner Regierung vom 5. Juni 1653 zitiert, in der diese behauptet,
«dass bei ihren (der Berner Bauern!) gottlosen Zusammenkünften
Jesuiter und ander dergleichen Pfaffengesind befunden»; darum sollen
die Berner Bauern «schwören, bei dieser ihrer wahren und allein selig
machenden Religion (der protestantischen) zu verbleiben»! Schon am
18. Mai hatte der 78jährige Basler Domprediger Wolfgang Meyer den
Zürcher Bürgermeister Waser mit einem Schreiben aufgehetzt, in dem
er behauptete, der Bauernbund sei nichts anderes als eine raffinierte
«paptistische Agitation» mit dem Zweck, «neben der evangelischen Religion
auch den eidgenössischen Bund zu ruinieren und gänzlich aufzuheben:
denn die Artikel des aufgerichteten Bundes geben solches sonnenklar
zu erkennen...» Damit war vor allem der Artikel des Huttwilerbundes
gemeint, in dem die Bauern beider Konfessionen sich
«allersits den Religionen unbegriflich (unvorgreiflich) und unschedlich»
zu vereinen geloben! Von der anderen Seite versichert uns der
katholische Herrenchronist Liebenau, der dafür gewiss zuständig ist:
«Während aber die Pastoren von Basel und Bern im geheimen vor den
Jesuiten zitterten, scheinen die frommen Bürger des katholischen Vororts
der Eidgenossenschaft (Luzern) befürchtet zu haben, der Huttwiler
Bund werde die Luzerner Bauern zum Abfall vom Glauben,
ihrer Väter bringen...» Ja, die Regierung von Luzern erklärte in einer
an die Schiedsrichter in Stans gerichteten Klageschrift den Huttwiler
Bund offiziell als «eine Gefährde für die katholische Religion» — und
«hierin bestärkte sie ohne Zweifel Nuntius Caraffa», fügt Liebenau
bei. Darin waren sich die Herren beider Glaubenslager mithin durchaus
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 629 - arpa Themen Projekte
Verbrüderung der Bauern ohne Ansehen der Religion, schleunigst wieder
einzuebnen! Denn beide Herrenlager bedurften der ihnen konfessionell
zugehörigen Bauern als Soldaten in einem kommenden «religiösen»
Bruderkrieg — er brach nur drei Jahre später aus, im ersten
Villmergerkrieg! Und der warf jetzt schon seinen Schatten voraus in
den «frommen» Hetzaposteln beider Lager, die den Glaubensgraben
wieder aufrissen; insbesondere aber in dem wahrhaft «alttestamentarischen
Gesetzeseifer», mit dem die ganze, geschlossene Basler Geistlichkeit,
mit dem Antistes an der Spitze, bemüht war, das «papistische
Unwesen» der Bauernrebellion bei ihren eigenen Glaubens- und Landesangehörigen
zu entlarven und «exemplarisch» abzustrafen.
So erleben wir in Basel nicht nur (wie in Bern) «die Aufforderung
der Regierung an die Geistlichen, Schuldige zu nennen»; sondern wir
erleben es sogar, dass die Prediger der «christlichen Nächstenliebe» in
Basel es sind, die am 8. Juli ein «von Antistes Dr. Theodor Zwinger
unterzeichnetes Memorial» einreichen, «in welchem sie die in Zofingen
geübte unverantwortliche Schonung tadelten», und in dem sie sich
gegen die von verschiedenen Seiten an die Regierung gelangten «Fürbittschreiben»
wenden! Denn darunter waren auch mehrere katholische
— z. B. von der Aebtissin und vom Konvent des Klosters Olsberg und
von den «Commenthuren» von Beuggen und Rheinfelden... Aber das
ist natürlich nicht der Hauptgrund. Sondern dieses Memorial ist vermutlich
von Wettstein bestellte, sicherlich ihm zuliebe getane Arbeit,
um damit dem Schwert seiner Herrenrache an den Bauern «moralisch»
freie Bahn zu schaffen!
Dies «Memorial», das wir soeben mit den sanften Worten des konservativen
Herrenchronisten angekündigt haben, ist aber, um die Wahrheit
unverblümt zu sagen, von einer derart abgründigen Gemeinheit der
Gesinnung, dass es als Dokument der «christlichen» Schande, der
«frommen» Barbarei völlig einzig in seiner Zeit und in unserer Geschichte
steht! Da es aber nicht nur möglich, sondern höchst offiziell
war und da im Basler Blutgericht über die «Rädelsführer» des
Basler Anteils am Bauernkrieg strikte nach ihm gehandelt wurde,
müssen wir uns hier bei ihm aufhalten.
Zuerst gratulieren diese würdigen «Boten Gottes» dem Herrn Bürgermeister
Wettstein und sämtlichen «Gestrengen, Edlen etc. Gnädigen,
Gebietenden Herren» für die glückliche Verhaftung der «Rädelsführer».
Sie geisseln «die taubsucht der rebellischen Landleuten und underthanen
der Christlichen Obrigkeiten» und erklären sich «auff das
höchste erfrewet» durch «die gleichsam von dem hochen Himmel, von
dem Gott des Friedens zugesandte unerwartete Hülff, dadurch die verdamlichen
anschläge der verstockten Rebellen sind zu schanden gemacht..,
auch die fürnemsten Häupter und Redlinsführer dieser verfluchten
faction und auffruhr in E. G. und anderen Obrigkeiten gewalt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 630 - arpa Themen Projekte
im Namen der «edlen Gerechtigkeit' und des «Gottes der Barmherzigkeit'
— über das «Justiti-wesen droben in dem gehaltenen Eydgenossischen
Landsgericht zu Zofingen», dass es «auch die fürnemsten
Rebellen, Meutmacher und Verführer, welche den tode vielfältiger
weise verschuldet, umb eine geringe geltstraff» losgelassen habe, statt
dass «an solchen gottlosen Buben ein gebührendes Exempel hätte sollen,
anderen zum schrecken gesetzt werden». Das aber dürfe um keinen
Preis in Basel auch geschehen! Ansonst «E. G. verdriessliche beschwärlichkeiten
wurden zu besorgn sein». Der Sinn ist: schafft «die mutwilligen
Auffrührer in der Landschaft, welche das Teüffelische unwesen
angesponnen und angerichtet haben» so schnell und abschreckend wie
möglich aus der Welt! Schon aus Prestigegründen! Alsdann denunzieren
diese «Diener Christi» die «Manns- und Weibspersonen», die sie im
Gefängnis besucht haben, bei der Regierung, sie hätten noch im Gefängnis
«ehrrührige reden wider E. G. ausgegossen und getrieben»! Sodann
beschwören sie die Regierung «in dess gerechten Gottes namen,
der da ist ein Herr aller Herren, ein König aller Königen, es geruhe dieselbige...,
an mehrgedachten Personen die Gerechtigkeit dergestalten
zu üben, damit die ehr Gottes und seines Nammens dessgleichen ihres
eygenen Stands hochheit und unseres Vatterlands wolfahrt möge errettet
und erhalten werden». Nämlich so: «Es hatt Gott vorzeiten den
Richtern seines Volks gantz ernstlich befohlen, dass ihr aug den verführern
nicht schonen, dass sie sich über sie nicht erbarmen, noch sie
verbergen, sondern sie erwürgen und steinigen sollen. (Deut. 13, 8, 9,
10.) Bei dem Propheten Jeremia lässt sich Gott mit grossem Ernst verlauten:
verflucht sege, der dass werck dess Herrn lässig thut, verflucht
sege, der sein Schwert auffhelt, dass es nicht blut vergiesse (Jer. 48.
10)...» Dann kommen alttestamentliche Beispiele für den Fluch, mit
dem Gott den Versöhnlichen, der Schonung übe, verfolge; ein solcher
müsse schliesslich «in seinem selbs eigenen blut sterben. (Sam. 15.)»
Gott selbst habe «an der rebellischen Statt Liechtstall (Liestal) ein
extraordinari zuvor unerhörtes Gericht» vollzogen durch ein kürzliches
«erschreckliches Hagelwetter» und damit zeugen wollen,
«wass, seinem Exempel nach, christliche Oberkeiten in abstraffung
becher verbrechen zu thun haben»! Nicht vergebens habe Gott die
Obrigkeiten «mit seinem nammen gewürdiget und Götter genennet»!
Nach diesem im Original mit solchen Majuskeln dick aufgetragenem
Byzantinismus wird «nach dem zeugnuss Pauli' den Herren
eingeschärft, der «Herr der Herren» habe «ihnen das schwerdt... gegeben,
als rächeren, zu straff über die, so böses thun. (Rom. 13. v. 4.)»
Schliesslich wüten und schimpfen diese «Gottesboten» noch drei Seiten
lang unflätig gegen die Rebellen, machen der Regierung Angst, diese
hätten sich verschworen «nicht allein zu verschimpfung, sondern auch
zu unterdrückung dess Obrigkeitlichen Stands» etc. pp., und warnen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 631 - arpa Themen Projekte
der Verworfenen hereinfallen möge... Sie berufen sich dabei unverfroren
darauf, dass sie, die hohen Geistlichen, dies alles der Obrigkeit
«alss Diener Christi» ans Herz legen und brüsten sich damit, dass all
das «uns viel rühmlicher und anständiger seie als aber denjenigen,
welche understehen, den lauff der Gerechtigkeit zu underbrechen» —
womit sie diejenigen meinen, die Bittgesuche zugunsten der Angeklagten
eingereicht haben! Diese nämlich wollten die Regierung «zu einer verkehrten
und verdampten Barmherzigkeit» verleiten, «welche in dem
Grund nichts anders ist, drin eine Crudelitas oder Grausamkeit»!! Bis
zu dieser ganz unwahrscheinlich klingenden Perversion treibt der Blutdurst
und die Servilität diese «christlichen» Sadisten... Und sie verfehlten
nicht, zum Schluss auch noch die Gefahr an die Wand zu malen,
dass die Rebellen, sollte man sie frei bezw. am Leben lassen, gar
noch katholisch werden könnten, nämlich «vielleicht gar auch von
der Religion abzufallen sich wurden gelüsten lassen...» Was bei einer
solchen wahren Mörderreligion nicht ganz von der Hand zu weisen
wäre...
Für die wissenschaftliche Kultur des damaligen Basels vernichtend
ist das Urteil, das Heusler damit über sie fällt, dass er in unmittelbarem
Anschluss an die Besprechung der obigen «Vorstellung der
Geistlichkeit» sagt: «Ungefähr in gleichem Sinne gab auch die Wissenschaft
ihre Stimme ab.» Was durch ein wahrhaft jämmerliches «Rechtsgutachten»
erhärtet wird, das Heusler abdruckt und das einen damaligen
Professor an der Basler Universität zum Verfasser hat, der wie zum
hohn den Namen Jacob Burckhardt trägt...
Aber dieses «Rechtsgutachten» plädiert auf Todesstrafe genau für
alle die, die kurz darauf wirklich geköpft oder gehängt worden sind!
Hier ist es ganz offensichtlich, dass auch die «Wissenschaft» die feile
Magd der Gewaltpolitik der absolutistischen Herren war: Wettstein
wird dem «Professor» die sieben gewünschten Todesopfer in sein «wissenschaftliches
» Manuskript diktiert haben! Es waren dies: Uli Schad
und Gally Jenny aus dem Amte Waldenburg, Hans Gysin, der Schultheissensohn,
Heinrich Stutz und Conrad Schuler aus Liestal, Joggi
Mohler von Dietgen und Uli Gysin von Läufelfingen. «Am 22. Juli genehmigten
die Herren XIII dieses Bedenken (Rechtsgutachten), am 23.
der Rat und am 24. der grosse Rat, nach dessen Entscheide sofort die
Glocken geläutet, die Verurteilten vor das Steinentor geführt und die
Hinrichtungen, an Uli Schad mit dem Strange, an den 6 Uebrigen mit
dem Schwerte, vollzogen wurden.» Auch hier wurde natürlich, zum
Besten des Herrenregiments, das Vermögen der Hingerichteten zum
grossen Teil eingezogen, und so auch bei den zahlreichen anderen Verurteilten,
die, nach so und so vielen Marterverhören, mit dem Leben
davonkamen. Zu schweigen von denen, die «zu lebenslänglichem Dienen
wider den Erbfeind — das waren damals die Türken — auf venetianischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 632 - arpa Themen Projekte
bereits auf dem Wege auf die Galeeren, den Rhein entlang. «Aber die
Stimmung des Volkes gab sich hier heftig zu erkennen; schon in
Säckingen entstand ein grosser Zulauf von Bürgern und Bauern, welche
laute Schmähungen und Drohungen gegen die abführende Mannschaft
ausstiessen, und eine Stunde unterhalb Laufenburg wurden sie von
einer grossen Menge mit allen möglichen Waffen versehenen Bauern
überfallen, welche unter Androhung des Todes die Freilassung der
Gefangenen erzwangen, ja so rasend waren, dass die begleitende Mannschaft
ihr Leben nur der Fürsprache der Gefangenen zu verdanken
hatte...»
Ein schönes Sinnbild für die grosse Umkehr, die ein aufrechtes
Volk auch gegen starke Bedrücker erzwingen kann!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 633 - arpa Themen Projekte
XX.
Die letzten Tellenschüsse im Entlebuch
Zahlreiche entlebuchische, willisauische und bernische «Rädelsführer»
des Bauernkriegs waren in die wilde, einsame Berggegend um
den Hohgant, die Schrattenfluh und am Nordabhang der Brienzer Rothornkette
geflüchtet, d. h. in das Quellgebiet der bernischen und luzernischen
Emme und des Ilfis, im hinteren Schangnau, oberhalb Marbach
und bei Sörenberg. Darum hören wir, wenn auch naturgemäss
nur sehr vereinzelt, von geheimen Versammlungen der geflüchteten
Rebellen bald auf bernischem, bald auf luzernischem Boden dieses
Grenzgebiets. Dort führten sie ein offensichtlich sehr verbrüdertes
Leben, in dem sie von der Bauernsame diesseits und jenseits der Grenze
und «ohne Ansehen der Religion» kräftig und ausdauernd unterstützt
worden sein müssen, sonst hätten sie ihr Leben dort gar nicht
fristen können. Auch ist nicht einer von ihnen durch Verrat der Bevölkerung
an die Behörden ausgeliefert worden. Sie konnten sogar
in den Nächten heimlich ihre Angehörigen in den oft gar nicht weit
entfernten Heimatdörfern besuchen.
Folgendes aber ist ein durch Verrat eines Teilnehmers an solchen
geheimen Versammlungen, des nun zum direkten Spitzel gewordenen
Scheinrevolutionärs Hans Berger, uns bekanntgewordenes Bruchstück
aus dem Flüchtlingsleben in jenen Bergen. Liebenau berichtet es, hauptsächlich
aus einem Manuskript in der Berner Stadtbibliothek, und dieser
Bericht ist für uns deshalb von grosser Wichtigkeit, weil er uns vor
allem den ungebrochen fortlebenden revolutionären Willen der Uli
Galli-Partei, des linken Flügels der Berner Bauernbewegung, enthüllt,
dem ja auch der Verräter, Statthalter Berger, von jeher angehörte.
Aber auch der fortdauernde Zusammenhalt zwischen den Emmentalern
und den Entlebuchern, der durch diesen Bericht erwiesen wird,
ist für uns von grossem Wert: er bekundet das zähe Weiterleben des
überkantonalen und überkonfessionellen Bauernbundes/ Liebenau berichtet:
«Im August 1653 fand, nach einem Schreiben des Statthalters
Hans Berger von Steffisburg an Oberst Samuel Lerber in Bern (den
Hauptbeauftragten des Junkergenerals von Erlach für die Flüchtlingseintreibung!)
,eine neue Vereinigung zwischen einigen Entlebuchern
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 634 - arpa Themen Projekte
auf, wie der Rat von Bern seinen Gesandten an der Tagsatzung in Baden
berichtete», von wo es wieder durch ein «Schreiben des Ritters
Ulrich Dulliker an den Rat von Luzern vom 21. August 1653» weiterberichtet
wurde. «Allein auch hier», bemerkt Liebenau dazu, «konnte
sie die Luzerner Regierung nicht festnehmen.» An dieser «neuen Vereinigung»
«beteiligten sich Berg-Michel (Michel Aeschlimann von
Trachselwald), Hans Bachmann am Bucholterberg, (Hauptmann) Megert
von Münsingen, Christian Zimmermann in Schangnau in einer dem
Christian Zimmermann zustehenden Weid». Gern wüssten wir, wer
die «vielen Entlebucher» waren; aber den Berner Spitzel, der sich bei
der Berner Regierung verdient machen wollte, interessierte sich anscheinend
ausschliesslich für bernische Personalangaben.
Die Pläne dieser «neuen Vereinigung», die der Verräter Berger
enthüllt, waren — in Anbetracht des tragischen Zustands der Bauernsache
in der ganzen Schweiz — überaus kühne und weitreichende; andererseits
aber auch einschränkende, nämlich unter Ausschluss der
Stadtbürger, mit denen man schlechte Erfahrungen gemacht hatte:
«Man dachte an einen neuen Volksbund zwischen den Leuten von
Bern, Luzern, Freiburg und Solothurn, ,aber nur uf dem Land und nit
us den Stetten, denn sie wollen alle Sachen heimlich haben, wie sie
denn guten Anlass und Glimpf von den obanzognen Orten, von vielen
Landlüthen Verheissung haben. Und wöllen', berichtet Berger, ,diese
obanzogne Ort nemmen und die Statt Bern umbstürzen, samt der Statt
Thun, aber denen Landlüthen muss Nut geschehen, und ein Wiedervergelt
der Oberkeit geben, wie sie den Landlüthen gethan haben, und
eine andere Oberkeit in die Statt Bern sezen, und den armen und rychen
Landlüthen ihre Güter ledigen, und die Gültbriefen us den Stetten
usher räumen. Allein Predicanten, Gottshäuser und Spitäler wöllind
Sie bei Ihren Grechtigkeiten bleiben lassen'. Die Verschwornen
hatten, nach der Versicherung dieses Gewährsmannes, die Absicht, die
Bäume auf dem Murifelde umzubauen, in die Aare zu werfen und
durch Schwellen das Wasser bei den Mühlen zu stauen und von dort
in die Stadt einzudringen. Berger sprach auch die Vermutung aus, dass
die Verschwornen beim französischen Ambassador in Solothurn ,Niederlass'
haben.» Diese Denunziation oder Insinuation Bergers mag
übrigens, wie Liebenau vermutet, der Anlass für die Berner Regierung
gewesen sein, durch einen «Rathzedel» an die Geistlichen Berns vom
24. August diesen aufzuerlegen, «die Geistlichen sollen Leuenberger bei
der Vorbereitung auf den Tod und auf dem Wege zur Richtstätte fragen:
ob und was für sonderbare und heimliche Verstandnuss und Anlass
zwüschen Ihme, seinen Conjurenten, dem Ambassador wie auch
seinem Schreiber Baron sich verhalten»! Um sich bei den Berner Herren
den Kopf zu verdienen — denn Berger stand bei ihnen immer noch auf
der Todesliste — streicht übrigens dieser Verräter in seinem Denunziationsschreiben
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 635 - arpa Themen Projekte
musste, welch eine verleumderische Belastung das für den gefangenen
Leuenberger bedeuten musste. Berger rühmt sich darin nämlich: «er
habe schon durch Hinterhaltung eines Briefes, den der Kriegsrat der
Bauern aus Ostermundigen zur Zeit der Belagerung Berns ihm geschrieben,
das von den Entlebuchern zu Bern und von den Solothurnern
in Thun projektierte Blutbad verhindert». Liebenau schliesst seinen
Bericht mit den Worten: «Durch strenge Ueberwachung der Entlebucher
und Emmentaler hoffte man die Bewegung unterdrücken zu
können. Von den durch Berger verzeigten Leuten des Aufstandes hatten
sich die meisten schon durch die Flucht der Gewalt der Obrigkeit
entzogen.»
Bis auf einen: Uli Galli, den sichern Haupturheber des neuen Revolutionsplans,
wie er schon der Haupt-«Ursächer» des Thuner Handels
und wiederum der des ganzen Berner Bauernkriegs gewesen ist.
Er wurde eingefangen, wie, wissen wir nicht, und sein Ende war grausig.
Wie er der Erste war, so wird er der Letzte unter den Gerichteten
sein, von dem wir in diesem Bauernkrieg hören werden...
Noch immer hatten die Entlebucher nicht gehuldigt, obwohl alle
andern Luzerner Aemter schon längst auf die Knie geworfen worden
waren. Jetzt endlich, auf den St. Michelstag, den 28. September, das
spezifische Nationalfest der Entlebucher, sollte die Huldigung durch
die Luzerner Regierung erzwungen werden.
Jedoch, wie Vock nach Cysat-Wagenmann erzählt, «die genannten
Hetzer und Anstifter» (wir werden sie sogleich genauer und ausführlicher
kennen lernen, als Vock sie aufzuzählen weiss) «liefen des nachts
in den Dörfern herum, schimpften über die Grausamkeit der Regierung
gegen die hingerichteten Landleute, nannten sie meineidig und
treulos, weil sie die verheissenen und durch schiedsrichterlichen Spruch
festgesetzten Artikel den Aemtern noch nicht urkundlich habe zufertigen
lassen und dies auch wahrscheinlich niemals tun werde. Diese
und andere Verdächtigungen über die Regierung wurden nicht nur im
Entlebuch, sondern nach und nach auch in den übrigen Aemtern ausgestreut.
Die Wirkungen solcher nächtlichen Umtriebe brachen bald
zu Tage». «Allein» — so bezeugt Liebenau — «der Schwörtag war
schon da, ohne dass die besiegelten Spruchbriefe den Aemtern vorgelegt
werden konnten». Die «Hetzer und Anstifter» hatten also vollkommen
Recht mit ihren «Verdächtigungen» und die Entlebucher insgesamt
mit ihrem Willen, nicht auf etwas zu schwören, das sie gar nicht
kannten.
So nahte der Tag, an dem der alte Landvogt, Amrhyn, den neuen,
Melchior Schumacher, in sein Amt einführen und in dessen Hand im
Beisein des Schultheissen Dulliker, des Ratsherrn Kaspar Studer und
mehrerer anderer Ratsherrn, sowie des Leutpriesters Bissling «und vieler
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 636 - arpa Themen Projekte
werden sollte.
«Kurz vor der Ankunft des Landvogtes» aber — so berichtet Liebenau
— «erschien in Schüpfheim Hans Häller, der Däywiler Bauer»,
also einer der auf der Todesliste der Regierung stehenden Flüchtlinge,
und zwar ein Willisauer, «und veranstaltete im Hause des Weibels
Hans Krummenacher», des «Fuchs», des von der Regierung so
fleissig Gesuchten, «eine Besprechung unter den Unzufriedenen. An der
selben nahmen teil: Krummenacher und sein Sohn, Hans Stadelmann,
Kaspar Unternährer, Hinteruli», also alle drei Tellen (denn wenn es
auch früher der «lange Zemp» gewesen sein mag, der in diesem Trio
den «Erni von Melchthal» darstellte, so war dieser doch längst zum
Kapitulanten geworden und in dieser Rolle durch den jungen «Städeli»
ersetzt worden); ferner waren da: «Hans Stych, Jost Marbacher,
Christian Peter und Fridli Schnyder, Stoffe! Hurni und ein Schullehrer
namens Josef.» Auch der «Städeli» und der «Käspi» und der Hinteruli
standen auf der —längst willkürlich erweiterten — Todesliste der Regierung,
und von den andern, den neuen Namen, war mindestens Jost
Marbacher im Begriff, sich diese Ehre ebenfalls zu verdienen.
Hans Häller ging bei dieser illegalen Verschwörer-Versammlung
sehr systematisch zuwege: er «las zuerst das bekannte Manifest der
Tagsatzung in Baden vor». Dieses Schimpfmanifest gegen die Bauern
war in der Tat sehr geeignet, der herrschenden Volksstimmung im
Entlebuch neuen Auftrieb und zugleich der neuen Rebellion die historische
Grundlage zu geben, indem es in Erinnerung rief, dass der
Kampf kein bloss lokaler sei, sondern der geschlossenen Herrenfront
der ganzen Eidgenossenschaft gelte. Dann kam man zu den lokalen
Forderungen, die den konkreten Anlass dazu gaben. Es scheint, dass
diese von einem neuen Entlebucher Führer vorbereitet worden waren,
der selbst nicht auf der Versammlung erschienen war. Denn Liebenau
fährt fort: «Dann einigte man sich, der Schullehrer soll die von Christian
Schnyder aufgestellten Postulate verlesen, wonach die Gemeinden
dem Landvogt nicht schwören, bis die Bussummen nachgelassen (!)
für die Flüchtigen ein Generalpardon (!) erhalten, die Gefangenen befreit
(!), die Waffen zurückgestellt (!) seien.» Mithin ein komplettes
revolutionäres Programm! Denn dass die Regierung diese demagogisch
glänzend ausgedachten, weil ungemein populären Forderungen nur
der Gewalt folgend, nicht dem eignen Triebe, bewilligen würde, musste
jedem Entlebucher klar sein. Zugleich ist es ein echtes Programm der
Flüchtlinge, der geächteten und verfolgten Volksführer, die sich ihre
Bewegungsfreiheit zurückerobern wollten.
Dann aber wurde angeblich auf dieser Versammlung, um die neue
Rebellion sofort ins Werk zu setzen, ein richtiges Attentat organisiert,
das gegen die ganze Luzerner Herrengesandtschaft gerichtet war, deren
Ankunft unmittelbar bevorstand und die die Huldigung entgegennehmen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 637 - arpa Themen Projekte
sechs volle Jahre später gemachten Geständnis des jungen, wohl ehrlichen
und feurigen, aber anarchisch fahrigen Hans Stadelmann, der
1653 ein 22jähriger Bursch war, sich sehr wichtig nahm, Briefe an
den französischen Gesandten in Solothurn richtete und wie Staatsakten
zeichnete und sofort nach der hier behandelten Verschwörung
im Ausland verschwand, um 1659, bei einer heimlichen Heimkehr, verraten,
verhaftet, verhört und geköpft zu werden. (Nach einer andern
Angabe, die Liebenau an anderer Stelle macht, ohne den Widerspruch
aufzuklären, soll dies allerdings bereits im Jahr 1654 gewesen sein.)
Item, Liebenau führt über den weiteren Verlauf dieser Versammlung
auf Grund des späteren Verhörs «Städelis» aus:
«Dann schlug Jost Marbacher vor, man wolle den Schultheissen
und Landvogt umbringen; die 3 Tellen proponierten, man wolle gleich
die ganze Gesellschaft niedermachen. Weibel Krummenacher» aber —
so sagte «Städeli» später, nachdem er vermutlich im Ausland mit Krummenacher
zusammen war, wohl um diesen zu entlasten und ihm seine
Heimkehr zu ermöglichen, aus — «Weibel Krummenacher lachte zu
den Vorschlägen. Endlich einigte man sich, Städeli soll auf den Schultheissen
Dulliker zielen, Unternährer auf Landvogt Schumacher, Dahinden
(Hinteruli) auf Landvogt Ludwig Amrhyn. Stadelmann versichert,
der Tell (Käspi Unternährer) habe bei 500 Gulden an Geld
bei sich gehabt und ihn durch Vorspiegelung einer Belohnung zur
Teilnahme am Attentate bestimmt. Weibel Krummenacher dagegen
habe erklärt» (siehe oben!): «Der Mord des Landvogtes nütze dem
Tell (Kaspar Unternährer) nichts; er solle das Attentat bleiben lassen;
denn wenn auch die ganze Gesellschaft niedergemacht würde, kämen
wieder andere Herren...» Damit hätte dann Krummenacher der
«Fuchs» in der Tat eine kapitale Weisheit ausgesprochen!... «Der
Däywiler Bauer Hans Häller aber ermunterte zum Attentate, indem er
sagte: wenn schon Volk (gemeint ist Kriegsvolk, Regierungstruppen)
ins Land käme, so wollte er gleich stürmen lassen; sogleich habe er
aus dem Amte Willisau das Volk beieinander, um das Land zu schirmen.
»
Genug: «Zur festgesetzten Zeit ritt der Landvogt, begleitet vom
Schultheissen Dulliker und mehreren Ratsherren, sowie dem neuen
Landvogt Schumacher, in Schüpfheim ein. Als die Huldigung vor sich
gehen sollte, trat Jost Marbacher auf und sprach infolge des ihm von
Christian Schnyder erteilten Auftrags: wir schwören nicht Treue, wenn
ihr nicht zuvor die Gefangenen und Verbannten begnadigt, uns die
Busse von 3000 Gulden erlasset und die Waffen zurück gebt. Im gleichen
Sinn sprachen auch Jakob Lötscher und Melchior Bircher.
Schultheiss Dulliker und Leutpriester Jakob Bissling ermahnten das
Volk umsonst zum Gehorsam. Ihre Reden wurden vom Lärm der
Leute von Schüpfheim und Hasle übertönt. Da rief der alte Landvogt
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 638 - arpa Themen Projekte
davon, wer schwören will, folge mir nach! Pfyffer und die Abgeordneten
von Luzern traten auf eine Seite, ihnen folgten viele (?). Allein
die Mehrzahl der Leute von Hasle und Schüpfheim machte sich davon.
Als am Abend die Gesandten im Wirtshause sassen, machten einige
Entlebucher den Antrag, jetzt schon die Luzerner zu überfallen und
niederzumachen. Allein andere, namentlich Weibe! Hans Krummenacher»
(siehe oben!) «von Schüpfheim, widersetzten sich, ohne das
Vorhaben ganz vereiteln zu können...»
Denn in der Nacht bezogen die eigentlichen Verschwörer ihre verabredeten
Posten «in einer hohlen Gasse», wie Vock sagt, um der am
frühen Morgen des 29. Septembers nach Luzern heimkehrenden Ratsdeputation
aufzulauern. «Beim Büggenschachen», wie Liebenau präzisiert,
«in der Nähe der Brücke zwischen Schüpfheim und Hasle, standen
(Käspi) Unternährer, Hinteruli und Stadelmann, jeder mit einem
gezogenen Feuerwehr und einer Pistole und einem Seitengewehr bewaffnet.
Den ersten Schuss tat Kaspar Unternährer, der Tell; er traf
den Zeugherrn Studer mitten durch das Herz, sodass er nach einer
Stunde starb. Die drei folgenden Schüsse von Hinteruli, Stadelmann
und Unternährer waren auf den zwischen Georg Balthasar und Karl
Christoph Fleckenstein rettenden Schultheissen Ulrich Dulliker gerichtet.
Die eine der Kugeln durchbohrte das Pferd, die andere, von Stadelmann
abgefeuert, das rechte Bein des Schultheissen. Stadelmann versichert...,
er habe auch zuerst die Flucht ergriffen, nachdem er mit
einem letzten Schusse aus einer Pistole auf Landvogt Ludwig Amrhyn
gezielt, aber statt desselben das Pferd des Kommissars (Bislig) in die
Nase getroffen... Nach dem Attentate kehrten die Missetäter in das
Haus des Stadelmann zurück, wo sie dessen Schwester bewirtete; niemand
hatte das Attentat gesehen, ausser Jakob Studer. . Studer...»
«Als die Kunde von dem Attentate nach Schüpfheim gelangte,
wurde sofort Sturm geläutet. Stadelmanns Schwester ging deshalb ins
Dorf, um sich zu erkundigen, was man zu tun gedenke. Bald brachte sie
die Kunde, dass die Mörder für ihre Sicherheit sich nicht zu bekümmern
haben, indem man sie nicht fangen wolle. Man habe nur gelacht
und gemeint, ,es sei wohl gegangen'. Darauf sei auch des Tellen Frau
gekommen und habe gesagt, sie sollen nur ins Dorf kommen, ,es werde
den Herrn niemants nüt leids thun'. Darauf seien sie wirklich ins
Dorf gegangen, dort haben sie drei Bekannte getroffen..., die ihnen
auf offenem Platze Wein bezahlten... Bald darauf trafen sie den
Landeshauptmann Nikolaus Portmann mit seiner Frau und einem
Berner Minder...»
Dieser Niklaus Portmann war ja zwar der, der mit dem Landesfähnrich
Niklaus Glanzmann zusammen neben dem Landespannermeister
Hans Emmenegger Monate lang an der Spitze des Aufruhrs gestanden
hatte — und dennoch nicht bestraft worden war! Aber sowohl
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 639 - arpa Themen Projekte
Luzerns in einer zweifelhaften Rolle gesehen haben, waren
inzwischen zu völligen Kapitulanten geworden und mit der Regierung
in heimliches Einverständnis getreten. Darum kann Vock von beiden
melden, sie «wurden nicht nur verschont, sondern in ihren Stellen befördert»
— und in der Tat ist Portmann später der Nachfolger seines
von ihm verratenen Freundes Hans Emmenegger im Amt des Landespannermeisters
geworden...
Portmanns Verräterrolle muss in dem Augenblick, als er den
«Mördern» —d. h. den dem Freiheitskampf des Volkes, wenn auch auf
echt bäuerlich-anarchische Weise, Treugebliebenen — begegnete, schon
bekannt gewesen oder von den letzteren wenigstens geahnt worden
sein. Denn «Stadelmann und ,Käspi' redeten den Landeshauptmann
an, bestürmten ihn,, er solle das ,Landrecht' zu erhalten suchen und
für die Befreiung der Gefangenen sich verwenden: sonst werden sie
ihm Haus und Heim verbrennen»!
Dieses Verlangen Käspis und seiner Kampfgenossen, «das Landrecht
zu erhalten», ist ein kostbarer Fund in dem Zufallsgemisch von
Quellen, die nur höchst dürftig oder fast gar nichts über die wirklichen
Pläne der in verzweifelter Lage für ihre Freiheitsidee weiterkämpfenden
Bauernführer zu berichten wissen. Dieser Fund erhellt blitzartig, dass
Käspi Unternährers Partei nicht auf «Mord» ausging, wie die Herrenchronisten,
auf die wir allein angewiesen sind, dies durchweg darstellen
—vielmehr bis zum letzten Atemzug von der heiligsten Begeisterung
für die Volksfreiheit durchglüht waren!...
Doch führen wir das Geschick dieser «Mörder» der Freiheitsmörder
hier, sogut es nach diesen Quellen geht, zuende. «Aus Furcht» (!)
berichtet Liebenau weiter, «lud der Landeshauptmann Niklaus Portmann
in der Klus die Mörder am Abend auf das Rathaus ein, wo er
ihnen Wein schenkte. Von hier begaben sie sich zu Krummenacher,
dem sie den Verlauf des Attentates erzählten, ,dem es', wie Stadelmann
deponierte, ,wohlgefallen und gelachet, denn er Rath und That darzugeben'!»
Vielleicht hat der «Fuchs» wirklich eine solche schwankende
Doppelrolle gespielt und jetzt wieder an einen Erfolg der Revolution
geglaubt, während er vorher daran zweifelte?... Am anderen Morgen
gingen die drei Tellen sogar bewaffnet zur Kirche...
Im Volk war der Eindruck der Tellentat ein gewaltiger. Es scheint
tatsächlich von neuer Hoffnung auf die Freiheit aufgewühlt worden
zu sein. Selbst Liebenau muss berichten: «Im Entlebuch scharte sich
das Volk bewaffnet zusammen. Etwa 200 Mann versammelten sich...
und begannen ernstliche Verteidigungsanstalten zu treffen.» Sie haben
sogar «auch die Befreiung einer grösseren Anzahl Verhafteter von den
Landesbeamten ertrotzt». «Allgemein hiess es, wer die Tellen verrate,
werde es mit dem Leben büssen!» Sie konnten sich ein paar Tage lang
frei im ganzen Land bewegen, und so konnte noch am 1. Oktober Käspi
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 640 - arpa Themen Projekte
sein, in 4 Wochen gebe es eine andere Regierung»! «So begann im
Entlebuch ein reges Leben, als stände ein neuer Krieg bevor...»
Aber die Gegenwirkung aus Luzern konnte nicht ausbleiben. Vock
berichtet: «Als die Nachricht von der grässlichen Tat durch die Luzerner
Herren, die blass vor Schrecken nach Hause kamen, sich in der
Hauptstadt verbreitete, entstand grosse Bestürzung. Eilig liess die Regierung
hinlängliche Truppen sammeln und ins Entlebuch nach
Schüpfheim vorrücken.» Da aber zeigte sich noch einmal eindeutig,
welcher Gesinnung das Volk ganz allgemein war. «Als die Truppen von
Luzern», erzählt Liebenau, «abends um 5 Uhr im Entlebuch eintrafen»
— er sagt nicht an welchem Tag, aber es wird der 2. Oktober gewesen
sein —, «zogen sich die Landleute scheu vor ihnen zurück. Sie
erhielten nicht einmal Brot zu essen oder andere Nahrungsmittel...»
Auch waren sie genötigt, «in der Kirche Quartier zu beziehen». Selbst
der Pfarrer wagte «den Luzerner Offizieren nicht einmal ein Bett
in seinem Hause anzubieten... Sie mussten mit den Soldaten in der
Kirche auf Stroh schlafen». Und die beiden Hauptleute der Luzerner
Herrentruppen — ein Pfyffer und derselbe Hauptmann Keller, der unter
Zwyer den Schybi eingefangen hatte — waren von alledem so beeindruckt,
dass sie der Regierung rieten, «mit den Entlebuchern ein
gütliches Abkommen zu treffen, damit nicht auch die übrigen Aemter
wieder zu den Waffen greifen. Denn sie haben sich überzeugt, dass die
Halsstarrigkeit dieser Leute immer mehr steige, wenn man mit Schärfe
auftreten wolle»!
Die Antwort der Regierung darauf war: mehr Truppen, mehr Geschütze
und die Sendung forscherer Offiziere, des alten und des jungen
Hauptmanns Krespinger und schliesslich ihres Oberstrategen Sonnenberg.
Denn schon «weigerten sich» die im Amte Willisau aufgebotenen
Truppen, «ins Entlebuch zu marschieren». Am 4. Oktober, abends
5 Uhr traf der luzernische Oberbefehlshaber mit «wackeren» neuen
Truppen in Schüpfheim ein.
Und nun ging eine neue Jagd auf Rädelsführer, besonders auf
die «Tellen» an. «Bald da, bald dort suchten die Tellen Unterkunft.
So war Städeli wohlgeborgen in der Alp Reistegg, wo Hans Müller
für Speise sorgte. Zeitweise waren die Tellen auch in dem durch einen
Scheiterhaufen zugedeckten Keller des Hans Rych untergebracht...»
Mit andern Worten: das Volk hütete seine Freiheitskämpfer wie seinen
Augapfel! Militärisch aber war es gegenüber der aufgebotenen Regierungsarmada
machtlos.
«Am 6. Oktober hatten die beiden Kommandanten von Luzern sich
überzeugt, dass die Entlebucher keinen Widerstand leisten werden. Sie
suchten zwar durch Streifkolonnen die flüchtigen Mörder einzubringen,
überzeugten sich aber bald, dass die Entlebucher freiwillig diese
Mörder nicht ausliefern werden. Da verriet ein Knabe, lüstern nach
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 641 - arpa Themen Projekte
kann auch einfach das unwissende Opfer einer Ausfrage gewesen
sein!), «den Aufenthaltsort der Mörder in der Scheune des Hofes Oberlinden.
Sofort rückten die Truppen vor den bezeichneten Platz in
Schüpfheim (!), untersuchten selben. Aber nur Kasper Unternährer,
der Teil, und Hinteruli, der Stauffacher, fanden sich in jenem Momente
in der Scheune, Stadelmann hatte sich bereits aus dem Staube gemacht.
Die beiden unwürdigen (!!) Tellen wollten sich nicht ergeben, sondern
flohen, mit grossen Schlachtschwertern bewaffnet, auf das Dach der
Scheune. Während der eine der Tellen mit dem Schwerte in der Wut
der Verzweiflung die Soldaten zurücktrieb, schleuderte der andere auf
dieselben grosse Steine, mit denen Scheunen und Häuserdächer des
Entlebuchs in jener Zeit belegt waren. Da wurden die Soldaten» — die
die beiden Tellen lebend hätten fangen sollen — «gezwungen, die ruchlosen
Mörder (!!) vom Dache herunter zu schiessen», — «wie Vögel von
den Bäumen», ergänzen wir aus Cysat-Wagenmann.
Das also war das Ende der «ruchlosen Mörder» und «unwürdigen
Tellen», wie der Herr von Liebenau fürstlich-deutscher Herkunft die
Stirn hat, unsere Freiheitshelden zu betiteln — während der alte Domdekan
Alois Vock, zu seiner Ehre, die Tellen doch wenigstens im Tode
rühmt, «deren Tapferkeit in anderen Verhältnissen (!) den Ruhm der
alten Schweizerhelden erreicht hätte...»
Und doch war das noch nicht ganz das Ende, das die Luzerner
Herren den beiden Freiheitshelden des Entlebuchs zugedacht hatten.
Die Leichname dieser «Erzrebellen» nämlich wurden bereits am andern
Tag, am 7. Oktober, nach Luzern gebracht — und dort «ward
ihnen, als ob sie noch lebten, der Prozess gemacht»! Am 9. Oktober
1653 nämlich fällte der Grosse Rat zu Luzern — nach Liebenau —
folgendes Urteil:
«Die Leichname dieser Erzrebellen, welche zur Zeit die Boten
aufgezäumt, den ersten Aufruhr begonnen, sich als Tellen gekleidet,
viele Leute verführt, die Obrigkeit verlästert, durch Drohungen mit
Mord und Brand das Publikum erschreckt, den Ehrengesandten getrotzt,
vor die Stadt gezogen, in Schüpfheim Gefangene gewalttätig
befreit und das Attentat auf die luzernischen Gesandten verübt, sollen
auf das Hochgericht geschleift werden. Dort sollen die beiden enthauptet
werden. Unternährers Kopf soll auf den Haberturm aufgesteckt,
der Leib gevierteilt werden; je ein Teil soll auf dem Hochgericht in
Willisau, Entlebuch, Buholz (bei Ruswil) und Münster aufgehängt
werden. Dahindens (Hinterulis) Kopf und rechte Hand soll man abhauen
und in Entlebuch ausstellen, den Leib rädern. Die Häuser der
beiden Missetäter sollen zum Scheuen und Exempel für die bösen Buben
abgerissen und zerstört werden.»
So glaubte man in Luzern, den Freiheitswillen des Entlebuchs
für immer ausgerottet zu haben. Aber Jost Marbacher setzte Käspis
revolutionäre Tradition fort. Noch im Jahr 1659 gelang es ihm beinahe
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 642 - arpa Themen Projekte
ihm beteiligte sich eifrig auch der Sohn des hingerichteten Pannermeisters,
Melchior Emmenegger, und der Sohn des hingerichteten Stephan
Lötscher... Und viele wurden abermals hingerichtet...
Aber selbst ein Liebenau muss berichten: «Als die Prozesse gegen
die Rädelsführer ihr Ende gefunden hatten, war der Widerstand des
Volkes noch nicht gebrochen, sondern manifestierte sich immer wieder
in den verschiedensten Arten. So sang man auf dem Lande das
,Tellenlied', welches den Anfang der Revolution bezeichnet hatte»,
und noch manche anderen «revolutionären» Lieder, insbesondere auch
solche eben auf die Rädelsführer! «Der Rat von Luzern verbot am 14.
September 1654 das Singen aller Lieder, die sich auf dieses leidige
Kriegswesen bezogen, da dieses nur ungute Gedanken verursache...»
Aber das Volk fand immer neue Formen, um für seine geliebten Helden
zu demonstrieren, beispielsweise fromme Stiftungen an Kirchen
und Kapellen, um für das Seelenheil der Rädelsführer Messen zu lesen!
So zum Beispiel: «Ein Krummenacher vergabte an die Kapelle zum
Heiligen Kreuz von Hasle ein kleines Gütlein zur Jahrzeitstiftung für
die hingerichteten Rädelsführer»...
«Und nun begann ein eigentlicher Heroen-Kultus» — d. h. eine
Heiligenverehrung der Rädelsführer! Ein Bauer Damian Huober von
Grosswangen soll im Jahr der Rebellion Jost Marbachers, und zwar im
September, im Monat des St. Michaelsfestes 1659, «der erste gewesen
sein, der... diese Bauernführer Heilige nannte, durch deren Fürbitte
viele Leute gesund geworden seien» — sicher politisch gesund! Er
musste allerdings «in der Kirche öffentlich seine frechen Reden widerrufen...»
Umso grossmächtiger wucherte die Volkssage. Man erzählte
sich zum Beispiel: «als einmal die Luzerner beim Papste zu Rom um
einen heiligen Leib angehalten, hätten sie zur Antwort erhalten: Ihr
habt daheim heilige Leiber unter dem Galgen, zieht vorerst diese zu
Ehren»!
Aber die Luzerner Bauern blieben nicht bei den Sagen stehen. Gesagt
— getan! Sie veranstalteten immer wieder neu sogenannte «Galgenfahrten»:
d. h. Wallfahrten zu den Richtstätten der Geköpften,
Gehenkten, Geräderten, Gevierteilten — mit einem Wort zu ihren geliebten
Rädelsführern! Schliesslich war ja auch Christus als «Rädelsführer»
des Volkes auf einer obrigkeitlichen Richtstätte ans Kreuz geschlagen
worden... Schon im Mai 1660 musste der Luzerner Rat zur
Bestrafung wegen dieser «Gräuel vor Gott» schreiten, «wölches nit allein
thorechter unerhörter und unchristenlicher Missbrauch..., unserem
wahren Catholischen glauben zu grossem Nachtheil und Ergernuss,
sondern auch ein Grüwel vor Gott und Abschüwen vor ganzer ehrbarer
Welt ist», welchem der Rat gezwungen war, als «einem vorbrechenden
Unheil ... vorzubiegen». Dieses «vorbrechende Unheil» war
für die «ehrbare Welt» der Räte von Luzern natürlich die Revolution!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 643 - arpa Themen Projekte
sollich abschülich und unehrbarlich Orth genzlichen zu enthalten»,
nicht nachlebe, «wellent wir selbige an lyb, leben, ehr und gut abstrafen»
— genau wie Revolutionäre selber!
«Selbst im Gebiete von Bern» — wie alles bei Liebenau nachzulesen
— «glaubte man an Zeichen und Wunder, die Gott habe geschehen
lassen, um die Sache der Bauern als die gerechte zu erweisen.»
So versicherte man beispielsweise in Lützelflüh, dass der dortige Prädikant
und Herrenspion, der Bauern den Herren ans Messer geliefert
hatte und «der am heftigsten die Bauern des Aufstandes halber beschuldigte,
von Gott sei gestraft worden», so nämlich, «dass er ganz
contract an allen Gliedern wäre und die Zunge nicht mehr regen, viel
weniger aber ein 'Wort sprechen könne» — geschweige das «Wort
Gottes»! Aber hatte nicht schon am 13. Juli, als eben fünf Tage vorher
der Lienhart Glanzmann, der Daniel Küpfer und der arme, achtzigjährige
Ammann Christen Wienistorf geköpft worden waren, «ein
Hochgewitter, das an den Häusern in der Stadt Bern grossen Schaden
anrichtete, das Hochgericht niedergeworfen, an dem die Köpfe von
drei Rebellen hingen, wie die Glieder des Schmieds von Grosshöchstetten,
der zur Vierteilung verurteilt worden war» . war»...?
So grollte es in den Tiefen des Volkes noch lange Zeit, bis ins
19. Jahrhundert. Noch im 19. Jahrhundert nämlich hiess es im Entlebuch,
auf die Frage, wer denn hier eigentlich die Gesetze der Herren
von Luzern halte: «Die Gesetze werden bei uns nur von den vier
Nägeln gehalten, mit denen sie am Brett angenagelt sind...»
Nicht lange nach dem tragischen Ende Käspis, des ersten «Ursächers»
des ganzen Bauernkriegs 1653, fiel auch Uli Galli seinem
Henkerherren in Bern zum Opfer. Uli Galli war nicht nur der erste
Urheber der Bauernbewegung in Bern und dann immer der konsequente
Führer ihres revolutionären Flügels. Er war nicht nur der
erste Bundstifter zwischen Emmentalern und den Entlebuchern und
damit der erste Anreger zum überkantonalen und überkonfessionellen
Bündnis der Bauern (schon 1641!) auf der Grundlage ihrer dauernden
Klasseninteressen wirtschaftlicher und sozialer Natur. Uli Galli war
vielmehr der erste «Ursächer» der echt revolutionären Bauernbewegung
in der Schweiz überhaupt, da er der Urheber und Anführer des
«Thuner-Handels» vom Jahr 1641 bereits ganz in dem eben gekennzeichneten
Sinne war. «Ursächer» und «Urheber» aber will ja nur
heissen: derjenige, um den sich die wirtschaftliche und soziale Not der
Bauern zuerst zum tätigen Bauernzorn, zur entschlossenen revolutionären
Tat verdichtete. In diesem Sinne ist das starke und bewusste
Individuum auch im Klassenkampf, auch in der überindividuellen
Revolution unersetzlich und — wenn es sich als solches darin bewährt
— mit Recht «unsterblich».
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 644 - arpa Themen Projekte
Gewiss haftete die anarchisch-willkürliche, auf den persönlichen
Impuls abstellende Methode der Revolution als Erbe ihrer Klasse allen
diesen bäuerlichen Revolutionären an, und vielleicht Käspi Unternährer
und Uli Galli, als den typischen und feurigsten Repräsentanten
der Bauernklasse, noch in höherem Masse als den andern. Leuenberger
macht nur in der moralischen Disziplin, die er in seiner Armee
aufrechtzuerhalten verstand, eine Ausnahme, sodass er in dieser Hinsicht
mit Recht die Verehrung und Bewunderung seiner ganzen Klasse
auf sich zog, über die er dadurch erzieherisch hinausragte. Politisch
aber hat zuletzt nur Hans Emmenegger seine Klasse überragt, und
zwar in klarer Einsicht ihres anarchistischen Grundfehlers. Denn noch
in seinem letzten hochnotpeinlichen Verhör hat er gerade diesen
Fehler an Käspi gerügt —nicht zur Belastung Käspis, sondern zur
Begründung des Misslingens der von ihm bis zuletzt hartnäckig aufrechterhaltenen
Revolution. Käspi habe, sagte er —und auch das ist ja
nur ein Zufallsfund in der so einheitlich herrenfrommen Quellenliteratur
— «alle zyt ufgestämpft und naher geloffen, es sy gemehret
gesyn oder nit», er aber, Emmenegger, habe «nie nützit ohne bysyn
etlicher geschworenen geschrieben», und natürlich auch nie ohne
Solidarität gehandelt. In dieser Gegenüberstellung des anarchischen
und des kollektiven Prinzips hat Emmenegger in der Tat den tiefsten
geschichtlichen Grund des tragischen Misslingens der Bauernrevolutionen
überhaupt aufgedeckt, den er vergeblich durch die Hinzuziehung
der Bürgerklasse und, nach deren Verrat, der Klasse der Hintersassen
zu beheben trachtete.
Aber Uli Galli steht mit seinem Henkertod deshalb doch nicht zu
Unrecht ganz am Schluss der grossen Bauerntragödie, ebensowenig
wie ihm sein Kampfgenosse Käspi in seinem revolutionären Heldentod
sinnlos vorangeht. Nach Uli Galli sind zwar noch viele «Rädelsführer»
—in Bern wie in Luzern —wieder eingefangen, hin und her ausgeliefert,
«grusamlich» gemartert und schliesslich, sogar noch Jahre
später, geköpft und gehängt und auch noch gebüsst und gerädert worden.
Aber keiner von ihnen reichte an die geschichtliche Bedeutung
Uli Gallis heran. Er ist die typische Verkörperung der Bauernklasse,
wie sie in ihrem Kampfe wirklich war, und ihm gehörte darum ebenso
gut ein Denkmal wie Leuenberger oder Emmenegger, Schybi oder
Käspi Unternährer.
Vielleicht weil die Berner Herren Uli Galli tatsächlich als das
empfunden haben, was er war, haben sie ihm ein so grausiges, von
ihrer Wut und ihrem Hass gezeichnetes Ende bereitet. Zwar lesen
wir zuerst nur von einem gewöhnlichen Henkertod, wie ihn auch viele
andere erlitten. Und zwar trägt ihn wiederum der hündisch herrentreue
Berner Griechischprofessor Haller in sein Tagebuch ein. Es war
am 4. November 1653, als Uli Galli und Hans Konrad Brönner zusammen
starben. Haller zeichnet auf: «Ist Uli Galli us der Kilchhöri Langnaw
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 645 - arpa Themen Projekte
mit dem Strängen hingerichtet worden.» Er starb also den
schändlicheren, den eigentlichen Lumpentod. Dagegen: «Eodem mit
ihme Peter (soll heissen: Hans Konrad) Brönner, gewäsner Schryber
von Münsingen, welcher in der Rebellion Kriegsrathschryber gewäsen,
mit dem Schwärt hingerichtet und syn Kopf uf den Galgen geheftet
worden.»
Aber nicht das ist das allerletzte Ende Uli Gallis! Viele Monate
lang hängt er am Berner Herrengalgen, an dem schon so viele Köpfe
tapferer Mitstreiter verwesen. Es wird Mai —und immer noch hängt
Uli Gallis Leichnam am Galgen. Und noch immer nicht ist der Hass
der Berner Herren gegen die Volksfreiheit gestillt, die wiederaufgestanden
war und den Herren so viel Beschwerden gemacht hatte.
Nocheinmal müssen sie darum am Vorkämpfer der Volksfreiheit, an
Uli Galli, ihre Wut auslassen, und sei es auch nur an seinem verwesten
Leichnam! Denn im Mai 1654 trägt der Professor Haller in sein Tage
buch ein:
«Im Maio hat man den erhenkten Uli Galli von dem Galgen abgeschnitten,
welcher hernach us oberkeitlichem Befelch vom Meister
Michel, dem Scharpfrichter, widerum mit einer Ketten under den
Armen uffgehenckt und der abgehowene Kopf an das Corpus gesetzt
worden, ist dieser also :um anderen Malen gehenckt und einmal geköpft
worden.»
Ein Sinnbild —ein grausiges, wahrlich —für die totalitäre Herrengewalt
und autoritäre «Herrenkultur», die nun auf dem ganzen
Schweizervolk lastete! Bis eine andere, grössere Revolution mit vielen
andern Völkern auch das Schweizervolk befreite... Und das ging in
Bern bis in das Jahr der Vergeltung —
1798!
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 646 - arpa Themen Projekte
Nachwort
«So endete dieses denkwürdige und traurige Drama mit dem
Triumph der Tyrannei, mit der Verfestigung der Patrizierherrschaft
und der Vernichtung aller öffentlichen Freiheiten... Die Aristokratie
war an die Stelle Oesterreichs getreten und erwies sich als nicht weniger
barbarisch. Aber sie war hundertmal verbrecherischer, weil sie sich
weder durch ein sogenanntes historisches Recht, noch durch ein vergebliches
Recht der Eroberung rechtfertigen konnte.»
So urteilte im Jahr 1852 ein weisser Rabe unter den schweizerischen
Historikern, J. N. E. Berchthold in seiner «Histoire du Canton de Fribourg»,
die mir ein glücklicher Zufall noch kurz vor Abschluss dieses
Buches in die Hände spielte. Und Berchthold war sich dessen bewusst,
dass er mit seinem Urteil über den schweizerischen Bauernkrieg allein
stand. Trotzdem er als Geschichtschreiber eines Kantons, der nicht
direkt in diesen Krieg verwickelt war, dessen Verlauf nicht erschöpfend
behandeln konnte, ging er doch mit solchem Ernst und mit solch teilnehmendem
Verständnis auf den tieferen geschichtlichen Sinn dieses
Ereignisses ein wie kein zweiter Geschichtsschreiber der Schweiz,
und dies zwar mit der ausdrücklichen Begründung: «weil die
Historiker, die ihn (den Bauernkrieg) bisher behandelt haben, sogut
wie alle nur Organe der Siegerpartei, dem demokratischen Standpunkt
vollkommen fremd geblieben sind». «Mehr noch», sagt er an einer
späteren Stelle, «es ist als wetteiferten sie untereinander, wer ein Volk,
das nach Freiheit strebt und für die Freiheit kämpft, am schärfsten zu
verurteilen vermöge»!
Wer unserer Darstellung bis hierher gefolgt ist, weiss, dass hierin
auch nach der Zeit Berchtholds, bis auf den heutigen Tag, kein Wandel
eingetreten ist. Dabei handelt es sich' beim schweizerischen Bauernkrieg
nicht nur um «eine der tragischsten Episoden der Schweizergeschichte»,
sondern, wie Berchthold weiter sagt, zugleich um «eine der
grossen menschheitlichen Fragen, die sich auf dem Theater unserer Nationalgeschichte
abgespielt haben», eine Frage, «die sich in blutigen
Ereignissen ausdrückte und die durch Gewalt gegen alle Wahrheit
und Gerechtigkeit entschieden werde». «Noch nie war in der Schweiz»,
so sagt Berchthold weiter unten, «der Kampf zwischen den beiden
Prinzipien (der Tyrannei und der Freiheit) in zugleich solch kolossaler
und solch dramatischer Weise entbrannt.»
Wir haben deshalb in der vorliegenden Darstellung gerade das
zu tun versucht, was Berchthold im Jahre 1852 forderte — wenn er
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 647 - arpa Themen Projekte
so sagt er, «muss heute den Flecken auslöschen,
den sie dem zweiten Erwachen der Demokratie in der Schweiz aufgeprägt
hat.» «Die Geschichte», die Berchthold schon zu seiner Zeit —
zweifellos dank der Neugründung der Eidgenossenschaft im Jahr 1848,
die dem Freiheitskampf des Sonderbundskrieges gefolgt war — als
«wieder auf die Höhe ihrer Würde gebracht» empfand, «muss die Erinnerung
an die ruhmreichen Opfer wieder heraufbeschwören, die sich
der Sache des Volkes hingaben; sie muss ihr Gedächtnis wiederherstellen
und ihre Namen in unsterblichen Zügen eintragen».
Wir haben seit Berchtholds Zeiten gelernt, dass es nicht nur, wie
er noch meinte, die «Oberflächlichkeit» der Historiker war, die das
Bild der Volkshelden des Bauernkriegs verdunkelt hat —vielmehr die
Klassenfeindschaft, bewusste oder unbewusste, die noch immer der
Geschichtschreibung der Herren die Feder gegen diejenigen geführt
hat, die das Unglück hatten, die Opfer der Herren zu werden. Dennoch
können auch wir die Worte an den Schluss unserer Darstellung des
Bauernkriegs setzen, mit denen schon Berchthold die seine beschlossen
hat:
«Die oberflächlichen Menschen sind in die erschreckende Alternative
gestellt, entweder Wilhelm Tell als verworfenen Mörder zu verdammen,
oder auch die Helden des Entlebuch auf seine Höhe zu erheben.
Die öffentliche Meinung, gerecht gegenüber dem ersteren, muss
es auch gegenüber den letzteren werden. Die drei Tellen werden einen
glänzenden Platz unter den Märtyrern der Freiheit einnehmen. Unternährer,
Hinteruli und Stadelmann» —fügen wir hinzu: auch, und in
erster Linie, Emmenegger, Uli Galli und selbst Leuenberger, trotz all
seiner Fehler — «sind vielleicht nicht sehr wohlklingende Namen;
aber ihre wilde Harmonie wird den Schrecken in die Seele der Tyrannen
aller Länder und Zeiten tragen. Sie sollten in goldenen Lettern
auf alle Monumente der Demokratie eingegraben werden.»
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 648 - arpa Themen Projekte
BAUERN-KÄMPFE
zu Beginn des:
Feudalismus [ Absolutismus Kapitalismus Sozialismus
Bauern
unverbündet
Bauern verbündet
mit
ökonomisch reaktionären
oder unentwickelten
Gesellschaftsklassen
mit
ökonomisch revolutionären
aufsteigenden
Gesellschaftsklassen
Das Endergebnis:
Niederlage
Niederlage
Vorübergehender
Erfolg Dauernder
Sieg
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 649 - arpa Themen Projekte
Literatur zum Schweizerischen Bauernkrieg
A. Quellen
(nur publizierte; Auswahl):
Eidgenössische Abschiede aus dem Zeitraum von 1649-1680. Bearbeitet
von A. Pupikofer u. J. Kaiser. Bd. VI, 1. Frauenfeld 1867. [Der Bundesbrief
von Sumiswald und Huttwil: S. 163 f.; auch in: W. Oechsli,
Quellenbuch zur Schweizergeschichte, 1. Auflage 1886, S. 365 f.;
ebenso in: C. Hilty, Die Bundesverfassungen der Schweiz. Eidgenossenschaft,
Bern 1891, S. 228 ff.]
«Lucretius de Pravedan» [=Ludwig Hartmann, zeitgenössischer Stadtschreiber
von Luzern], Manifest, oder ausführlicher/gründlicher Bericht
Der Streittigkeiten zwischen Lobl: Statt Lucern an einem und
Land Entlibuch/sampt andern ihren Aemtern, Vogteyen und Unterthanen
andern Theils... Item Extract des ersten und andern Vergleichs,
und was für Excess über Disa von den Bawren vorgegangen.
Ohne Ortsangabe [=Luzern] 1653.
Johann Konrad Wirz [zeitgenössischer Pfarrer in Zürich], Ohnparteysche
substanzliche Beschreibung der Eydgenössischen Unruhen
im Jahre 1653. Neudruck in: Historische und critische Beyträge zu
der Historia der Eydgenossen, herausgegeben von Bodmer und Breitinger,
III. Bd., Zürich 1739.
—Geschrieben unmittelbar während und nach den Ereignissen, auf
Grund direkter Mitteilungen aus den Kreisen des Zürcher Rats und
der Generalität (Werdmüller). Von der Zürcher Regierung auf Verlangen
der Berner Regierung während der Drucklegung im August
1653 unterdrückt (wobei das getreue bärtige Bildnis Leuenbergers —
unsere Abbildung 6 —eine Hauptrolle spielte). Herrenfromme Hauptquelle
für zahlreiche andere, zeitgenössische und spätere Darstellungen.
Manche andere zeitgenössische «Quellen», die noch von
Liebenau und Peter gesondert neben Wirz zitiert werden, reduzieren
sich — wie Hans Nabholz (Anz. f. schweiz. Gesch., 1914, Nr. 1, S.-A.
S. 2/3) nachgewiesen hat — auf blosse Abschriften von Wirzens
Schrift (so eine angebl. Schrift des Zürcher Pfarrers Bassler, so auch
ein Manuskript in der Berner Stadtbibliothek mit fast identischem
Titel und dem Zusatz: «Auszug aus den Schriften des Generals Werdmüller»);
oder es sind blosse Notizen von Wirz selbst zu der geplanten
Schrift (so ein Manuskript der Leu'schen Sammlung in der Zentralbibliothek
Zürich).
Chronik des Bauern Johann Jost von Brechershäusern 1598-1656.
Herausgegeben von Wolfg. Friedr. von Mülinen. Bern [ohne Jahr],
Buchdruckerei des Berner Tagblatts. [Original in der Berner Stadtbibliothek.]
—Einziger von einem zeitgenössischen Bauern geschriebener Augenzeugenbericht.
Trotz erklärtermassen herrenfrommer Einstellung
voller echt bäuerlichen Materials.
Tagebuch des Professors Berchtold Haller [zeitgenössischer Griechischprofessor
an der Obern Schule in Bern] Herausgegeben von Heinr.
Türler. In: Berner Taschenbuch 1904, S. 123-137 [«Zeitgenössische
Notizen über den Bauernkrieg»].
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 650 - arpa Themen Projekte
(z. B. über eine sonst nirgends berichtete Bürgerrebellion in der
Stadt Bern während der Belagerung durch Leuenberger).
Joh. Jak. Gruner [während des Bauernkriegs Pfarrer zu Ursenbach,
Kanton Bern], «Rebellion, So sich leider im frühling 1653 jars zugetragen».
Herausgegeben von Fr. Hofmann. In: Berner Taschenbuch
1883, S. 251-254.
— Typischer Agent der Berner Herrenpolitik auf dem Lande.
Franz Hafner [zeitgenössischer solothurnischer Staatsschreiber], Der
klein Solothurner Allgemeine Schaw-Platz... etc. Solothurn 1666.
[S. 603: über Leuenberger].
—Der Solothurner Herrenchronist, der die Schuld am Bauernkrieg
von den Herren auf den «greulichen Kometen mit dem gestutzten
Bart» (vgl. unsere Abb. 1) abwälzt —und darum für «bauernfreundlich»
gilt!
J. Rüetschi [zeitgenössischer Aarauer Stadtschreiber], Beschreibung des
Bauernkriegs. Herausgegeben von G. Tobler. In: Berner Heim (Sonntagsbeilage
zum Berner Tagblatt) 1900, Nrn. 30-35.
—Bauernfeindlich; jedoch wichtiges Lokalmaterial, besonders über
den Aarauer Feldzug des Basler Obersten Zörnlin.
Cysat-Wagenmann [Ludwig Cysat, zeitgenössischer Luzerner Ratsherr
und Landvogt, als Verfasser; Jakob Wagenmann aus Sursee, zeitgenössischer
Kaplan zu Willisau, als stilistischer Mitarbeiter und Verfasser
eines Zusatzes, der «Ominatio» in lateinischen und deutschen
Versen, nebst «Abbildung etlicher Waafen und Prügel welche die
Entlibucher im Schweytzerland gebraucht»; vgl. unsere Abbildung
19], Brevis Relatio Discordiae, Motus et Belli ab Rusticis, aliisque
Subditis contra suos Magistratus in Helvetia. Samt: Ominatio in
bellum rusticum Helveticum. [Original in der Luzerner Stadtbibliothek.
Reichlich zitiert bei Vock und bei Liebenau; Titel siehe unten.]
— Reaktionäre Luzerner Herrenchronik Pat excellence!
Aurelian Zurgilgen [zeitgenössischer Ratsherr, nachmaliger Schultheiss
von Luzern], Wahrhafte und gründliche Beschreibung der entstandenen
Rebellion und Uffstand, sowohl einer Bürgerschaft als der Unterthanen
der Stadt Luzern gegen ihre natürliche von Gott gesetzte
Obrigkeit, welche sich erhebt Anno 1653. [Original in der Luzerner
Stadtbibliothek. Vor allein zitiert bei Vock.]
— Ebenfalls reaktionäre Luzerner Herrenchronik; jedoch mit
viel Material im Anhang: Briefe, Spruchbriefe, Mannschaftsverzeichnisse
und Kostenrechnungen.
Mathaeus Merian, Theatrum Europaeum, Bd. VII, 1651-1658 [erschienen
1653]. Mit Bildnissen von Schybi S. 387 [unsere Abbildung 4]
und Leuenberger S. 390 [unsere Abbildung 8].
—Im Text ist der Bauernkrieg nach einer Vorlage der bernischen
Regierung abgehandelt.
Berichte des St. Galler Hauptmanns Christoph Studer im Stadtarchiv
St. Gallen [ein Brief an den Stadtschreiber Zollikofer, sieben Briefe
an den Bürgermeister David Cunz von St. Gallen]. Herausgegeben
von Traugott Schiess. In: Anzeiger für schweizerische Geschichte
1908, Nrn. 2 u. 3, S. 297-320.
Bericht des Thurgauer Hauptmanns Hans Kaspar Müller. In: Thurgauische
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, 1863, Heft 3.
Frauenfeld 1863.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 651 - arpa Themen Projekte
Tagebuch des Zürcher Regimentsschreibers Hans Kaspar Scheuchzer.
Herausgegeben von Hans Nabholz. In: Anzeiger für schweizerische
Geschichte 1914, Nr. 1, S.-A. S. 20 ff.
Bericht des St. Galler Korporals Georg Basthart, «Einfältig auffgesetzte
Bericht und Memorial, was wehrenter schweizerischen Unruhen
sich begeben und zuogetragen hat.» Herausgegeben von Hans
Nabholz. In: Anzeiger für schweizerische Geschichte 1914, Nr. 1,
S. 28 ff.
Berichte des Schaffhauser Obersten Joh. Konrad Neukomm an seine
Regierung. Herausgegeben von Hans Nabholz. In: Anzeiger für
schweizerische Geschichte 1914, Nr. 1, S. 18 ff.
Anonymer Bericht eines Zürcher Offiziers [aus dem Stab des Generalmajors
Job. Ruh. Werdmüller], «Extrakt aus einem an einen guten
Freund abgegangenen Schreiben...» etc. Herausgegeben von Hans
Nabholz. In: Anzeiger für schweizerische Geschichte 1914, Nr. 1,
S. 22 ff.
Aufzeichnungen des Franziskaners Franz Katzengrau. Herausgegeben
von Th. von Liebenau. In: Anzeiger für schweizerische Geschichte,
1888, S. 223. [Besonders über das Aufgebot von Truppen in Freiburg,
im Waadtland und in Neuenburg durch die Berner Regierung.]
Verhörprotokolle [sog. «Minuten»], unter dem Titel «Ueber die Geständnisse
und letzten Augenblicke der luzernischen Bauernführer»
[Aufzeichnungen in der Historia Societatis Jesu Lucernae] publiziert
von Theod. von Liebenau. In: Anzeiger für schweizerische Geschichte
1906, Nr. 3, S. 75 ff. Verhöre von: Kaspar Steiner S. 75 f., Jakob
Stürmli S. 77 f., Christian Schybi S. 78 f., Hans Emmenegger S. 79 f.
Markus Huber [zeitgenössischer Zürcher Theologiestudent, während des
Bauernkriegs Hauslehrer beim Landvogt Willading im Schloss Aarwangen]
[zitiert nach Liebenau]:
1. Verzeichnis dieses Auflaufs und Bauern-Kriegs, so wie man im
Schloss Aarwangen vernommen, gehandlet, gesehen und darvon erfahren
hat Anno 1653. — [Nach Liebenau «eine schlichte, sehr
brauchbare Relation».]
2. Oratio historien de seditione rustica Anno 1653, in ditio ne (?)
et page Bernensi et Lucernensi oxorta; habita Tiguri 26. Augusto
ejusdem anni a Marco Hubero Stud. Tigurino, Paedotriba in Arco
Arwangen. —[«Worin», nach Liebenau, «der Stoff bereits rhetorisch
umgestaltet ist».]
3. Historischer Bericht, wie der blutige mörderische Anschlag der
rebellischen Bauern wider einer löbl. Stadt Zürich Kriegsvolk entdeckt
und geoffenbart worden. —[Selbst nach Liebenau «ein freches
Lügenstück»!]
—Diese 3 Quellen werden bei Vock, Bögli, Liebenau, Peter, Kasser
(siehe die Titel unten) u. v. a. neueren Darstellern immer noch als
«gute zeitgenössische Quellen» ausgiebig und meist kritiklos benutzt,
wobei bald der einen, bald der andern der Vorzug gegeben wird.
Vock z. B. drückt das «freche Lügenstück» treugläubig in extenso
ab. Noch Peter (Jahrbuch für schweiz. Geschichte. 34. Bd., S. 156,
Anm. 4) gibt sich, Liebenaus Qualifikation als «Lügenstück» ausdrücklich
zum Trotz, den Anschein, es ernsthaft als Beleg zu zitieren!
Weil es eben für die Stützung der eifersüchtig gehüteten Herrenlegende
über den Bauernkrieg «sehr brauchbar» ist, wie Quelle
1 und 2 auch für Liebenau! Kasser hält sich mehr an die vielen,
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 652 - arpa Themen Projekte
die im «Verzeichnis dieses Auflaufs», Hubers Tagebuch, enthalten
sind. Aber nach dem nicht minder herrenfrommen Kasser ist auch
«dem Tagebuch Hubers der Stempel seines Brotherrn aufgedrückt»;
und von letzterem sagt er: «mit besonderer Vorliebe führt er die
Unterthanen an der Nase herum» (S. 324). Das tut auch sein abstossend
untertäniger Hauslehrer Markus Huber der ganzen Historiker-Nachwelt
(bis heute) gegenüber! Solche kriecherischen Karrieristen
liefern als Chronisten ihrer Brotgeber zum grossen Teil das
von den Historikern so hoch geschätzte Rohmaterial zu dem, was
wir alle viel zu treugläubig als wirklich geschehene «Geschichte»
hinnehmen...
Auszüge aus den Ratsprotokollen von Nidwalden. Herausgegeben von
Odermatt. In: Archiv für schweiz. Reformationsgeschichte, 1874, III,
S. 380
Fritz Jecklin, Materialien zur Standes- und Landesgeschichte Gemeiner
III Bünde, I. Bd.: Regesten. [S. 411 f: Aktennachweise über das Auf-.
gebot, sowie über Bestrafung wegen Nichtbefolgung des Aufgebots
der Bündner Truppen zum Feldzug gegen die Bauern.] Chur 1907.
B. Darstellungen
(gesamthafte und teilweise; in chronologischer Reihenfolge; Auswahl,
und keine vor Vock).
Alois Vock [ehemals Domdekan in Solothurn], Der Bauernkrieg im
Jahr 1653, oder der grosse Volksaufstand in der Schweiz.
1. Ausgabe in: Helvetia, Denkwürdigkeiten für die XXII Freistaaten
der schweiz. Eidgenossenschaft, Bd. VI, Aarau 1830, S. 133-355;
S. 377-466; S. 499-634.
2. Ausgabe als separates Buch: Aarau 1831. (Mit Bildnissen Emmeneggers
— unsere Abbildung 3 —, Leuenbergers, Caspar Steiners und
Schybis.)
— Wohlwollender katholischer Herrenchronist. Immer noch die
beste und vollständigste Gesamtdarstellung.
Franz Anseim Deuber, Geschichte der Bauernkriege in Teutschland
und der Schweiz. Freiburg 1833. [Ueber den schweiz. Bauernkrieg:
S. 278-318, dargestellt nach Vock.]
Karl Wegelin, Geschichte der Landschaft Toggenburg, II. Bd., St. Gallen
1833. [S. 245-46: über die Kriegsunlust und Meuterei der Toggenburger
beim Aufgebot gegen die Aufständischen.]
Anton von Tillier, Geschichte des Freistaates Bern, Bd. IV, S. 143-204.
Bern 1838.
— Protestantischer, aristokratischer Herrenchronist; glorifiziert die
Unterdrückungspolitik seiner Klasse und seiner Vorfahren, deren
einer —Abkömmling aus der von den Berner Herren unterdrückten
Waadt — an der Niederwerfung der Bauern 1653 selber teilgenommen
hat.
Peter Felber [Populäre Erzählung des Bauernkriegs als Begleittext zu
Martin Distelis Bildern: woraus unsere Abbildungen 21, 24, 27, 28,
29, 31 ausgewählt]. Im Schweiz. Bilderkalender für die Jahre 1839
und 1840.
L. Vulliemin, Geschichte der Eidgenossen während des 17. und 18.
Jahrhunderts (Fortsetzung der Johannes von Müller'schen «Geschichten
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 653 - arpa Themen Projekte
Zürich 1845.
— Sympathisch demokratisch; jedoch pietistisch-sittenrichterlich
und voller edler liberalistischer Illusionen; infolgedessen, trotz reichen
Quellenmaterials, oft ungenau.
Kasimir Pfyffer, Geschichte der Stadt und des Kantons Luzern, I. Bd.,
S. 334-399. Zürich 1850.
— Sehr mit den Bauern sympathisierende, lebendige und freigesinnte
Darstellung; jedoch in der staatsrechtlichen Auffassung wesentlich
abhängig von der gemässigt herrenfrommen Auffassung
Vocks. Pfyffer fällt auch dem «frechen Lügenstück» des Markus
Huber, sowie noch mancher Herrenlegende Zurgilgens und Cysat-Wagenmanns,
zum Opfer.
J. N. E. Berchthold, Histoire du Canton de Fribourg, Bd. III, Kap. II,
S. 31-60. Fribourg 1852.
— Grossartig echt demokratisch! Absolut einzige Ausnahme herrentraditionsfreier
Auffassung! S. 36: «Die Geschichtschreibung muss
heute den Flecken wieder auslöschen, den sie dem zweiten Erwachen
der Demokratie in der Schweiz aufgeprägt hat.» S. 43: «Noch
nie war in der Schweiz der Kampf zwischen beiden Prinzipien (der
Tyrannei und der Freiheit) in solch zugleich kolossaler und solch
dramatischer Form entbrannt.» S. 58: «Die Geschichte, heute wieder
auf die Höhe ihrer Würde gebracht, muss die Erinnerung an die
ruhmreichen Opfer wieder heraufbeschwören, die sich der Sache
des Volkes hingaben, muss ihr Gedächtnis wiederherstellen und ihre
Namen in unsterblichen Zügen eintragen.» Leider hat dieses grandiose
Programm Berchtholds —das dieser selbst im Rahmen seiner
fryburgischen Kantonsgeschichte naturgemäss nicht voll entwickeln
konnte —bis heute keinen würdigen Erfüllet gefunden!
David Nuscheler, Geschichte der Zürcher Artillerie, 4. Heft [Darstellung
der militärischen Ereignisse bei und nach dem Auszug der Tagsatzungstruppen
unter den Generalen Werdmüller]. Im 48. Neujahrsblatt
der Zürcher Feuerwerker-Gesellschaft, 1853, S. 88-95.
Andreas Heusler, Der Bauernkrieg von 1653 in der Landschaft Basel.
Basel 1854.
—Objektiv beste Darstellung, hervorragend dokumentiert, klar und
realistisch; staatsrechtlich reaktionär (Linie Wettstein).
Ph. A. von Segesser, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern,
Bd. III, S. 196-240. Luzern 1857.
— Darstellung des Bauernkriegs in rechtshistorischer Beleuchtung,
jedoch nur im Rahmen des «Bürgerhandels», zu dem wertvolle Akten
beigesteuert werden.
J. J. Brodbeck, Geschichte der Stadt Liestal. Liestal 1864. [Ueber den
Bauernkrieg —dargestellt nach Heusler —: S. 116-140; S. 141-42.]
Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz, II. Bd. S. 684-706: «Aristokratie
und Bauernkrieg». Zürich 1885.
— Echt demokratisch gesinnte Darstellung; jedoch objektiv ungenügend,
sowie von liberalistischen Illusionen über den «Patriotismus»
führender Herren (Waser, Zwyer, Wettstein etc.) geleitet.
Anton Odermatt [Kaplan zu Stans], Beiträge zur Geschichte Nidwaldens,
4. Heft, S. 94-105. Stans 1887.
Hans Bögli, Der bernische Bauernkrieg in den Jahren 1641 und 1653.
Nach den Akten im bernischen Staatsarchiv dargestellt. (Dissertation.)
Langnau 1888.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 654 - arpa Themen Projekte
im Widerspruch damit, in wichtigen Punkten staatsrechtlich von
der Herrentradition abhängig.
Basilius Hidber, Schweizer Geschichte, II. Bd., S. 213-249 (u. S. 270).
Bern 1888.
— Sympathisch bauernfreundlich; erkennt auch die geschichtliche
Tragweite der brutalen Niederwerfung des eigenen Volkes für die
innere Aushöhlung der Eidgenossenschaft; fällt trotzdem im Tatsächlichen
den meisten Herrenlegenden zum Opfer (z. B. auch dem
«frechen Lügenstück» des Markus Huber).
Theodor von Liebenau [ehemals Staatsarchivar in Luzern}, Der luzernische
Bauernkrieg vom Jahre 1653. In: Jahrbuch f. schweiz. Geschichte,
Bd. 18 (1893): S. 229-331; Bd. 19 (1894): S. 71-320;
Bd. 20 (1895): S. 1*-233* [*gesondert paginiert].
— Umfassendste, stoffreichste, auf die Staatsakten Luzerns, Berns,
Solothurns und zahlreiche Lokalakten gestützte und daher unerlässliche
Darstellung; jedoch mehr ein Haufen von Notizen, mit
schludrigen Quellennachweisen und oft regellos durcheinandergeworfener.
Chronologie. Politisch ausgesprochen bauern- und fortschrittsfeindlich;
staatsrechtlich konservativ, geradezu feudalistisch;
konfessionell gehässig beschränkt. Kurz, das Werk eines reaktionären
katholischen Herrenchronisten. So sieht die Schweizergeschichte
aus, wenn sie von einem hochadligen Abkömmling aus der Mesalliance
eines fremden Fürsten geschrieben wird, der von unserer
eigenen reaktionären Herrenklasse submissest als «Schweizer»
(zweiter Generation) in eine Staatsstelle aufgenommen wird!
Hans Nabholz, Der Anteil der Grafschaft Lenzburg am Bauernkrieg
1653. In: Taschenbuch der Historischen Gesellschaft des Kantons
Aargau für das Jahr 1902. [Hier nach dem gleichzeitigen Separatabzug
zitiert.]
— Hervorragend quellenmässig gearbeitete, lebendige Darstellung;
jedoch in manchen bauernfeindlichen Urteilen von Liebenau abhängig.
Hans Wattelet, Aus dem alten Murtenbiet. Teil 3: Zur Geschichte des
Bauernkriegs. In: Freiburger Geschichtsblätter IX, Freiburg 1902,
S. 1-27; S. 103-109. [Dokumentierte, krass herrenfromme Darstellung
der Rolle der Fryburger Herrentruppen unter Reynold, ihrer
Meuterei bei Gümmenen, sowie der Rebellion der Greyerzer etc.]
Emil Frey [Oberst, Alt-Bundesrat], Die Kriegstaten der Schweizer, dem
Volk erzählt. [Bauernkrieg: S. 575-587.] Neuenburg 1904.
— Populär-«patriotische» Darstellung.
H. Hartmann, Die Baselbieter Bauern im Bauernkrieg vom Jahre 1653.
Gewidmet vom Kantonalen Landwirtschaftlichen Verein von Baselland.
Liestal 1904. [Im Anhang: «Lied zur Einweihung des Denkmals
für die Märtyrer des Bauernkriegs von Baselland» von
J. V. Widmann.]
— Gedenkschrift zur Einweihung des Denkmals in Liestal am 25.
September 1904.
Paul Kasser, Geschichte des Amtes und Schlosses Aarwangen. In: Archiv
des Historischen Vereins des Kantons Bern, 19. Bd., S. 254 ff.
Bern 1908-09.
— Reicher, unerlässlicher lokalgeschichtlicher Stoff zum Bauernkrieg
im Oberaargau; jedoch zu unkritisch gestützt auf die Augenzeugen-
(und teils Schwindel-) Berichte des fanatisch herrenparteiischen
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 655 - arpa Themen Projekte
Schloss Aarwangen.
Gust. Jak. Peter, Zürichs Anteil am Bauernkrieg 1653. In: Jahrbuch
für schweiz. Geschichte, Bd. 33 (1908): S. 293-345; Bd. 34 (1909):
S. 1*-237* [*gesondert paginiert].
— Hervorragend quellenmässig gearbeitete, stoffreiche und grundlegende
Arbeit (auch über ausserzürcherische Belange); daher unerlässlich.
Jedoch ausgesprochen hochmütig bauernfeindlich den
Herrenstandpunkt vertretend, im Namen einer geradezu «autoritären»
Staatsauffassung; dabei konfessionell eng protestantisch. Kurz,
das Werk eines reaktionären protestantischen Herrenchronisten
(darin, nur darin, das Seitenstück zu Liebenaus Arbeit im gleichen
Jahrbuch, gegen die Peter aus Gründen protestantischer Politik gelegentlich
polemisiert).
Johannes Dierauer, Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft,
Bd. IV, Kap. 2: «Die Niederwerfung des Bauernaufstands 1653».
Gotha 1912.
— Uebernimmt, trotz liberal-demokratischer Grundgesinnung, alle
Hauptthesen der Herrentradition.
Gottfried Guggenbühl, Der schweizerische Bauernkrieg. In: «Bilder
aus der Schweizer Geschichte», unter dem Protektorat der schweiz.
gemeinnützigen Gesellschaft herausgegeben vom Verein für Verbreitung
guter Schriften. Zürich 1913.
—Ausgezeichnete, knappe und sympathisch bauernfreundliche Darstellung
für das Volk; aber auch sie partizipiert in staatsrechtlicher
Hinsicht noch — unvermeidlich — an der erdrückenden Herrentradition.
Hans Nabholz, Der Kampf bei Wohlenschwil, 3. Juni 1653. In: Anzeiger
für schweiz. Geschichte 1914, Nr. 1 [Separat-Abzug].
— Mustergültige quellenkritische Arbeit; räumt mit viel Quellenwust
auf und reduziert vier «verschiedene» Quellen auf eine einzige:
die Schrift von Wirz; publiziert die Quellen von Scheuchzer, Basthart,
Neukomm und den «Brief an einen guten Freund» (siehe oben
unter A. Quellen) zum erstenmal. Trotzdem einseitiges Bild vom
Entscheidungskampf bei Wohlenschwil, nämlich «so wie er sich ergibt,
wenn man in erster Linie von den Rapporten der beteiligten
Offiziere» (Nabholz, S. 7), mithin von der Herrentradition, ausgeht.
Richard Feiler, Geschichte der Schweiz im 17. und 18. Jahrhundert.
In: «Geschichte der Schweiz» {Gemeinschaftswerk der Professoren
Nabholz, von Muralt, Feiler, Bonjour], Bd. II, S. 1 ff. Zürich 1931.
— In dieser umfassenden Schweizergeschichte, der letzten hochoffiziellen
unserer Universitätswissenschaft für das Schweizer Volk,
sind dem grössten Volksaufstand seiner Geschichte (ausser dem
Sonderbundskrieg) in der Darstellung Feuers ganze 10 Seiten gewidmet!
Nimmt man die Vorgeschichte und die Wirtschaftsgeschichte
der ganzen Epoche, sowie die politischen und sittengeschichtlichen
Schlussfolgerungen der Herren (unter dem Titel »Reformen»
hinzu, so sind es 19 Seiten. Aber selbst bei diesem geringen
Umfang brauchte die Darstellung Fellers nicht so oberflächlich
und vor allem so ausgesprochen herrenfromm zu sein, wie sie es ist.
Der Geist seiner Darstellung geht schon daraus hervor, dass Feiler
beispielsweise im Schlussabschnitt (betitelt: «Das Strafgericht»!) zur
Rechtfertigung der Härte der «Ahndung», d. h. der Herrenrache an
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 656 - arpa Themen Projekte
unterschiebt, durch den die Empörung «erschwert» worden
sei. Das ist genau die These der absolutistischen Herren von 1653 —
die These der «autoritären» Herren von heute. Genau das Gegenteil
ist richtig: durch schamlose Fälschung des «Rechtlichen Spruchs»
vom 18. März seitens des «allverehrten» Urner Obersten und österreichischen
Feldmarschalls Zwyer und seiner eidgenössischen Mit-«Ehrengesandten»
in Ruswil und Luzern, sowie durch hartnäckige
Vorenthaltung der ausdrücklich vereinbarten schriftlichen Ausfertigung
der (an sich schon sehr kläglichen) «Konzessionsartikel » vom
4. und 9. April den Emmentaler und Oberaargauer Bauern gegenüber,
haben die Herren den Bauern das Wort gebrochen! Und darum
haben diese den grösseren, allgemein schweizerischen Volksbund
gegen den Herrenbund gegründet und sind mit vollem Recht wieder
ins Feld gezogen, um sich das Recht zu erzwingen, das man ihnen
vorenthielt! —Wie lange erträgt denn wohl das Schweizervolk (und
die Schweizer Wissenschaft!) noch solche antidemokratischen Verfälschungen
seiner einst so blutig erlittenen Geschichte...?
Jos. Rösli, Die Bestrafung der Berner Bauern im Bauernkrieg 1653.
(Dissertation.) Bern 1933.
— Eine Fülle von unentbehrlichen aktenmässigen Materialien zur
räch- und gewinnsüchtigen Klassenjustiz der Berner Herren gegen
die Berner Bauern! Die Schrift liefert auch genaue realistische Details
zur Biographie aller bernischen Bauernführer, sowie zur Lokalgeschichte
aller in den Krieg verwickelten bernischen Amtsbezirke.
Die einleitend gegebene Darstellung des Bauernkriegs als Ganzes ist
dürftig und politisch-staatsrechtlich ebenfalls ganz unter dem Bann
der Herrentradition.
Paul Guggisberg [bernischer Regierungsrat], Der bernische Salzhandel.
In: Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern, 32. Bd.,
1. Heft. Bern 1933. [Ueber die Rolle der Salzfrage im Bauernkrieg:
S. 28 ff.]
— Ausgezeichnet quellenmässig gearbeiteter Beitrag zu den Wirtschaftskämpfen
im Bauernkrieg. Bemerkenswert kritisch im Einzelnen,
weil die wirtschaftlichen Folgen des Willkürregimes schwer zu
vertuschen sind; schliesst sich aber im Ganzen doch entschlossen
der Herrentradition an.
Fritz Bürki, Berns Wirtschaftslage im Dreissigjährigen Krieg. In: Archiv
des Historischen Vereins des Kantons Bern, 34. Bd., 1. Heft.
Bern 1937. [Darin insbesondere Abschnitt 4, «Die Abwertung der
Batzen 1652», S. 46 ff.; sowie das Schlusskapitel «Ursachen des
Bauernkriegs», S. 184 ff.]
— Sehr wertvolles Material zur Erkenntnis der wirtschaftlichen
Kausalitäten auch im Bauernkrieg. Politisch jedoch reaktionär,
entschlossen «autoritär» zugunsten des absolutistischen Herrenstaates..
Z B. S. 199: «Die Machtprobe von 1653 war vor allem
eine psychologische (!) Notwendigkeit. Sie brachte endlich die
klare Entscheidung darüber, wer befahl und wer zu gehorchen
hatte»! S. 200: «Der eindeutige Sieg des Regimes brachte den Ruf
nach Brief und Siegel» (d. h. nach dem verbrieften Recht!) «für
eine Zeitlang zum Schweigen; das Regierungsmandat, das Gesetz
des Staates» (d. h. die gewaltsame Usurpation auf Kosten der Volksrechte!)
«triumphierte». Man glaubt einen zarentreuen russischen
Historiker zu lesen.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 657 - arpa Themen Projekte
Ernst Gagliardi, Geschichte der Schweiz von den Anfängen bis zur
Gegenwart, II. Bd. S. 752-757. Zürich 1939 (4. Auflage). [1. Auflage
1920-27; 2., umgestaltete Auflage: 1934-37.]
— Ganze 6 (!) Seiten über den Bauernkrieg in diesem dreibändigen
Werk von 1800 Seiten! Und dabei ohne jede Spur von Erfassung
der geschichtlichen Realität oder gar der geschichtlichen und
sozialen Tragweite dieses tiefstgreifenden Klassenkampfes unserer
Geschichte (ausser der bürgerlichen Revolution zwischen 1830
und 1848, die im Sonderbundskrieg gipfelte). Dieser Kampf ist eine
blosse «Erregung — die neben viel Berechtigtem fast possenhafte
Züge aufwies», und vor allein ist er auch in den Augen Gagliardis
eine lediglich «rückwärts gewandte» Bewegung: genau wie für die
feudalen Herren des 17. Jahrhunderts —und auch, ja verstärkt, für
sämtliche bürgerlichen Herrenchronisten der Neuzeit! Von Vock bis
Gagliardi — mit einziger Ausnahme des Fryburger Kantonsgeschichtschreibers
Berchthold (s. o.) —hat sich noch ein jeder auf
das hohe Ross der «staatsrechtlichen» Weisheit (einer echten Papierweisheit!)
gesetzt: weil das Programm der Bauern von 1653 die
«Wiederherstellung» der alten Eidgenossenschaft von 1291 war (d. h.
die «Wiederherstellung» der ihnen allein bekannten «alten» Freiheiten
und Volksrechte!) — so seien auch die wirtschaftlichen und politischen
Realitäten von 1653, um die es für die Bauern und das ganze
Schweizervolk in diesem Wiederbefreiungskampf allein wirklich
ging, reaktionär gewesen! Diese Realitäten waren jedoch in Wirklichkeit
so revolutionär, dass sie — ganz gleich, unter der Fahne
welches Programms sie erfochten werden sollten — nahe daran
heranführten, in den Hauptstädten der Schweiz (Luzern, Zürich,
Basel, Bern) die bürgerliche Revolution zu entfesseln — was dann
eine Vorstufe der Französischen Revolution von 1789 hätte werden
können, wie sie sich im gleichzeitigen England durch Cromwell schon
seit dem Jahr 1649, dem Sieg der Indepenten über den Absolutismus
im Namen der Volkssouveränität, entwickelt hat. Der wahre Grund
des geradezu grotesken Versagens aller unserer bürgerlichen Historiker
dem Bauernkrieg gegenüber ist ihr Unvermögen, diesen Krieg
als Klassenkampf — mit allen dialektischen Gegensätzlichkeiten
eines solchen — zu erkennen. Dieses Unvermögen seinerseits ist nichts
anderes als der Ausfluss des allgemeinen bürgerlichen Vorurteils
oder vielmehr Vorwandes, dass es in der Geschichte keine Klassenkämpfe
gebe bezw. geben dürfe. Das halten sie offenbar für das
sicherste Mittel, die wirklich bestehende Klassenherrschaft, nämlich
die ihrer eigenen Klasse, vor der Konkurrenz einer anderen Klasse
zu schützen! Als ob die von ihnen so gefürchtete andere Klasse, die
ihnen die Macht entreissen könnte, deshalb nicht existierte! Auch
eine Papierweisheit, die wegen eines Programms die geschichtliche
Wirklichkeit (diesmal die von heute) nicht sieht bezw. nicht sehen will!
Valentin Gitermann, Geschichte der Schweiz. 2., verbesserte Auflage,
S. 246-251. Thayngen-Schaffhausen 1941.
— Bei 560 Seiten Umfang — ganze 4 1/2 Seiten über den grössten
Klassenkampf unserer Geschichte! (Neben dem im Sonderbundskrieg
gipfelnden.) Und dies bei einem Historiker, der zweifellos eine
wissenschaftlich marxistische Schulung besitzt und den historischen
Materialismus beherrscht. Davon ist in dieser Darstellung des
Bauernkriegs nicht ein Hauch zu verspüren. Daran ändert auch
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 658 - arpa Themen Projekte
durchschimmert, nichts. Alles reduziert sich in Herrenlegenden-Weise
auf «die Opposition des Dorfes gegen die städtische Herrschaft»
und auf die blosse Münzabwertung, die ein lediglich auslösender
Faktor, keine tiefere Ursache war. Charakteristischerweise
spitzt sich denn auch der Ausgang dieses grossen Schicksalsgeschehens
bei Gitermann auf die mesqine Affäre des Landvogts
Samuel Tribolet, eines einzelnen Herrensünders, zu. Symptomatisch
für den Bärendienst am Volke und für den faktischen wenn auch
unwillentlichen —Dienst am Herrentum, den selbst diese Schweizergeschichte
eines Sozialdemokraten leistet, ist endlich auch die
falsche Wahl des Leuenbergerbildnisses bei S. 225: eines aus der
gang und gäben Reihe der Herrenkonterfeie.
C. Einzelschriften über Bauernführer
|
Leuenberger: |
H. Bögli, Der Obmann Niklaus Leuenberger. [Im Anhang zu der unter
B zitierten Schrift «Der bernische Bauernkrieg...» etc., S. 89 ff.]
H. Bögli, Niklaus Leuenberger und der Bauernkrieg von 1653. In:
Schweizer Bauer, 1900, Nr. 6. [Mit vielen Illustrationen, Bildnissen
und Handschriften-Facsimiles.]
Hrch. Türler, Zur Geschichte des Bauernkriegs und Notizen über Niklaus
Leuenberger. In: Berner Taschenbuch 1903. [Bei S. 226: Einziges
authentisches Bildnis Leuenbergers vor seiner Gefangennahme
— unsere Abbildung 6.]
Alfr. Bärtschi, Von dem Löwenberger. In: Blätter für bernische Geschichte,
Kunst- und Altertumskunde, 20. Jahrgang (1924), Heft 1,
S. 108-112. [Enthält den Wortlaut eines alten volkstümlichen
Leuenberger-Liedes.
Gottfr. Flückiger, Klaus Leuenberger und der schweiz. Bauernkrieg
von 1653. Festschrift zur Erinnerung an die Einweihung des Leuenberger-Denkmals
in Rüderswil am 7. Juni 1903. Herausgegeben von
der Oekonomischen und Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons
Bern. Bern 1903.
|
Daniel Küpfer: |
Fr. Graf, Der Schmied von Grosshöchstetten [D. Küpfer] und andere
Konolfinger Führer im Bauernkrieg 1653. In: Blätter für bernische
Geschichte, 14. Jahrgang (1918), 4. Heft.
|
Schybi: |
Joh. Leop. Cysat, Beschreibung dess Berühmbten Lucerner- oder Waldstätten
Sees etc. Luzern 1661. [S. 145: Beschreibung der physischen
Stärke Schybis.]
Th. von Liebenau, Der Bauernführer Christian Schybi von Escholzmatt.
In: Kathol. Schweiz. Blätter, 20. Jahrgang (1904), 1. Heft,
S. 318 ff.
J. F. Portmann, Der Bauernkrieg und Christian Schybi. Escholzmatt
1902. [Werbeschrift für die Errichtung eines Denkmals in Escholzmatt.]
|
Joh. Jak. Müller: |
Th. von Liebenau, Der Schriftführer der Entlibucher im grossen
schweiz. Bauernkrieg. In: Kathol. Schweiz. Blätter, 1. Jahrgang
(1885), S. 282 ff.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 659 - arpa Themen Projekte
|
Kaspar Steiner |
Hans Domann, Sigrist Kaspar Steiner aus Emmen und der Bauernkrieg
1653. Sonderdruck aus: «Die Heimat», Emmenbrücke 1937.
|
Adam Zeltner: |
Ferd. von Arx, Untervogt Adam Zeltner und seine Teilnahme am
Bauernaufstand 1653. Olten 1913.
D. Einzelschriften über Herrenführer
Zwyer:
C. K. Amrein, Sebastian Peregrinus Zwyer von Evibach. St. Gallen 1880.
|
Zwyer und Wettstein: |
Hans Baur, Bürgermeister Wettstein und Landammann Zwyer. Ein
vaterländisches Freundespaar im Kampf gegen Frankreichs Umklammerung
der Schweiz. Separat-Abdruck aus «Das Freie Wort»,
Bern 1920.
—Im Zeichen blühendster Herrenlegende und Herrenverhimmelung
(seitens eines Pfarrers!). Zwyer hat ja selbst, als erster Agent des
Kaisers und sein Dublonenverteiler in der Schweiz (als Vertrauter
der Habsburger, der Erzfeinde der Eidgenossenschaft!) sein Bestes
getan, um die Schweiz für die Konkurrenten des französischen Königs
zu «umklammern»!
|
Wettstein: |
A. Heusler, Bürgermeister Wettsteins eidgenössisches Wirken in den
Jahren 1651-1666. Basel 1843.
F. Fäh, Joh. Ruh. Wettstein. In: Basler Neujahrsblätter 1895.
Socin (Wettsteins Gesandter):
Th. Burckhardt, Oberstzunftmeister Benedict Socin. In: Basler Bei
träge zur vaterländischen Geschichte, Jahrgang 13 (1893), S. 42-49.
|
Waser: |
W. Utzinger, Bürgermeister Joh. Heinr. Wasers eidgenössisches Wirken
1652-1669. Zürich 1903. {S. 115 ff: Belastende Dokumente für
die Käuflichkeit Wasers beim Abschluss des Soldbündnisses der
XIII Orte mit Ludwig XIV.]
R. Maag, Bürgermeister Waser. In: Anzeiger für schweiz. Geschichte
1890, Nr.6, S. 125 f.
G. Meyer von Knonau, Artikel über Waser in: Allgemeine Deutsche
Biographie, Bd. 41 (1896), S. 214 ff.
|
Sigmund von Erlach: |
E. Bloesch, Artikel über Joh. Ludw. und Sigmund von Erlach in Allgemeine
Deutsche Biographie Bd. 6 (1877), S. 223.
Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, III. Bd.: Artikel über
Sigmund von Erlach.
R. de Steiger, Les Géneraux Bernois. Berne 1864.
|
Tribolet: |
H. Türler, Der Prozess gegen Landvogt Samuel Tribolet 1653 und 1654.
In: Berner Taschenbuch 1891, S. 143 ff.
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 660 - arpa Themen Projekte
|
Joh. Konrad und Joh. Rudolf Werdmüller: |
Zeller-Werdmüller, Artikel über beide in: Allgemeine Deutsche Biographie,
Bd.41 (1896), 771-773.
Wilhelm Meyer, Joh. Rudolf Werdmüller. In: Neujahrsblatt der Feuerwerkergesellschaft,
Zürich 1874.
E. Andere beigezogene Literatur
Alfr. Zesiger, Wehrordnungen und Bürgerkriege im 17. und 18. Jahrhundert.
In: Schweizer Kriegsgeschichte, Heft 7, S. 10 ff. Bern 1918.
Karl Geiser, Die Verfassung des alten Bern. In: Festschrift zur VII. Säkularfeier
der Gründung Berns 1191-1891.
C. Hilty, Die Bundesverfassungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Zur sechsten Säcularfeier des ersten ewigen Bundes vom
1. August 1291 geschichtlich dargestellt im Auftrag des schweiz.
Bundesrathes. Bern 1891.
— Ausser für den Wortlaut des Stanser Verkommnisses (S. 99 ff.)
und den Wortlaut des Sumiswalder- und Huttwiler-Bundesbriefes
(S. 288 11.). auch für die hervorragend freimütige dokumentarische
Darstellung des Wädenswiler Aufstandes vom Jahr 1646 (S. 163 und
S. 279 ff.).
A. Lütolf, Sagen, Bräuche und Legenden aus den fünf Orten. Luzern
1865. [S. 427 f.: über die «Galgenfahrten» bezw. «Galgenwallfahrten»
des Luzerner Volkes zu den Gräbern der hingerichteten Volkshelden
aus dem Bauernkrieg!]
Th. Ischer, Die Gesandtschaft der protestantischen Schweiz bei Cromwell
und den Generalstaaten der Niederlande 1652-54. Bern 1916.
—Treffliches Beispiel für die Klassenpolitik der damaligen Schweizer
Herren! Als sich gerade während des Bauernkriegs der revolutionäre
Charakter der Cromwell'schen Regierung verschärfte (Auflösung
des Langen Parlaments am 19. April 1653), da zuckten die
Schweizer Aristokraten vor einem —lediglich als Verstärkung der
protestantischen gegen die katholischen Herren erstrebten —Bündnis
mit den englischen Revolutionären zurück. Ischer schreibt (S. 46):
«Der neue Staatsstreich hatte... in der Schweiz Misstrauen erregt
und die über ganz Europa verbreitete Furcht und Abneigung gegen
die englischen Revolutionäre bestärkt.» Als sie gar hörten, «das neue
Parlament sei mit grosser Mehrheit dafür, die Zehnten, deren sich
das englische Landvolk beschwere, abzuschaffen» — da war es um
das Bündnis mit der fortschrittlichsten Grossmacht der damaligen
Zeit geschehen... Wer dächte dabei nicht an merkwürdig ähnliche
geschichtliche Verhältnisse unserer unmittelbaren Gegenwart!
K. A. Wittfogel, Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. (Besonders:
3. Kapitel, «Die Bauernkriege», S. 123-162). Wien 1924.
— Trotzdem dieses Buch kein Wort über den schweiz. Bauernkrieg
1653 sagt (wie es überhaupt bezügl. der Schweizer Geschichte
schlecht unterrichtet ist), enthält es doch das grundsätzlich weitaus
Aufschlussreichste auch für diesen. Es gibt nämlich geschichtlich
und soziologisch die denkbar bündigste Antwort auf die Frage: «War
der Bauernkrieg [gemeint ist hier der deutsche von 1525], waren
die Bauernkriege eine fortschrittliche, oder waren sie eine rückschrittliche,
eine reaktionäre Bewegung?» Die Antwort gibt Wittfogel
zunächst an Hand einer schweizerischen Bauernerhebung, und
Mühlestein Schweizer Baurenkrieg 1653 - 661 - arpa Themen Projekte
von 1513 (Wittfogel versetzt sie irrtümlich ins Jahr 1514). Er korrigiert
dabei, als Marxist, Friedrich Engels und schreibt (S. 139):
«Engels bezeichnet die Schweizer Bewegung als eine lokale Erscheinung,
die ihrem Wesen nach reaktionär gewesen sei. Das
trifft freilich für das Programm der Schweizer zu. Aber erstens
hatten sogut wie alle Bauernkriege ein ,reaktionäres' Programm,
wollten veraltete Zustände wieder herstellen — ob dadurch wirklich
die Entwicklung zurückgeworfen wurde, werden wir später
erörtern —, zweitens aber ist der Schweizer Sieg für die Bauern
der andern Länder, z. B. gerade für Deutschland, moralisch von
allergrösster Bedeutung und übrigens auch praktisch nicht ganz
unwichtig gewesen. Von der Schweiz ging ein Geist des Aufruhrs
über die europäische Bauernwelt. Und in der Schweiz fanden,
wie heute in Russland, die revolutionären Flüchtlinge willkommenen
Unterschlupf.» Die Antwort auf die Frage, ob durch die Forderungen
der Bauern die geschichtliche Wirklichkeit zurückgeworfen
wurde, lautet (S. 161): «Sie (die Forderungen der Bauern) liefen in
ihrem Kerne auf die Beseitigung der feudalen Besitzvorrechte an
Menschen, an Leistungen und zum Teil auch an Land hinaus...
Zugleich aber mussten sie mit der Schaffung des kleinen bürgerlichen
Eigentums die allgemeine Ausbreitung der Warenwirtschaft
auf dem Lande zur Folge haben», mithin die Entfaltung der kapitalistischen
Gesellschaft im Schosse der feudalistischen. Dies aber
bedeutete die Mitwirkung an der Herbeiführung der nächstfolgenden
historischen Stufe der menschlichen Gesellschaft und also an
einem entscheidenden Fortschritt der Menschheit. «Insofern waren
die Bauernkriege in ihrem innersten Kern nicht reaktionär, sondern
fortschrittlich, revolutionär. Wie die kapitalistische Klasse, so dienten
auch die um Befreiung vom Joch der Hörigkeit ringenden Bauern
indirekt der Entwicklung der materiellen Produktion, die in jener
Zeit nur mit den Mitteln des Kapitalismus entfaltet werden konnte.
Dabei fiel freilich in grausamer Notwendigkeit die Bauernschaft
diesen Entwicklungsbewegungen des Kapitals später unvermeidlich
zum Opfer»; so nämlich, «dass sie zwar [erst durch die Französische
Revolution] als Sieger, persönlich frei und Herren eines eigenen
Landstückes aus dem Kampf hervorgingen, dass sie aber in der
Folge umso schlimmer von der zermalmenden Angriffsaktion des
Kapitalismus bedrängt und zum Teil ganz von der Scholle gejagt
wurden». .Jedenfalls wurde «der kapitalistischen Verwendung des
Bauernlandes und der kapitalistischen Ausbeutung der bäurischen
Arbeitskraft das Tor weit aufgerissen».
|
Wortlaut des «Neuen Tellenlieds» (oben S. 43-44): |
Liebenau, Jahrbuch für schweiz. Geschichte, XIX., 99 f.: 11 Strophen
nach der Niederschrift des Basler Bürgermeisters Wettstein.
Vock, Der Bauernkrieg im Jahre 1653, im Anhang; sowie
Tobler, Schweiz. Volkslieder, Bd. I, S. 47-51: geben beide eine spätere,
vermehrte Fassung von 26 Strophen.
Geldsorten zur Zeit des Bauernkriegs:
J. Rösli [oben unter B zitiertes Werk], S. VII.
Fr. Schwarz, Segen und Fluch des Geldes in der Geschichte der Völker,
Bern 1931, 241-42.